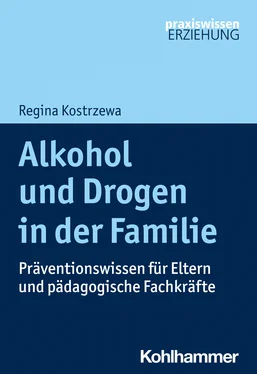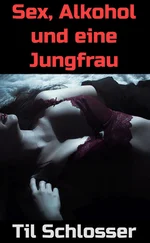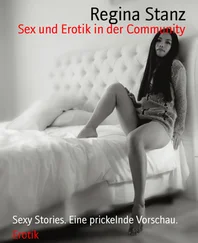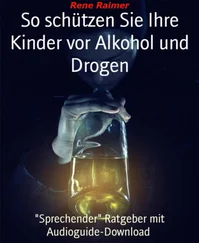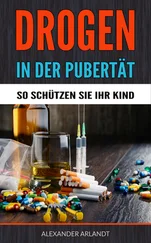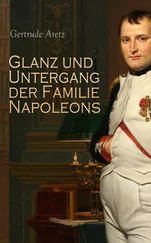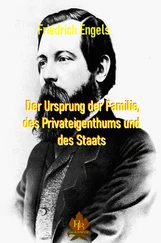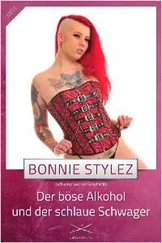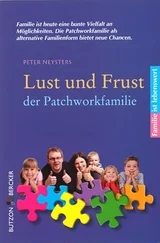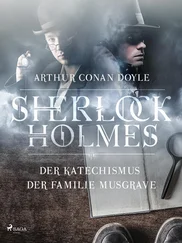2
Erziehung ist die beste Prävention
Erziehung ist wissenschaftlich betrachtet die zielgerichtete Einflussnahme auf die Verhaltensweisen des Kindes, um es auf das gesellschaftliche Leben vorzubereiten. Die Einflussnahme erfolgt dabei in der Regel von Menschen mit einem Vorsprung an Lebenserfahrung, also Eltern oder Erzieher_innen und anderem pädagogischen Fachpersonal. Die Erziehungsziele, die dabei verfolgt werden, dienen der Förderung der kindlichen Kompetenzen und seiner Autonomie sowie der Steigerung des Selbstvertrauens und Selbstwertgefühls, um ein eigenständiger, verantwortungsvoll handelnder Mensch zu werden. Dabei werden verschiedene Erziehungsstile genutzt, die sich grob in vier Stile unterteilen lassen: den autoritären, den vernachlässigenden, den nachgiebigen und den autoritativen. Da letzterer sich nachweislich am positivsten auf die kindliche Entwicklung auswirkt, wird er folgend etwas genauer beleuchtet.
Der autoritative Erziehungsstil lässt sich mit drei relevanten Aspekten beschreiben: Befriedigung kindlicher Bedürfnisse durch positiven Kontakt, Autonomieentwicklung durch Übernahme altersangemessener Aufgaben sowie moderate elterliche Kontrolle mit konsistentem Erziehungsverhalten. Der positive Kontakt beinhaltet Fürsorge und Wärme, d. h., die Eltern fühlen sich mit ihren Kindern emotional stark verbunden, fördern sie in ihren Interessen und zeigen wertschätzende Anerkennung. Der zweite Punkt der realistischen Erwartungen an das Kind trägt zu einem harmonischen Familienleben bei und ermöglicht zugleich dem Kind, ein wichtiger Teil der Familie zu werden, indem es z. B. Aufgaben im Haushalt übernimmt und sich dafür auch verantwortlich zeigt. Im Weiteren thematisieren die Eltern explizit ihre normativen Überzeugungen und Wertvorstellungen, indem sie mit ihren Kindern – abhängig vom Alter – sachlich verbale Aushandlungsprozesse führen, klare Regeln aufstellen und deren Umsetzung konsequent verfolgen. Mit zunehmendem Alter der Kinder erlauben und ermutigen die Eltern die Heranwachsenden eigene Meinungen und Überzeugungen zu entwickeln, um die Autonomie der Kinder zu fördern (Wild, Möller, 2015, S. 238) und die Verantwortung für das eigene Handeln zu tragen. Kurzgefasst lässt sich der autoritative Stil als liebevoller, strenger, konsistenter Erziehungsstil beschreiben, der sich, wie sich in den folgenden Kapiteln zeigen wird, auch als wirkungsvoll im Sinne der Suchtprävention herausstellt.
Prävention bedeutet vorbeugen bzw. zuvorkommen. Bezogen auf den Inhalt des Buches konzentrieren sich die Ausführungen auf die Suchtprävention, also das Vorbeugen eines gesundheitsgefährdenden Konsumverhaltens. Studien belegen: Je früher die Vorbeugung einsetzt, desto zielführender ist sie.



Deswegen sollte Eltern bewusst sein, dass eine konsequente Prävention nicht erst im Jugendalter einsetzt, sondern möglichst von Beginn an erfolgt und sich in der Haltung und dem Konsumverhalten der Eltern zeigt; denn gute Erziehung ist die beste Prävention und setzt zunächst am Verhalten der Eltern an.
2.1 Konsumverhalten: Die Familie im Säuglings- und Kleinkindalter
Im ersten Lebensjahr, bevor Kinder erlernt haben sich mit Worten zu verständigen, steht die nonverbale Kommunikation im Vordergrund. Nicht nur die Eltern beobachten die Signale des Kindes, sondern der Säugling beobachtet sehr intensiv alle nonverbalen Kommunikationsformen der Bezugsperson. Minimale Veränderungen der Mundwinkel oder Augenbrauen lassen das Kind Stimmungen der Erwachsenen erahnen. Durch Versuch und Irrtum gewinnt der Säugling eine untrügliche Sicherheit im Lesen der nonverbalen Signale. Sie lernen, dass die Körpersprache ein verlässlicherer Ausdruck der Stimmung der Eltern ist als die verbale Kommunikation (Kessler, 2005, S. 33). Ein Baby spürt die Gefühle der Mutter auch schon durch den Körperkontakt, d. h., fühlt sich die Mutter oder der Vater z. B. ausgeglichen, überträgt sich diese entspannte Stimmung auf das Kind. Demzufolge können beispielsweise Stressempfindungen der Mutter beim Kind zur Nervosität führen.
Gerade in den ersten Lebensmonaten ist ein intensiver Körperkontakt fürs Baby sehr wichtig, und kann auch nie zu viel sein im Sinne von Verwöhnen. Durch die Haut kann sich der Tastsinn durch Berührungen weiterentwickeln und gleichzeitig zum Wohlbefinden des Babys beitragen und beim Ausbau des Urvertrauens mitwirken. Genauso verhält es sich auch mit dem Blickkontakt zwischen der Bezugsperson und dem Säugling. Nach einigen Lebenswochen gelingt es dem Baby, den Eltern ein erstes Lächeln zu schenken, der Beginn einer positiven Wechselbeziehung zur Steigerung des Wohlbefindens und der Geborgenheit. Gleichzeitig ist es der Beginn der Kooperation zwischen Eltern und Kind. Z. B. kann ein Baby durch ein leichtes Wegdrehen des Kopfes beim Stillen signalisieren, dass es satt ist. Von den Eltern ist also volle Aufmerksamkeit gefordert, um die feinen Botschaften des Babys zu verstehen. Genauso können geringfügige Veränderungen in der Gestik und Mimik, in der Körperhaltung oder im Tonfall vonseiten der Eltern in Verbindung mit den einzelnen Worten vom Kind richtig gedeutet werden. So überrascht es auch nicht, dass schon Säuglinge und Kleinkinder z. B. den Sog der digitalen Medien, der auf die Eltern ausgeübt wird, wahrnehmen und nach kürzester Zeit bestimmte Handbewegungen wie das Wischen auf dem Handy imitieren. Da liegt es nahe, dass jegliche Konsumverhaltensweisen der Eltern vom Kind genau beobachtet und erlernt werden. Zeigt sich dem Kind wiederkehrend beispielsweise in Stresssituationen, dass seine Eltern ein bestimmtes Konsumverhalten anwenden und regelmäßig darauf mit Entspannung reagieren, kann das Kind dieses Reiz-Reaktions-Verhalten unbewusst abspeichern. Darüber hinaus ist es auch wichtig, dass Eltern bewusst darauf achten, das Baby nicht in Situationen durch Nahrungsaufnahme zu beruhigen, in denen es aufgrund anderer Unruhezustände stressvolle Äußerungen gemacht hat. Nach Brisch können Fehlinterpretationen der Bezugsperson in Form von Füttern zwar zur Reduktion der Erregung beim Baby führen, aber aufgrund wiederholter Fehlinterpretationen kann früh ein sogenanntes »Suchtgedächtnis« aktiviert werden (Brisch, 2015, S. 280). Das Kind lernt, dass jegliche Unwohlzustände durch das Zuführen von Ersatzstoffen überwunden werden können. Gerade im Bereich der Nahrungsaufnahme ist besondere Aufmerksamkeit geboten, um von Anfang an den präventiven Gedanken ins Familienleben zu integrieren. Jegliche Formen problematischen Essverhaltens werden in der Regel früh gelegt. Essen dient der Nahrungsaufnahme und dem Genuss, sollte aber nicht zum Trost oder als Belohnung eingesetzt werden.
2.2 Bindungsverhalten: Frühe Einflüsse der Bezugspersonen
Vonseiten der Eltern ist wichtig ihre wohlwollende Grundhaltung gegenüber dem Kind zum Ausdruck zu bringen. Wohlwollen und Liebe verstehen sich als Grundpfeiler der Beziehung zwischen Eltern und Kind. Liebevolle Gefühle müssen in liebevolles Handeln umgesetzt werden, damit der Säugling die Liebe auch spüren kann. So ist bei einem Säugling die prompte Reaktion der Eltern auf seine existenziellen Bedürfnisäußerungen notwendig, um eine sichere Bindung aufbauen zu können. Dieses sichere Bindungsverhalten ist im Sinne einer gesunden Entwicklung des Kindes anzustreben. Die anderen drei zu unterscheidenden charakteristischen Bindungsmuster, das unsicher-vermeidende, das unsicher-ambivalente und das desorganisierte, entstehen aufgrund ungünstiger Interaktionserfahrungen zwischen Eltern und Kind. Eine prompte Reaktion ist positiv, da sie einen erhöhten Erregungszustand beim Kind verhindert und ihm zeigt, dass es von seinen Eltern verstanden wird. So können die Eltern bei kontinuierlicher Bedürfnisbefriedigung des Säuglings für diesen zu einem ›sicheren Hafen‹ werden. Erst dadurch wird dem Kind die notwendige Sicherheit vermittelt, um explorieren zu können, also ›die Welt zu erkunden‹ und Autonomie zu entwickeln. Häufig äußern Eltern Unsicherheit in puncto ›prompter Reaktionen‹ und befürchten sich zum ›Sklaven des Kindes‹ zu machen. Diese Gedanken sind aber im Säuglingsalter unberechtigt, da ein Säugling nicht berechnend handeln kann, sondern nur seine existenziellen Grundbedürfnisse wie Liebe, Nähe, Nahrung und Pflege einfordert.
Читать дальше