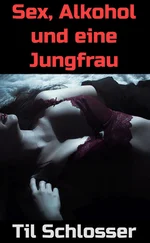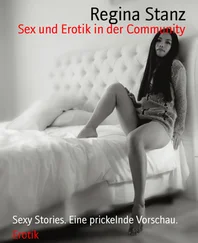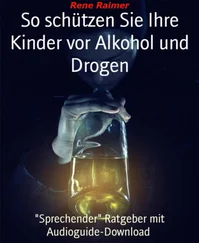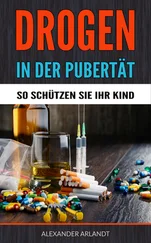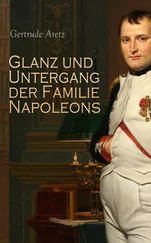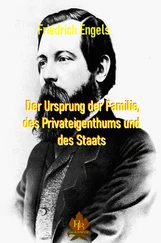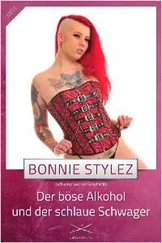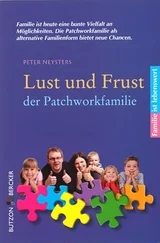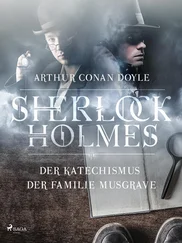Zweifelsohne ist Cannabis in Deutschland die am häufigsten konsumierte illegale Droge. Trotzdem lässt sich in unserer Gesellschaft keine klare Position für oder gegen den Konsum feststellen. Im Gegenteil! Häufig wird ideologisch diskutiert und sich in gespaltenen Lagern positioniert. So ist es heute keine Überraschung, dass sich die Jugend eine eigene Meinung bildet und zunehmend Cannabis ausprobiert. Solange es keine Einigung gibt bzw. keine klaren Strategien verfolgt werden, wird die Jugend ihren eigenen Weg gehen, wie nachfolgende Zahlen nahelegen. Entsprechend der Drogenaffinitätsstudie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) von 2019 haben 10,4 % der 12- bis 17-Jährigen und 46,4 % der 18- bis 25-Jährigen schon einmal Cannabis konsumiert, was einen erneuten Anstieg bedeutet. Der Konsum im Jugendalter birgt besondere Risiken für die Heranwachsenden, die von Kurzzeitfolgen wie Bewusstseinsstörungen, verzögerten Reaktionszeiten bis hin zu Panikattacken reichen können. Langzeitfolgen sind bei regelmäßiger Einnahme durch Jugendliche Wahnvorstellungen/Psychosen, Depressionen, vermindertes Erinnerungsvermögen und veränderte Hirnstruktur sowie erhöhtes Infarkt- oder Schlaganfallrisiko bis hin zur Abhängigkeit. Letzteres tritt umso zügiger ein, je jünger der_die Konsument_in ist! Denn in jungen Jahren lernt das Gehirn noch schneller. So auch hier. Drogen aktivieren das Belohnungszentrum des Gehirns, d. h. durch die Einnahme erfolgt eine Dopaminfreisetzung. Das sind Botenstoffe, die dem_der Konsument_in ein positives Gefühl vermitteln. Insofern lernt das Gehirn des_der jugendlichen Konsument_in schneller die positive Wirkung und möchte dieses Gefühl wieder herbeiführen, weshalb dann erneut Cannabis konsumiert wird. Dieser Mechanismus lässt sich aber nicht unbegrenzt wiederholen und bleibt nicht ohne Folgen, wie im Verlauf des Buches noch deutlich werden wird.
Die Verbreitung des Cannabiskonsums verzeichnet in den letzten Jahrzehnten große Schwankungen. Während bis vor der Jahrtausendwende maximal ein Viertel der 18- bis 25-Jährigen schon mal Cannabis konsumiert hat, sind es 20 Jahre später nach Angaben der BZgA fast doppelt so viele. Gesellschaftliche Diskussionen und politische Debatten beispielsweise um die Legalisierung oder den Einsatz von Cannabis als Heilpflanze werden auch von Jugendlichen wahrgenommen und z. B. in Präventionsveranstaltungen heiß diskutiert. Beliebte Annahmen wie »Cannabis ist gesünder als Alkohol« oder auch »Cannabis macht nicht abhängig« halten sich hartnäckig und müssen immer wieder geschickt hinterfragt bzw. widerlegt werden. Eine kurze Antwort wäre beispielsweise »Am gesündesten ist es, den Konsum von Cannabis und Alkohol zu unterlassen« oder »Cannabis macht psychisch abhängig«. Gleichwohl ist das »Gesetz zur Verwendung von Cannabis als Medizin« für viele schwererkrankte Menschen ein großer Gewinn und verspricht z. B. bei Multipler Sklerose, Krebs, Epilepsien, Morbus Parkinson oder auch ADHS Linderung. Gesellschaftlich betrachtet wäre eine klare Haltung zum Umgang mit Cannabis für Jugendliche eine wichtige Orientierung. Auch für Eltern wäre eine zentrale Botschaft für den Erziehungsalltag relevant. Allerdings werden ohne gesetzliche Veränderungen im Bereich Cannabis voraussichtlich Ideologiedebatten kein Ende finden, weshalb Eltern nur durch ihr eigenes Vorbildverhalten bezüglich des bewussten Umgangs mit Konsummitteln von Anfang an positiven Einfluss auf die Entwicklung ihrer Kinder nehmen können, wie es in Kapitel 3 ausgeführt werden wird (  Kap. 3).
Kap. 3).
1.5 Umgang mit illegalen Drogen
In großen Teilen der deutschen Gesellschaft werden Menschen, die illegale Drogen konsumieren, verachtet, ausgegrenzt und stigmatisiert. Häufig wird angenommen, dass der Konsum Ausdruck einer schwachen Persönlichkeit sei und in die Kriminalität führe. Letzteres ist insofern zutreffend, als es in jedem Fall eine illegale Handlung ist und gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) verstößt. Inwieweit es zutrifft, dass der Gebrauch illegaler Drogen mit einer schwachen Persönlichkeit zusammenhängen könnte, ist wesentlich komplexer zu beantworten und wird im Rahmen der Identitätsbildung aufgegriffen. Festzuhalten bleibt, dass der gesellschaftliche Umgang mit einer Droge im kulturellen Kontext zu betrachten ist. Während in Deutschland Cannabis illegal und Alkohol legal ist, trifft dies auf andere Länder so nicht zu. Das bedeutet, eine Droge ist nicht automatisch illegal, sondern wird in Deutschland durch die Aufnahme in die Liste des BtMG so eingeordnet. Genau genommen wird der Begriff der Droge mit einer bestimmten Bedeutung verbunden, die mit der Erwartung einer Wirkung verknüpft ist. In Bezug auf die Wirkungsweisen werden illegale Drogen in drei Gruppen unterteilt: Sedativa, Halluzinogene und Stimulanzien. Während Sedativa als dämpfende und beruhigende Mittel bekannt sind, bewirken Stimulanzien eher das Gegenteil, indem sie eine anregende Wirkung erzielen. Halluzinogene beeinflussen die Sinneswahrnehmung, das Denken und Fühlen. Sie werden auch als Psychedelika bezeichnet und verändern die Sinneseindrücke. Am bekanntesten ist Cannabis.
In der Regel erwartet jede_r Konsument_in von illegalen Drogen eine positive Wirkung im Sinne der Verbesserung der Stimmung, des Wunsches nach Entspannung, der Stimulierung und Intensivierung des Erlebens oder des Abbaus von Hemmungen, Ängsten und Schmerzen. Die positiv wahrgenommene Veränderung des psychischen Erlebens wird dadurch erzeugt, dass mit der Drogenwirkung im Gehirn gezielt in den biochemischen Übertragungsprozess der Impulse von einer Nervenzelle zur anderen eingegriffen wird. An den Verknüpfungspunkten, den sogenannten Synapsen, werden durch elektrische Impulse Botenstoffe freigesetzt, die an den Rezeptoren anderer Nervenzellen andocken und so die Informationen weitergeben. Durch das Andocken von psychoaktiven Substanzen an die Rezeptoren wird die eigene Kontrolle der Nervenzellen über die angemessene Menge an Botenstoffen, auch Neurotransmitter genannt, gestört. So wird den Nervenzellen vorgespielt, dass eine gewisse Transmittersubstanz genug bzw. nicht genug vorhanden sei. Dadurch wird die natürliche Wirkung der körpereigenen Botenstoffe verstärkt bzw. ersetzt, bis der Körper die konsumierte Substanz wieder abgebaut hat. Dass dieser Eingriff in die körpereigenen Prozesse nicht ohne gesundheitliche Gefährdungen verläuft, ist hinreichend bekannt und führt zur Frage nach den Ursachen des Konsums, die sich bei Frauen und Männern oft unterscheiden. Während Männer durch den Konsum illegaler Drogen insbesondere Stärke, Macht und eine Unverletzlichkeit demonstrieren wollen, um in ihrer Peergroup eine Statusverbesserung zu erzielen, versuchen Frauen eine Form von Unabhängigkeit, Coolness und Selbstbewusstsein auszudrücken. Bei beiden Geschlechtern stellt sich der Konsum als eine Möglichkeit von Identitätsfindung und Persönlichkeitsentwicklung dar, die bei längerfristiger Anwendung Gesundheitsschäden bewirkt und eine Suchtgefahr beinhaltet.
In Deutschland ist die Konsumprävalenz – das ist, einfach formuliert, die Konsumhäufigkeit – jeder illegalen Droge bei Männern deutlich höher als bei Frauen. Nach dem Epidemiologischen Suchtsurvey aus dem Jahr 2018 liegt der Anteil erwachsener Männer bei 4,9 % und erwachsener Frauen bei 2,6 % (Piontek et al., 2018, S. 4ff.). Bei den Jugendlichen stehen die Zahlen in der gleichen Relation, während die 12-Monats-Prävalenz im Alter von 18 bis 24 Jahren am höchsten ist. Hochrechnungen zufolge liegt die Lebenszeitprävalenz von Erwachsenen bei ca. 32 %, d. h., ca. ein Drittel aller Erwachsenen hat irgendwann einmal in ihrem Leben eine illegale Droge konsumiert. Doch ein einmaliger Gebrauch illegaler Drogen wird nicht zu einem gesamtgesellschaftlichen Problem. Das Spannungsfeld des Umgangs mit dem Thema Drogen ergibt sich aus der Betrachtung problematischen Konsums illegaler Substanzen mit bio-psycho-sozialen Folgen der Konsument_innen und ihres Umfeldes. Mit dem bio-psycho-sozialen Ansatz lässt sich erklären, wie eine Sucht entsteht. Das multifaktorielle Bedingungsgefüge bezieht die drei großen Faktoren Droge, Individuum und Gesellschaft ein, die in einer Wechselwirkung zueinanderstehen und auf eine dynamische Entwicklung des Prozesses hinweisen. Ein Störungsbild im Sinne eines problematischen Substanzkonsums entsteht dann, wenn die Wechselwirkung der biologischen, sozialen und psychologischen Wirkfaktoren nicht zum Gleichgewicht für die Person führen, sondern sie durch eine Überlagerung von Problemen beeinträchtigen. Hervorzuheben ist, dass die Gesellschaft diesbezüglich einen großen Anteil hat und Einfluss darauf nimmt, wie jede_r Einzelne mit Drogen umgeht. Selbstverständlich liegt ein erheblicher Teil bei der Person selbst, wie gesundheitsbewusst oder risikoreich sie konsumiert. Ebenso wichtig ist die individuelle Wirkung der Droge auf die Person im biologischen wie im psychischen Bereich, die sich bei allen Menschen unterscheidet. Von der Droge an sich geht keine Gefährlichkeit aus, solange sie nicht eingenommen wird. Und Letzteres wird maßgeblich von dem Sozialisationsprozess der Person beeinflusst.
Читать дальше
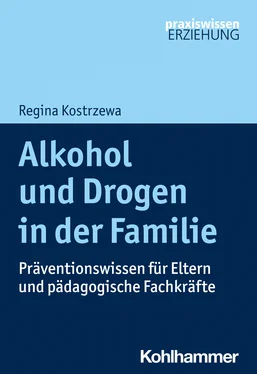
 Kap. 3).
Kap. 3).