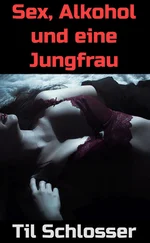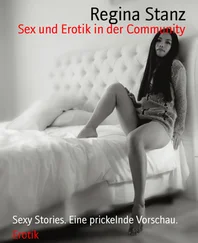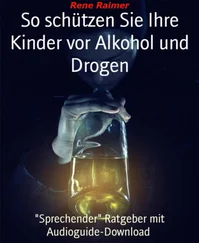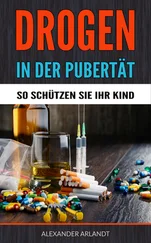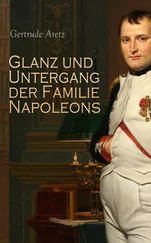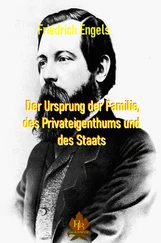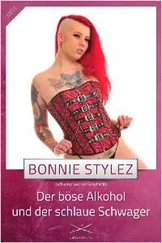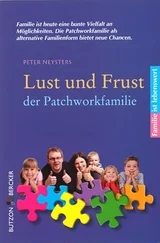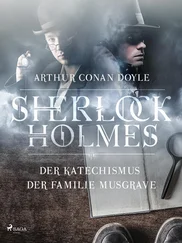bei Krankheit bzw. bei Einnahme von Medikamenten,
bei Krankheit bzw. bei Einnahme von Medikamenten,
 bei Konfliktgesprächen in der Partner- bzw. Freundschaft,
bei Konfliktgesprächen in der Partner- bzw. Freundschaft,
 während der Schwangerschaft.
während der Schwangerschaft.
Es ist immer wieder überraschend, dass werdende Mütter überhaupt noch Alkohol trinken, obwohl die Risiken für das ungeborene Kind seit Jahrzehnten bekannt sind. Die Gefahr, dass ein Embryo gravierende Entwicklungsstörungen davonträgt, ist sehr hoch und zeigt sich im verzögerten Wachstum, kleinem Kopf, geringerem Geburtsgewicht, verringerten motorischen und geistigen Entwicklungen, Herzfehlern oder später auftretenden Verhaltensstörungen wie auch Epilepsie. Das fötale Alkoholsyndrom (FAS) wird auch als pränataler Minderwuchs bezeichnet und kann sich vom ersten Moment der Befruchtung anfangen auszubilden. D. h. Frauen, die gerne schwanger werden möchten, sollten ab dem Zeitpunkt der aktiven Entscheidung für eine Schwangerschaft auf den Alkohol verzichten. Dabei sollten Frauen, die gewohnt sind, regelmäßig viel zu trinken, versuchen einen ausschleichenden Prozess des Alkoholverzichts zu wählen und sich etwas Zeit lassen, bevor sie mit dem Schwanger-Werden starten.
Bruce Lipton ruft zu einer »bewussten Elternschaft« auf, die sogar schon vor der Befruchtung beginnt. Elternsein ist also von Beginn an mit einer hohen Verantwortung verbunden, bei der die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eine große Unterstützung bieten können. Inwieweit die deutsche Politik hier ihren Beitrag leistet, bleibt fraglich. Denn betrachtet man die Vorgabe nach dem von der WHO gesetzten Ziel zur Senkung des Alkoholkonsums um 10 % bis 2025, zeigt es sich als unwahrscheinlich, dass Deutschland das Ziel erreicht. Dabei ist längst bekannt, was die Politik tun könnte. Nach der WHO gelten Steuererhöhungen, Werbeverbote und restriktive Verkaufshürden als wirksame Maßnahmen. Aber mit Forderungen nach strengeren Regeln macht man sich nicht beliebt und die Wirtschaftsinteressen der Alkoholindustrie stehen dem auch entgegen, die ja mit entsprechender Lobby politischen Einfluss nimmt. Nach einer Analyse des Fachmagazins Lancet werden die Vorgaben der WHO beispielsweise von den osteuropäischen Ländern besser umgesetzt. Sie konnten den Alkoholkonsum so deutlich reduzieren. Anders in Deutschland! Nach dem Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung im Jahr 2019 trinkt jeder sechste Erwachsene zu viel, weshalb der Satz des Suchtforschers Heino Stöver »Wir als Gesellschaft haben eine Alkoholstörung« treffend formuliert ist.
Seit Jahrhunderten wird in unserer Gesellschaft Tabak geraucht, obwohl die gesundheitlichen Schädigungen bekannt sind. Die meisten Menschen erleben beim Erstkonsum einer Zigarette sogar häufig unangenehme Körperreaktionen wie Husten, Übelkeit oder Schwindelgefühl. Da stellt sich natürlicherweise die Frage, weshalb trotzdem geraucht wird. Hier gibt es unterschiedlichste Erklärungsmodelle: von genetischen Prädispositionen, die den Einstieg und das Aufrechterhalten des Rauchens begünstigen, über das Lernen am Modell, bei dem rauchende Eltern oder andere Erwachsene als Modell die angenehme Wirkung des Rauchens vorleben, bis hin zum sozialen Lernen, bei dem schon Kleinkinder das Rauchverhalten imitieren und zigarettenähnliche Gegenstände in den Mund nehmen.
Studien belegen, dass Kinder von rauchenden Eltern häufiger selbst zu Raucher_innen werden, dieser Einfluss wird insbesondere in Kapitel 3.2 genauer beleuchtet (  Kap. 3.2). Über diesen elterlichen Einfluss hinaus ist auch der Zusammenhang zwischen Tabakkonsum in Kinofilmen und der Initiierung des Rauchens von Jugendlichen nachgewiesen (Morgenstern et al., 2011). Je häufiger die Jugendlichen Tabakrauchereignisse sehen, desto höher ist der Experimentierkonsum. Zielführende Tabakprävention setzt demzufolge auf eine Denormalisierung des Rauchens, indem eine Beeinflussung sozialer Normen erfolgt, die das Rauchen als nicht mehr gesellschaftsfähig darstellen. Die seit 2007 eingeführten Nichtraucherschutzgesetze haben diesbezüglich einen großen Anteil am Imagewandel von Tabakrauchen bewirkt. Die Konsumverbote in öffentlichen Gebäuden und Verkehrsmitteln sowie in Schulen, Krankenhäusern und gastronomischen Betrieben reduzieren die Berührungspunkte mit dem Rauchen und sie senken die Toleranz, sich dem Passivrauchen auszusetzen. Auch das Inkrafttreten des Tabakverbots in Printmedien und im Internet sowie in Rundfunk und Fernsehen reduzieren den Tabakkonsum in der Bevölkerung. Diese und andere Maßnahmen der Tabakkontrollpolitik konnten der KiGGs-Studie zufolge die Rauchquote bei den 11- bis 17-jährigen Jugendlichen bis zum Jahr 2012 von rund 20 % auf 12 % senken. Entsprechend der Drogenaffinitätsstudie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) rauchten im Jahr 2015 nur 8 % der 12- bis 17-jährigen Jugendlichen. Allerdings zeigt eine altersdifferenzierte Betrachtung, dass der rückläufige Trend beim Rauchen insbesondere bei den jungen Erwachsenen zutrifft, im mittleren und höheren Lebensalter ist dies nicht so ausgeprägt. So bleibt abzuwarten, wie sich der Umgang mit Tabak allgemeingesellschaftlich weiterentwickeln wird, denn die Tabakindustrie hat ja eine Reihe neuerer Produkte auf dem Markt eingeführt wie z. B. E-Zigarette und E-Shisha. Entsprechend der Studie der BZgA haben 12 % der 12- bis 17-jährigen Jugendlichen im Jahr 2015 schon mal eine E-Zigarette geraucht, bei den 18- bis 25-Jährigen sogar schon 21 %. Die E-Shishas sind bei Jugendlichen noch mehr im Trend, das haben 14 % der 12- bis 17-Jährigen schon einmal probiert. Diese Bewegung könnte eine Renormalisierung des Rauchens in der Bevölkerung nach sich ziehen, weshalb spezifische Präventionsstrategien entwickelt werden sollten.
Kap. 3.2). Über diesen elterlichen Einfluss hinaus ist auch der Zusammenhang zwischen Tabakkonsum in Kinofilmen und der Initiierung des Rauchens von Jugendlichen nachgewiesen (Morgenstern et al., 2011). Je häufiger die Jugendlichen Tabakrauchereignisse sehen, desto höher ist der Experimentierkonsum. Zielführende Tabakprävention setzt demzufolge auf eine Denormalisierung des Rauchens, indem eine Beeinflussung sozialer Normen erfolgt, die das Rauchen als nicht mehr gesellschaftsfähig darstellen. Die seit 2007 eingeführten Nichtraucherschutzgesetze haben diesbezüglich einen großen Anteil am Imagewandel von Tabakrauchen bewirkt. Die Konsumverbote in öffentlichen Gebäuden und Verkehrsmitteln sowie in Schulen, Krankenhäusern und gastronomischen Betrieben reduzieren die Berührungspunkte mit dem Rauchen und sie senken die Toleranz, sich dem Passivrauchen auszusetzen. Auch das Inkrafttreten des Tabakverbots in Printmedien und im Internet sowie in Rundfunk und Fernsehen reduzieren den Tabakkonsum in der Bevölkerung. Diese und andere Maßnahmen der Tabakkontrollpolitik konnten der KiGGs-Studie zufolge die Rauchquote bei den 11- bis 17-jährigen Jugendlichen bis zum Jahr 2012 von rund 20 % auf 12 % senken. Entsprechend der Drogenaffinitätsstudie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) rauchten im Jahr 2015 nur 8 % der 12- bis 17-jährigen Jugendlichen. Allerdings zeigt eine altersdifferenzierte Betrachtung, dass der rückläufige Trend beim Rauchen insbesondere bei den jungen Erwachsenen zutrifft, im mittleren und höheren Lebensalter ist dies nicht so ausgeprägt. So bleibt abzuwarten, wie sich der Umgang mit Tabak allgemeingesellschaftlich weiterentwickeln wird, denn die Tabakindustrie hat ja eine Reihe neuerer Produkte auf dem Markt eingeführt wie z. B. E-Zigarette und E-Shisha. Entsprechend der Studie der BZgA haben 12 % der 12- bis 17-jährigen Jugendlichen im Jahr 2015 schon mal eine E-Zigarette geraucht, bei den 18- bis 25-Jährigen sogar schon 21 %. Die E-Shishas sind bei Jugendlichen noch mehr im Trend, das haben 14 % der 12- bis 17-Jährigen schon einmal probiert. Diese Bewegung könnte eine Renormalisierung des Rauchens in der Bevölkerung nach sich ziehen, weshalb spezifische Präventionsstrategien entwickelt werden sollten.



Denn E-Zigaretten und E-Shishas werden als Lifestyle-Produkte und gesunde Alternative zum Tabakrauchen beworben, und die aromatischen Liquids mit den trendigen Geschmacksrichtungen könnten insbesondere für Kinder und Jugendliche attraktiv sein. Zwar wurde der Verkauf von elektronischen Inhalationsprodukten an Minderjährige 2016 verboten, aber Eltern sollten hier sehr aufmerksam sein und nicht dem Irrglauben verfallen, wenn die Liquids kein Nikotin enthalten, könnten sie ja keinen negativen Einfluss nehmen. Gerade die E-Shisha kann zum gemeinsamen Rauchen verführen und in der Peergroup einen erheblichen sozialen Druck auslösen, weshalb sich Jugendliche dann zum Rauchen verleiten lassen, um in der Gruppe anerkannt zu werden.
In dieser frühen Phase besteht die Funktion des Rauchens in der Unterstützung bei der Identitätsfindung und Zugehörigkeit. Damit kann auch eine Abgrenzung gegenüber anderen Peergroups oder den Erwachsenen erfolgen, um sich z. B. ein eigenes Gruppenimage zu geben. Die Raucherquote in der Peergroup beeinflusst das Rauchverhalten der einzelnen Gruppenmitglieder genauso wie der elterliche Einfluss. Studien belegen, dass Kinder rauchender Eltern weit häufiger selbst mit dem Rauchen beginnen als Kinder aus Nichtraucherelternhäusern. Welche Möglichkeiten rauchende Eltern haben, trotzdem positiven Einfluss zu nehmen, wird in Kapitel 3.2 aufgegriffen (  Kap. 3.2). Denn Tabak wird als eigentliche Einstiegsdroge in den Konsum psychotroper Substanzen angesehen, d. h. rauchende Jugendliche konsumieren auch eher Alkohol oder Cannabis, weshalb es umso wichtiger ist, möglichst zum Nichtrauchen zu erziehen (DHS, 2013, S. 57).
Kap. 3.2). Denn Tabak wird als eigentliche Einstiegsdroge in den Konsum psychotroper Substanzen angesehen, d. h. rauchende Jugendliche konsumieren auch eher Alkohol oder Cannabis, weshalb es umso wichtiger ist, möglichst zum Nichtrauchen zu erziehen (DHS, 2013, S. 57).
Читать дальше
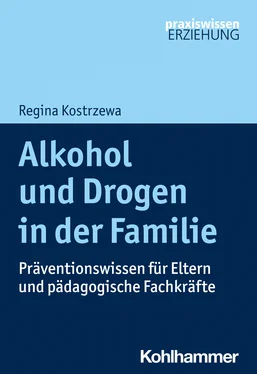
 bei Krankheit bzw. bei Einnahme von Medikamenten,
bei Krankheit bzw. bei Einnahme von Medikamenten, Kap. 3.2). Über diesen elterlichen Einfluss hinaus ist auch der Zusammenhang zwischen Tabakkonsum in Kinofilmen und der Initiierung des Rauchens von Jugendlichen nachgewiesen (Morgenstern et al., 2011). Je häufiger die Jugendlichen Tabakrauchereignisse sehen, desto höher ist der Experimentierkonsum. Zielführende Tabakprävention setzt demzufolge auf eine Denormalisierung des Rauchens, indem eine Beeinflussung sozialer Normen erfolgt, die das Rauchen als nicht mehr gesellschaftsfähig darstellen. Die seit 2007 eingeführten Nichtraucherschutzgesetze haben diesbezüglich einen großen Anteil am Imagewandel von Tabakrauchen bewirkt. Die Konsumverbote in öffentlichen Gebäuden und Verkehrsmitteln sowie in Schulen, Krankenhäusern und gastronomischen Betrieben reduzieren die Berührungspunkte mit dem Rauchen und sie senken die Toleranz, sich dem Passivrauchen auszusetzen. Auch das Inkrafttreten des Tabakverbots in Printmedien und im Internet sowie in Rundfunk und Fernsehen reduzieren den Tabakkonsum in der Bevölkerung. Diese und andere Maßnahmen der Tabakkontrollpolitik konnten der KiGGs-Studie zufolge die Rauchquote bei den 11- bis 17-jährigen Jugendlichen bis zum Jahr 2012 von rund 20 % auf 12 % senken. Entsprechend der Drogenaffinitätsstudie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) rauchten im Jahr 2015 nur 8 % der 12- bis 17-jährigen Jugendlichen. Allerdings zeigt eine altersdifferenzierte Betrachtung, dass der rückläufige Trend beim Rauchen insbesondere bei den jungen Erwachsenen zutrifft, im mittleren und höheren Lebensalter ist dies nicht so ausgeprägt. So bleibt abzuwarten, wie sich der Umgang mit Tabak allgemeingesellschaftlich weiterentwickeln wird, denn die Tabakindustrie hat ja eine Reihe neuerer Produkte auf dem Markt eingeführt wie z. B. E-Zigarette und E-Shisha. Entsprechend der Studie der BZgA haben 12 % der 12- bis 17-jährigen Jugendlichen im Jahr 2015 schon mal eine E-Zigarette geraucht, bei den 18- bis 25-Jährigen sogar schon 21 %. Die E-Shishas sind bei Jugendlichen noch mehr im Trend, das haben 14 % der 12- bis 17-Jährigen schon einmal probiert. Diese Bewegung könnte eine Renormalisierung des Rauchens in der Bevölkerung nach sich ziehen, weshalb spezifische Präventionsstrategien entwickelt werden sollten.
Kap. 3.2). Über diesen elterlichen Einfluss hinaus ist auch der Zusammenhang zwischen Tabakkonsum in Kinofilmen und der Initiierung des Rauchens von Jugendlichen nachgewiesen (Morgenstern et al., 2011). Je häufiger die Jugendlichen Tabakrauchereignisse sehen, desto höher ist der Experimentierkonsum. Zielführende Tabakprävention setzt demzufolge auf eine Denormalisierung des Rauchens, indem eine Beeinflussung sozialer Normen erfolgt, die das Rauchen als nicht mehr gesellschaftsfähig darstellen. Die seit 2007 eingeführten Nichtraucherschutzgesetze haben diesbezüglich einen großen Anteil am Imagewandel von Tabakrauchen bewirkt. Die Konsumverbote in öffentlichen Gebäuden und Verkehrsmitteln sowie in Schulen, Krankenhäusern und gastronomischen Betrieben reduzieren die Berührungspunkte mit dem Rauchen und sie senken die Toleranz, sich dem Passivrauchen auszusetzen. Auch das Inkrafttreten des Tabakverbots in Printmedien und im Internet sowie in Rundfunk und Fernsehen reduzieren den Tabakkonsum in der Bevölkerung. Diese und andere Maßnahmen der Tabakkontrollpolitik konnten der KiGGs-Studie zufolge die Rauchquote bei den 11- bis 17-jährigen Jugendlichen bis zum Jahr 2012 von rund 20 % auf 12 % senken. Entsprechend der Drogenaffinitätsstudie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) rauchten im Jahr 2015 nur 8 % der 12- bis 17-jährigen Jugendlichen. Allerdings zeigt eine altersdifferenzierte Betrachtung, dass der rückläufige Trend beim Rauchen insbesondere bei den jungen Erwachsenen zutrifft, im mittleren und höheren Lebensalter ist dies nicht so ausgeprägt. So bleibt abzuwarten, wie sich der Umgang mit Tabak allgemeingesellschaftlich weiterentwickeln wird, denn die Tabakindustrie hat ja eine Reihe neuerer Produkte auf dem Markt eingeführt wie z. B. E-Zigarette und E-Shisha. Entsprechend der Studie der BZgA haben 12 % der 12- bis 17-jährigen Jugendlichen im Jahr 2015 schon mal eine E-Zigarette geraucht, bei den 18- bis 25-Jährigen sogar schon 21 %. Die E-Shishas sind bei Jugendlichen noch mehr im Trend, das haben 14 % der 12- bis 17-Jährigen schon einmal probiert. Diese Bewegung könnte eine Renormalisierung des Rauchens in der Bevölkerung nach sich ziehen, weshalb spezifische Präventionsstrategien entwickelt werden sollten.