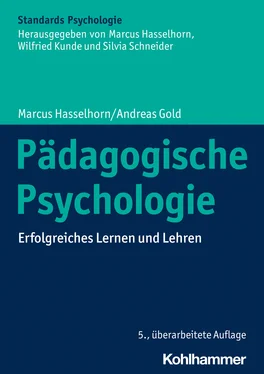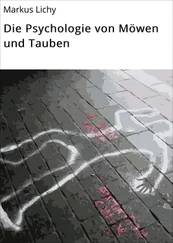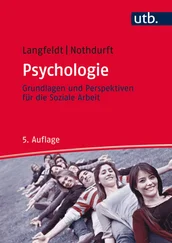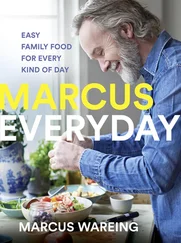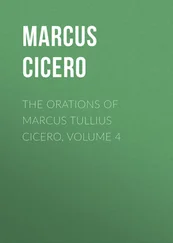Womit beschäftigt sich die Pädagogische Psychologie?
Jahrgang 1, Heft 1, Seite 1 der Zeitschrift für Pädagogische Psychologie beginnt unter der Überschrift »Fragen und Aufgaben der pädagogischen Psychologie« mit dem Abdruck der Schriftfassung eines Vortrags des Berliner Oberlehrers Ferdinand Kemsies (Kemsies, 1899). Die Hauptaufgabe sieht Kemsies in der naturwissenschaftlichen Erforschung der »ursächlichen Beziehungen« der »psychologischen Erscheinungen« im erzieherischen Feld; genauer: der Auswirkungen der »erzieherischen Einwirkung« auf die kindliche Psyche. Wichtige Fragestellungen der Pädagogischen Psychologie seien die mit schul- und unterrichtsorganisatorischen Entscheidungen verbundenen, aber auch bildungsinhaltliche und allgemein-didaktische Themen. Wichtig sei auch, dass die entwicklungs- und differentialpsychologischen Lernvoraussetzungen der Kinder erforscht würden.
Genau an diesen Fragestellungen wird auch mehr als 100 Jahre später noch gearbeitet. Reynolds und Miller (2003) nennen fünf große Inhaltsbereiche pädagogisch-psychologischer Forschung:
• Lernen, Lehren und Entwicklung
• Soziokulturelle und interpersonale Prozesse und Bedingungen des Lernens
• Interindividuelle Unterschiede zwischen den Lernenden
• Lernen und Lehren in spezifischen Inhaltsbereichen
• Lehrerbildung und Bildungsplanung
Die ersten vier betreffen die Pädagogische Psychologie in ihrer erkenntnissuchenden Funktion als theoretische Wissenschaft. Der fünfte Inhaltsbereich signalisiert darüber hinaus den Anspruch, wissenschaftliche Erkenntnisse als rationale Entscheidungshilfen für curriculare und organisatorische Weichenstellungen verfügbar zu machen. Seidel, Prenzel und Krapp (2014) sprechen diesbezüglich von einer »praktischen«, Walberg und Haertel (1992) von einer »bildungspolitischen« Aufgabe der Pädagogischen Psychologie.
Alle wissenschaftlichen Fragestellungen der Pädagogischen Psychologie lassen sich thematisch den oben genannten großen Inhaltsbereichen zuordnen. Mit Blick auf ihre Hauptaufgaben ist es aber hilfreich, zwischen zwei Arten von wissenschaftlichen Ansprüchen zu unterscheiden: der Generierung von Grundlagenwissen und der Bereitstellung von Anwendungswissen. Der eine Anspruch – die Herstellung von Grundlagenwissen – ist bereits mehrfach formuliert worden: Pädagogische Psychologie als Theorie der erzieherischen und schulischen Praxis, als Erforschung des Praxisfeldes Erziehung und Unterricht und als Forschung über Lernen und Lehren mit den Methoden der empirischen Psychologie. Der zweite Anspruch – die Gewinnung handlungsrelevanten und praxistauglichen Wissens – definiert die Pädagogische Psychologie zusätzlich als Gestaltungs-, Optimierungs- oder Interventionswissenschaft (Levin et al., 2003; Seidel et al., 2014). Nichts ist nützlicher für die Praxis als eine gute Theorie. Die Pädagogische Psychologie erforscht theoriegeleitet und mit empirischer Methodik Phänomene der pädagogischen Praxis. Ihre Erkenntnisse lassen sich auf diese Praxis rückbeziehen. Inwieweit und unter welchen Bedingungen dies erfolgreich gelingt, ist seinerseits wiederum eine wissenschaftliche Fragestellung pädagogisch-psychologischer Forschung (Gräsel & Parchmann, 2004; Souvignier & Dignath van Ewijk, 2010). So verstanden ist Praxis – als Unterrichts- und Erziehungspraxis – ein Forschungsfeld einer anwendungsorientierten Pädagogischen Psychologie. Stokes (1997) hat ein solches Vorgehen als »Use-Inspired Basic Research« bezeichnet. Hartmann und Klieme (2017) machen darauf aufmerksam, dass die Wissenschaft dabei nicht einfach als Lieferant von Wissen und die pädagogische Praxis nicht nur als Wissensempfänger zu betrachten sei. Damit aus den Erkenntnissen empirischer Unterrichtsforschung evidenzbasierter Unterricht wird, braucht es einen Begegnungsraum des gleichberechtigten Austauschs zwischen Praxis und Forschung.
Inhaltsbereiche. Die Paradigmen und Begrifflichkeiten, unter denen zentrale Konzepte wie Lernen und Lehren, Entwicklung und Differenz oder Methode und Inhalt von Unterricht behandelt werden, haben sich immer wieder gewandelt. Einige Themenfelder wurden im Laufe der Zeit aufgegeben, andere kamen neu hinzu. Um einen Eindruck über die Forschungsaktivitäten der Pädagogischen Psychologie zu erhalten, bietet sich eine Inhaltsanalyse von Forschungsthemen in pädagogisch-psychologischen Fachzeitschriften an, wie sie beispielsweise von Hasselhorn (2000), Schiefele (2002), Brunstein und Spörer (2005), Leutner und Wirth (2007) sowie Möller, Retelsdorf und Südkamp (2010) für die Beiträge in der Zeitschrift für Pädagogische Psychologie (ZPP) durchgeführt worden ist.
Fokus: Themenschwerpunkte Zeitschrift für Pädagogische Psychologie (ZPP)
In einer Themenübersicht, die sich auf die Jahre 2008 bis 2010 bezieht, haben Möller, Retelsdorf und Südkamp (2010) die folgenden Themenschwerpunkte (in Klammern die Anzahl der Beiträge) identifiziert:
• Lehren und Lernen (22)
• Pädagogisch-psychologische Trainingsforschung (11)
• Selbstkonzept, Motivation und Emotion im Lernprozess (14)
• Entwicklung von Basiskompetenzen (7)
• Varia (6)
Brünken, Münzer und Spinath (2019) haben für ihr Lehrbuch weitere Jahrgänge gesichtet. Gemäß ihrer Schlagwortanalyse über die insgesamt 140 empirischen Originalarbeiten geht es am häufigsten um Schüler- und Lehrerkompetenzen, Unterricht, Motivation und Lernen. Auch in einschlägigen Hand- und Lehrbüchern sind »Lehren und Lernen« die zentralen Gliederungspunkte.
Mit einiger Verzögerung finden die Forschungsschwerpunkte ihren Niederschlag in Handbüchern sowie in enzyklopädischen Sammelbänden. In englischer Sprache ist der Wissenskanon der Pädagogischen Psychologie umfassend in der ersten, zweiten und dritten Auflage des Handbook of Educational Psychology (Berliner & Calfee, 1996; Alexander & Winne, 2006; Corno & Anderman, 2016) zusammengestellt sowie in der 5. Auflage des Handbook of Research on Teaching. Für die sich ändernden Auffassungen über Lehren und Lernen ist die Entwicklung der Themenauswahl in dem erstmals von Gage (1963), später von Travers (1973), von Wittrock (1986), von Richardson (2001) und schließlich in der 5. Auflage von Gitomer und Bell (2016) herausgegebenen Handbuch besonders illustrativ. Eine ausgezeichnete Bestandsaufnahme der Forschungsaktivitäten aus den letzten 20 Jahren findet sich darüber hinaus im Handbook of Research on Learning and Instruction (Mayer & Alexander, 2017). Als deutschsprachiges Pendant des amerikanischen Handbuchwissens konnten lange Zeit die vier Enzyklopädie-Bände zur Pädagogischen Psychologie gelten, die zwischen 1994 und 1997 erschienen sind – inzwischen bedürfen die dort dargestellten Sachstände einer Aktualisierung. Dies gilt mittlerweile auch für das Handbuch der Pädagogischen Psychologie (Schneider & Hasselhorn, 2008). Einen aktuellen Überblick zu den Inhaltsgebieten der Pädagogischen Psychologie erlaubt das von Rost, Sparfeldt und Buch (2018) in 5. Auflage herausgegebene Handwörterbuch Pädagogische Psychologie.
Lehrerbildung. Eine wichtige Aufgabe der Pädagogischen Psychologie besteht darin, das empirisch gewonnene Wissen an pädagogisch Handelnde weiterzugeben. Dabei kann zum Problem werden, dass die potenziellen Anwender dieses Wissens »fachfremde« Personen sind. Im Rahmen der Lehrerbildung an den Universitäten wird das fachliche Wissen der Pädagogischen Psychologie angehenden Lehrerinnen und Lehrern vermittelt. Schon Kemsies (1899) hatte das gefordert und eine Art Laborschule dazu – er nannte sie »Übungs- oder Musterschule« –, »um die Theorie sofort in die Praxis überzuführen und Lehramtskandidaten Gelegenheit zum Erwerb pädagogischer Kenntnisse und Fertigkeiten zu bieten« (S. 13). Wie viel Praxis allerdings in die universitäre Lehrerbildung gehört, wird durchaus kontrovers diskutiert. Denn in der Lehrerbildung an den Universitäten sollten nicht vordringlich Technologien des Lehrens eingeübt, sondern Theorien des Lehrens und Lernens vermittelt werden (Gage, 1964). Erst mit der Distanzierung von der unterrichtlichen Praxis schafft man den notwendigen Raum für ihre theoretische Analyse und ihre wissensgeleitete Veränderung. Eigenes praktisches Handeln wird stets subjektiv durchlebt – es kann in diesem Sinne nicht ohne weiteres zum Objekt einer notwendigen theoretischen Betrachtung werden. Allerdings muss das theoretische, distanzierte Wissen anschließend wieder praxistauglich gemacht werden.
Читать дальше