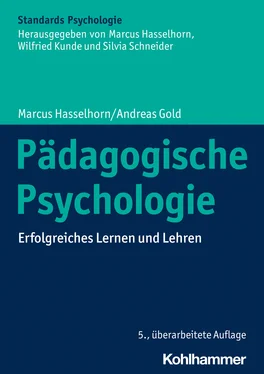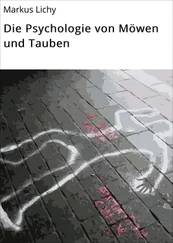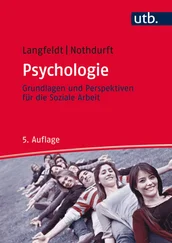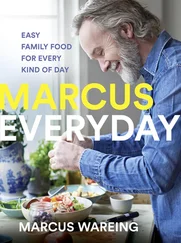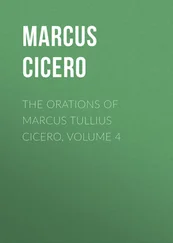Wer dieses Buch liest, hat bereits eigene pädagogisch-psychologische Erfahrungen gemacht, als handelnder Akteur in pädagogischen Situationen und als Adressat pädagogischer Maßnahmen. Unzählige Male sind Sie durch einen Lehrer oder durch eine Freundin, von den Eltern, durch ein Buch oder durch ein elektronisches Medium angeleitet oder unterrichtet worden, um etwas zu verstehen, zu behalten oder um eine Fertigkeit zu erwerben. Das Unterweisen hat entweder in der Schule oder im Elternhaus stattgefunden oder in anderen, alltäglichen und natürlichen Situationen. Zugleich haben Sie immer wieder die Seiten vom Lernen zum Lehren gewechselt, haben die Rolle des Lernenden mit der des Lehrenden getauscht, um selbst jemandem etwas in pädagogischer Absicht zu erklären, vorzuzeigen oder vorzumachen. Über das Lernen und Lehren – die beiden großen Themenbereiche der Pädagogischen Psychologie – wissen wir mithin alle aus eigener Anschauung bereits Bescheid. Es ist ein Ziel dieses Lehrbuchs, die aus eigener Erfahrung bereits vorhandenen Kenntnisse und Überzeugungen mit den Befunden und Erkenntnissen der wissenschaftlich betriebenen Pädagogischen Psychologie zu konfrontieren. Dies nicht, um die vorwissenschaftlichen Überzeugungen und das »pädagogische Brauchtum« schlicht zu widerlegen, indem kontraintuitive empirische Befunde präsentiert werden, sondern im Bestreben, die vorwissenschaftlichen Überzeugungen in geeigneter und auch notwendiger Weise zu präzisieren und zu modifizieren. Solcher Präzisierungen bedarf es schon deshalb, weil das sprichwörtliche Common-Sense-Wissen nicht selten widersprüchlich daherkommt, wie die beiden gegensätzlichen Redewendungen »Früh übt sich, … « und »Es ist nie zu spät …« illustrieren mögen. Was stimmt denn nun?
Die Widersprüchlichkeiten im Alltagswissen weisen darauf hin, dass sich Common-Sense-Überzeugungen eher auf die Haupteffekte von Variablen beziehen als auf ihre Wechselwirkungen. Dies stellt die wissenschaftliche Psychologie vor die wichtige Aufgabe, solche Widersprüche aufzulösen, indem sie zum einen die Bedingungen identifiziert, unter denen ein vorgeblicher Zusammenhang tatsächlich existiert und zum anderen diejenigen, unter denen der gegenteilige Effekt auftritt. (Kelley, 1992, S. 15) 1 1 Alle englischen Zitate sind von den Verfassern ins Deutsche übersetzt worden.
Wissenschaftlich überprüfen heißt, etwas in Frage stellen. Für eine anwendungsorientierte Disziplin wie die Pädagogische Psychologie, die nicht nur – wie die Psychologie insgesamt – mit dem allgemeinen Menschenverstand aller Beteiligten, dem sogenannten Großmutter-Wissen (Kelley, 1992), konkurriert, sondern zugleich mit dem tradierten pädagogischen Erfahrungswissen von Lehrerinnen und Erziehern, Belehrten und Erzogenen, ist die wissenschaftliche Dignität dieser Überprüfung von ganz entscheidender Bedeutung.
So gehört es zu den Zielen dieses Buches, auf die Notwendigkeit des Hinterfragens auch dann hinzuweisen, wenn einfache Antworten nicht zu erwarten sind. Kann man Lernen lernen? Was bewirkt Schule? Können Kinder auch ohne Lehrpersonen lernen? Kann man gleichzeitig Leistungsunterschiede zwischen den Lernenden verringern und dennoch alle an ihr Leistungsoptimum heranführen? Was spricht eigentlich dafür, Mädchen und Jungen gemeinsam zu unterrichten? Eignen sich Noten als Leistungsrückmeldungen an die Schülerinnen und Schüler? Wie können Erwachsene am besten lernen? Wie und wo sollen hochbegabte Kinder unterrichtet werden?
Solche und andere Fragen können neugierig machen auf Antworten, die die Pädagogische Psychologie anzubieten hat. Die meisten dieser Fragen beziehen sich auf Probleme der pädagogischen Praxis. Sie betreffen die Tätigkeit von Lehrerinnen und Erziehern und das administrative oder politische Handeln von Bildungsverantwortlichen. Den konkreten Praxisfragen vorgeordnet sind grundlegendere Fragen, die auf die psychologischen Prozesse zielen und auf die pädagogischen Möglichkeiten der Beeinflussung von Lehr-Lern-Prozessen. Diese Fragen lassen sich auf einen gemeinsamen Kern verdichten: Welches sind die Bedingungen erfolgreichen Lernens und Lehrens und wie kann man sie gezielt herbeiführen? Es geht also um das Lernen unter den Bedingungen des Lehrens – damit ist zugleich das Leitmotiv dieses Lehrbuchs benannt.
In diesem Lehrbuch wird eine thematische Abfolge und inhaltliche Verschränkung von »Lernen und Lehren« gewählt, der die Auffassung von Lernen als »erfolgreicher Informationsverarbeitung« zugrunde liegt. Und es wird eine Auffassung von Lehren vertreten, die unterschiedliche, aber nicht beliebige Vorgehensweisen zur Förderung solcher Lernprozesse zulässt. Den beiden thematischen Schwerpunkten sind die Hauptteile I (Lernen) und II (Lehren) des Buches gewidmet. Vorangestellt ist diese Einleitung.
• Was sind die Kerngebiete der Pädagogischen Psychologie?
• Ist die Pädagogische Psychologie eine theoretische oder eine praktische Wissenschaft?
• Wie ist das Verhältnis zur Pädagogik?
• Welches sind die wichtigsten Forschungsfelder?
Was ist Pädagogische Psychologie?
Je nach Temperament mag man die besondere Lage der Pädagogischen Psychologie zwischen den grundlagenwissenschaftlichen Ansprüchen auf der einen Seite und den Anwendungserfordernissen der erzieherischen und unterrichtlichen Praxis auf der anderen beklagen oder begrüßen. Oft wird diese »Zwischenlage« allerdings als besonders »spannend« oder als besonderes Privileg betrachtet: als Scharnierstelle zwischen dem theoretischen Wissen und der praktischen Anwendung dieses Wissens (Burden, 2000; Calfee & Berliner, 1996; Mayer, 1992; Reynolds & Miller, 2003). »Es ist nicht leicht, ein Pädagogischer Psychologe zu sein«, schreibt der US-Amerikaner Richard Mayer, einer der prominentesten Vertreter des Faches, und meint es aber nicht so:
Unsere Kollegen in der Psychologie diskreditieren uns als »zu pädagogisch« und meinen damit unser Interesse an pädagogisch relevanten Problemen, statt an künstlichen Laboruntersuchungen. Unsere Kollegen in der Pädagogik diskreditieren uns als »zu psychologisch« und meinen damit unser Bemühen, pädagogische Praxis auf wissenschaftlichen Forschungsmethoden und Theorien aufzubauen, statt auf populäre Überzeugungen und Lehrmeinungen zu vertrauen. Wir bringen Unruhe in die Psychologie, indem wir uns weigern, künstliche Laboruntersuchungen als Endpunkt psychologischer Forschung zu akzeptieren. Wir bringen Unruhe in die Pädagogik, indem wir uns weigern, gute Absichten, Expertenmeinungen und doktrinäre Forderungen als Begründungen für pädagogisches Handeln zu akzeptieren. Dennoch ist es gerade das Zusammentreffen dieser beiden Kritikpunkte, was das einzigartige Potenzial der Pädagogischen Psychologie ausmacht, sowohl die psychologische Theorie als auch die pädagogische Praxis gewinnbringend weiter zu entwickeln. (Mayer, 2001, S. 83)
Die Ansprüche und Fragen der pädagogischen Praxis bestimmen das Feld, auf dem pädagogisch-psychologische Forschung stattfindet. Sie markieren zugleich die hohen Erwartungen: Die Forschungsergebnisse sollen in der pädagogischen Praxis nutzbar sein! In der Pädagogischen Psychologie verbindet sich die pädagogische Praxis mit der wissenschaftlichen Psychologie, die eine wird zum Forschungsgegenstand der anderen. Die Pädagogische Psychologie lässt sich insoweit als »Theorie einer Praxis« (Ewert, 1979) bezeichnen. Franz Weinert charakterisierte sie prägnant als »theoretisch orientierte, empirisch betriebene und praktisch nutzbare Wissenschaft« (Weinert, 1996b, S. 98).
Diese Position war nicht unstrittig. Sie musste sich behaupten gegen Auffassungen, die in der Pädagogischen Psychologie vornehmlich eine Hilfswissenschaft für die Pädagogik sahen, eine auf die Erfordernisse von Erziehung und Unterricht Angewandte Psychologie der bloßen Erkenntnisübertragung, oder die ihr die Aufgabe zuwiesen, praktisch-technologische Handlungsregeln zu generieren (Ewert, 1979; Weinert, 1967).
Читать дальше