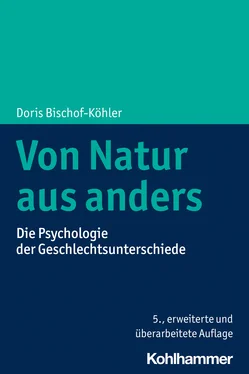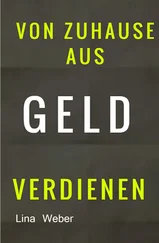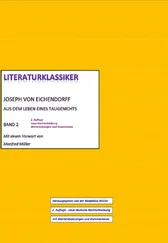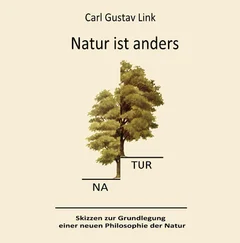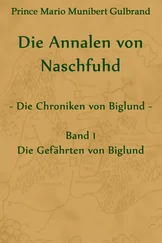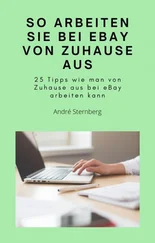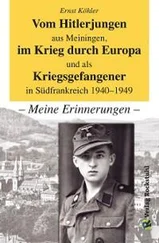1 ...6 7 8 10 11 12 ...34 Die Autoren kommen gleichwohl zum Schluss, dass geschlechtsneutrale Erziehung eine sinnvolle Maßnahme sei. Mit Blick auf die uneinheitlichen Ergebnisse fügen sie hinzu, dass diese wohl vornehmlich durch Einflüsse von außerhalb des Kindergartens begründet seien und es Aufgabe der Politik sei, auch dort für mehr Geschlechtsneutralität zu sorgen. Ähnlich wie bei der Studie zu den Kinderläden werden andere Erklärungsansätze nicht verfolgt.
2.4 Tausendjährige Sozialisation?
Die Frage ist nur, worin eine alternative Erklärung bestehen könnte. 1994 erscheint ein Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung, dessen Tenor recht nachdenklich klingt, was die Umsetzbarkeit erzieherischer Leitbilder betrifft. Der Autor Allan Guggenbühl, ein Psychologe, beklagt, dass aller Koedukation zum Trotz Jungen immer noch »unangepasster, wilder und störrischer« seien als ihre Altersgenossinnen. Eltern und Erzieher müssten daher zur Kenntnis nehmen, dass sich ihr Ideal von der Gleichbehandlung der Geschlechter nicht bewährt habe, weil sich auf diese Weise die Unterschiede offensichtlich nicht nivellieren ließen; es müssten also wohl geschlechtsdifferenzierende Maßnahmen erwogen werden. Jungen und Mädchen unterschiedlich behandeln, hieße aber faktisch, zu den Geschlechtsstereotypen zurückzukehren, was wiederum die Gefahr berge, einzelne Kinder auf diese Norm einzuengen, auch wenn sie ihrem Entwicklungspotential nicht entspräche. Eltern und Erzieher müssten sich aber trotz dieses Dilemmas der Herausforderung stellen.
So weit, so gut. Man ist schon dabei, die Zeitung abzulegen, da fällt der Blick noch eben auf einen letzten Satz, der alles wieder gründlich relativiert. Der entscheidende Gedanke darin ist kursiv hervorgehoben. Er lautet: »Das Verhalten der Knaben muss ein Thema sein, auch wenn es das Resultat tausendjähriger entsprechender Sozialisation sein mag« (Guggenbühl, 1994, S. 65).
Die Argumentation ist typisch für die Unerschütterlichkeit, mit der am Glauben an die Sozialisiertheit auch angesichts offensichtlich widersprechender Befunde festgehalten wird. Wenn gar nichts mehr hilft, greift man zu einer formelhaften Beschwörung der Geschichte. Jahrhunderte oder gar Jahrtausende von Tradition werden ins Feld geführt, Großeltern, Urgroßeltern, Generationen von Ahnen werden bemüht, die immer noch ihren Einfluss geltend machen sollen.
Nicht, dass die Verkrustung von gesellschaftlichen Strukturen und die Hartnäckigkeit, mit der sich Einstellungen über Generationen hinweg halten können, gering zu gewichten seien, aber man sollte sich doch zumindest einmal überlegen, was das konkret heißen würde. Schließlich haben wir als junge Leute gerade in der Erziehung unserer Kinder ganz bewusst so ziemlich alles anders gemacht als unsere Eltern. Sollten wir als Mitglieder einer Gesellschaft, die in Innovation, Veränderung und Fortschritt ihre primären Werte sieht und der Tradition immer weniger Raum gewährt, ausgerechnet im Bereich der Geschlechtsrollen sklavisch dem verhaftet sein, was unsere Großeltern wollten und deren Großeltern auch schon? Ist es wirklich glaubwürdig, dass deren Vorstellungen eine solch immense, schon geradezu magische Wirkkraft ausüben, dass sie die Absichten einer ganzen Erziehergeneration zunichtemachen können, wenn diese sich doch immerhin wenigstens rechtschaffen Mühe gibt, Jungen und Mädchen gleich zu behandeln?
Könnte es nicht sein, dass die Veränderung deshalb nicht funktioniert, weil wir sie falsch anpacken und weil wir dabei von realitätswidrigen Voraussetzungen ausgehen? Ganz in diese Richtung weist ja auch Guggenbühls Argumentation, wenn er nahelegt, die Geschlechtsstereotype müssten ernst genommen werden und man müsse vom Ideal der Gleichbehandlung wegkommen. Nur hatte er zum Zeitpunkt, als er den Artikel verfasste, für den möglichen Grund dieser Notwendigkeit einen blinden Fleck.
Lesern, die nicht so unverbrüchlich an die Macht der Sozialisation glauben, fällt nämlich als Erstes und Nächstliegendes ein, dass es vielleicht auch etwas mit dem Naturell der Jungen zu tun haben könnte, wenn sie sich als erziehungsresistent erweisen. Und genau in die gleiche Richtung würde man auch angesichts der Befunde aus den Kinderläden assoziieren. Solche Fantasien verletzen freilich die guten Sitten politischer Korrektheit, denn sie rühren an das Tabuthema der Veranlagung.
Warum aber ist es eigentlich nicht möglich, den Gedanken wenigstens einmal zur Diskussion zu stellen, in der oben von Guggenbühl angesprochenen geschlechtsspezifischen Herausforderung könnte sich auch so etwas wie Natur ausdrücken? Es muss ja vielleicht nicht zutreffen, aber erwägen sollte man es doch einmal dürfen – eine Überlegung, für die sich Guggenbühl übrigens mittlerweile in einer neueren Veröffentlichung durchaus offen zeigt (Guggenbühl, 2008).
2.5 Geschlecht als Morphologie
Die durchgängig beobachtbare Tendenz, angesichts von Geschlechtsunterschieden die Allmacht der Sozialisation zu beschwören und eine biologische Verursachung überhaupt gar nicht erst zu erwägen, lässt den Verdacht aufkommen, dass hinter dem, was oberflächlich als Desinteresse erscheint, tiefer gründende Berührungsängste lauern. Falls das zutrifft, müssen wir deren Ursachen genauer analysieren.
Dabei macht sich hinderlich bemerkbar, dass »Biologie« ein Reizwort ist, das, wenn es überhaupt thematisiert wird, selten eine sachliche Behandlung erfährt. Im Folgenden wollen wir zunächst Revue passieren lassen, was unter dieser Wortmarke alles verstanden bzw. missverstanden zu werden pflegt, um dann den Ursachen der eigentümlichen Aversion nachzugehen.
Recht weit verbreitet ist eine häufig von soziologischer und feministischer Seite vertretene Einstellung, die sich vordergründig als »aufgeklärt« charakterisieren ließe; sie wurde u. a. von Margaret Mead vertreten.»Biologie« wird hier praktisch synonym mit Anatomie verstanden, im Falle der Geschlechtlichkeit also konkret mit dem berühmten »kleinen Unterschied« der Fortpflanzungsorgane einschließlich der unmittelbar daran gebundenen Aktivitäten.
Selbstverständlich, sagen die Vertreter dieses Standpunktes, spielt diese »Biologie« eine Rolle. Als Wesen mit Selbstbewusstsein reflektieren wir die Tatsache unserer Geschlechtlichkeit und die unterschiedlichen Funktionen bei der Fortpflanzung. Daraus lassen sich geschlechtsspezifische Aufgaben ableiten, die eine Rollenteilung der traditionellen Form nahelegen, und das führt schließlich zu einem unterschiedlichen Selbstverständnis der Geschlechter. Dieses Erklärungsmuster ist kurz gefasst der Kern der sozialen Rollentheorie, die – auf Talcott Parsons zurückgehend – derzeit insbesondere von Alice Eagly vertreten wird (Eagly, 1987). Konkret stellt man sich das so vor, dass die Menschen wahrgenommen haben, wie Männer sich aufgrund ihrer physischen Ausstattung anders verhalten als Frauen, was sich in einer Arbeitsteilung manifestiert. Aus dieser Erfahrung wird abgeleitet, dass die Geschlechter sich auch psychologisch unterscheiden, und daraus entwickeln sich die Geschlechtsrollenvorstellungen und diesbezügliche Verhaltensanforderungen. Aufschlussreich für diesen theoretischen Ansatz ist es, dass die Rolle der Biologie auf den physischen Bereich beschränkt gesehen wird. Psychologische Unterschiede werden ausschließlich als soziales Phänomen gedeutet (Eagly & Wood, 2009). Dass in solchen Zuweisungen indessen zutreffende Einsichten zum Ausdruck kommen könnten, es sich also um mehr als nur um Unterstellungen handelt, die Möglichkeit der biologischen Evolution von psychologischen Verhaltensdispositionen wird nicht erwogen.
Der Biologie wird in dieser Konzeption also zwar eine gewisse Bedeutung zugebilligt, die sie für das menschliche Verhalten haben kann – dies aber nur, wenn es der Gesellschaft auch gefällt, dies überhaupt zur Kenntnis zu nehmen und zum Gegenstand der Interpretation zu machen. Aber natürlich bleibt es den Kulturen anheimgestellt, wie sie ihre Geschlechtsrollen bestimmen; diese sind also relativierbar, besonders heute, wo die Biologie »funktionslos« geworden ist, weil wir Mittel gefunden haben, ihren »Zwängen« zu entkommen.
Читать дальше