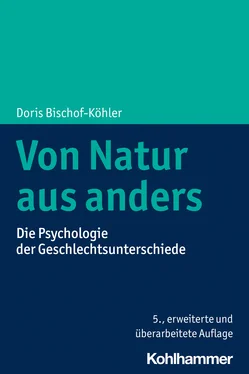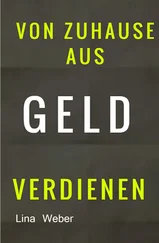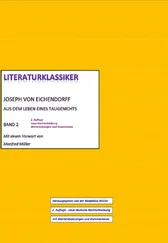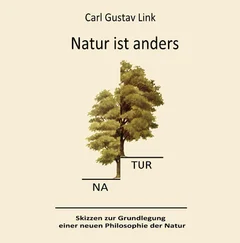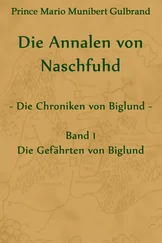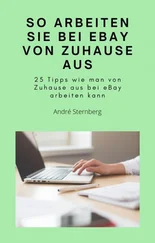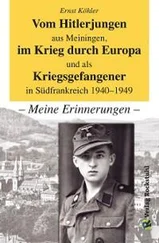1 ...7 8 9 11 12 13 ...34 Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass die Selbstdefinition mittels der Geschlechtsrollen nicht – wie aufgrund der sozialen Rollentheorie zu erwarten wäre – in Kulturen mit traditioneller Aufteilung am stärksten ausgeprägt ist, sondern in den eher egalitären Kulturen, bei denen sich die Geschlechter eigentlich mehr Angleichung erlauben könnten (Guimond, 2007; Lippa, 2010). Auch die Kinder im schwedischen geschlechtsneutralen Kindergarten zeigten tendenziell eine Fokussierung auf die Kategorie »Geschlecht«, wenn die Aufgabe hinreichend subtil war. Warum das so sein könnte, wird uns später noch eingehender beschäftigen: Der Befund weist indessen darauf hin, dass die Übernahme der Geschlechtsrolle nicht dann besonders pointiert vollzogen wird, wenn es eine besonders ausgeprägte Stereotypisierung eigentlich nahelegen würde.
2.6 Geschlecht als Inszenierung
Noch ein paar Schritte weiter geht der sogenannte »ethnomethodologische« Ansatz, eine besonders rigorose Spielart des Kulturrelativismus. Dieser billigt den einzelnen Kulturen nicht nur zu, die Geschlechtsrollen frei zuweisen zu können, sondern behauptet darüberhinaus, der Unterschied zwischen den Geschlechtern werde überhaupt nur dann wahrgenommen, wenn ihn eine Kultur entsprechend »inszeniere«; man spricht direkt von »doing gender«. »Geschlechtlichkeit« wird als etwas angesehen, das man sich aneignet, »und zwar als soziale Konstruktion«. Konsequentermaßen wird dann in der »Dekonstruktion« das geeignete Heilmittel gegen die Diskriminierung gesehen (Gildemeister, 1988, S. 497). Im Originalton klingt das etwa folgendermaßen (Günthner & Kotthoff, 1991, S. 8):
»Jede Interaktionssituation bietet die Gelegenheit, Geschlechterrollen zu perpetuieren, aber auch zu verändern, d. h. wir kreieren den Geschlechtsunterschied permanent durch Andersbehandlung der Geschlechter mit oder wir heben ihn durch Gleichbehandlung vorübergehend auf. Gesellschaftliche Strukturen, wie beispielsweise männliche Dominanz oder weibliche Unterlegenheit, sind also nicht einfach gegeben, sondern ein kultiviertes Konstrukt, das wir in Interaktionssituationen aktivieren können.«
Die Geschlechtlichkeit in ihren somatischen Aspekten wird als »sex« von »gender« unterschieden, um auch durch die Wortwahl klar zu machen, dass die Biologie nichts mit dem Verhalten zu tun hat. In einer Verlautbarung des Bundesfamilienministeriums wurde das im Jahre 2002 in folgendem Wortlaut festgeschrieben: »Gender bezeichnet die gesellschaftlich, sozial und kulturell geprägten Geschlechtsrollen von Männern und Frauen. Diese sind – anders als das biologische Geschlecht (also sex) – erlernt und damit veränderbar« (Bundesfamilienministerium, 2002). Nur »gender« als erlernte und von der Kultur übernommene Geschlechtsrolle ist von Interesse. »Sex« dagegen kann zwar kulturell thematisiert werden, zwingend ist dies aber nicht; prinzipiell wäre man auch frei, die somatischen Unterschiede zu ignorieren.
Manche Autorinnen gehen so weit zu behaupten, die Morphologie böte sowieso keine hinreichend eindeutige Basis für die Einteilung in Mann und Frau. Die Geschlechtszuordnung sei vielmehr rein willkürlich. So argumentiert etwa Fausto-Sterling, jemanden als männlich oder weiblich zu bezeichnen, sei eine rein »soziale Entscheidung«; sie beruft sich dabei auf Fälle von Hermaphroditen und anderen anatomischen Uneindeutigkeiten (Fausto-Sterling, 2000). Auch Muldoon und Reilly bezweifeln, dass es eine ausreichende biologische Grundlage dafür gäbe, »männlich« und »weiblich« als dichotome, sich gegenseitig ausschließende Kategorien zu bestimmen (Muldoon & Reilly, 1998). In ihrer radikalsten Form wurde diese Annahme von Judith Butler formuliert, bei der nicht nur die Geschlechtsidentität, sondern auch die körperliche Geschlechtlichkeit keine festgelegten Größen sind, sondern ständig nach Maßgabe bestimmter Normen im Handeln neu hervorgebracht werden (Butler, 1991). Diese Radikalität ist allerdings auch von feministischer Seite mit dem Argument in die Kritik geraten, wenn Geschlecht sich nur in individuellen Interaktionen und Interpretationen manifestiere, verflüchtige es sich gleichsam und entziehe sich der wissenschaftlichen Untersuchung.
Auch wenn nicht alle feministischen Theorien so weit gehen, die morphologische Geschlechtlichkeit zu leugnen, teilen die meisten doch die Annahme, Femininität und Maskulinität und die davon abgeleiteten Geschlechtsrollen seien ausschließlich »sozial konstruiert« (Campbell, 1999; Rhoads, 2004). Wir werden uns noch genauer mit der Annahme auseinandersetzen müssen, für die morphologische Zweigeschlechtlichkeit gäbe die Biologie keine ausreichende Basis ab. Auf jeden Fall dürfte feststehen, dass das Thema »anlagebedingte Geschlechtsunterschiede« im Rahmen dieses Theorieansatzes überhaupt nicht »diskursfähig« wäre. Letztlich läuft die Argumentation darauf hinaus, der Natur jeden Einfluss auf Verhaltensunterschiede der Geschlechter überhaupt abzusprechen und zu glauben, wo solche in Erscheinung träten, könnten sie durch geeignete »Dekonstruktion« ohne Weiteres zum Verschwinden gebracht werden, wenn man nur im kulturellen Umfeld alle Hinweise auf die Geschlechtlichkeit konsequent tilgt, so wie das in Schweden versucht wird. Walter Hollstein hat in Bezug auf dergleichen Bemühungen seine Skepsis angemeldet, wenn er lakonisch Horaz zitiert: »Treib die Natur mit der Forke hinaus; stets kehrt sie zurück, heimlich durchbricht sie als Sieger die Mauern des hässlichen Hochmuts« (Hollstein, 2004, S. 48).
2.7 Toxische Maskulinität
Das Anliegen, Geschlechtsrollen zu dekonstruieren, war bis vor gar nicht langer Zeit auf das feministische Umfeld beschränkt und richtete sich in erster Linie gegen eine »hegemoniale Männlichkeit«, worunter patriarchalische Strukturen verstanden werden, die als sozial konstruiert gedacht sind und in denen Männer dominieren und Frauen sich unterordnen (Connell, 1999). Somit ist es vor allem »Männlichkeit«, die es zu dekonstruieren gilt. Welch groteske Formen das annehmen kann, dokumentieren gewisse »Anleitungen« zur Jungenpädagogik. So heißt es beispielsweise in einer einschlägigen Veröffentlichung: »Jungen sollen in profeministischer, antisexistischer und patriarchatskritischer Jungenarbeit lernen, dass sie, so wie sie sind, nicht sein sollten und einem fatalen Männlichkeitsbild hinterherjagen« (Forster, 2004, S. 487). In einem anderen Beitrag wird folgende Anweisung gegeben: »Nicht die stabile männliche Identität kann das erste Ziel von Jungen- und Männerarbeit sein. […] Das Ziel ist nicht der ›andere Junge‹, sondern gar kein Junge« (Krabel & Schädler, 2001, S. 36). Die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit dieser Anweisungen wird besonders offenkundig, wenn man die Gruppe der Jungen gedanklich durch eine andere diskriminierbare gesellschaftliche Gruppe ersetzt.
Die Behauptung, dass bei Jungen und Männern grundsätzlicher Reformbedarf in Sachen Geschlechtsrollen bestünde, ist in der Gesellschaft mittlerweile kein Nischenthema mehr und findet nicht nur großen Anklang in den Feuilletons, sondern auch im Wissenschaftsbetrieb. Die US-amerikanische Psychologenvereinigung, weltweit Vorbild für andere nationale Psychologenvereinigungen, gab kürzlich einen Ratgeber für Jungen- und Männerarbeit heraus, in dem sie vor einer »traditionellen maskulinen Ideologie« warnte. Diese »beschränke die psychologische Entwicklung von Männern, beeinträchtige ihr Verhalten, führe zu Belastungen und Konflikten und verschlechtere die psychische und körperliche Gesundheit« (APA, 2018, S. 3, Übersetzung von der Autorin). Der Leitfaden beschäftigt sich mit der Frage, wie man in der psychologischen Arbeit Jungen und Männern diese Männlichkeitsideologie ausreden könne und erhofft sich davon eine Reihe von positiven gesundheitlichen Effekten. Bemerkenswert ist, dass diese Empfehlungen hauptsächlich auf Manuskripten beruhen, die entweder keine empirischen Untersuchungen zur Grundlage hatten und damit nur die persönliche Meinung der Autoren widerspiegeln oder die ein korrelatives Studiendesign hatten. Letztere zeigten also nur, dass Gesundheitsprobleme mit einer »traditionellen männlichen Ideologie« einhergingen. Damit ist aber natürlich nicht geklärt, dass die »traditionelle maskuline Ideologie« die Gesundheitsprobleme verursachte. Ursache und Wirkung könnten umgekehrt verknüpft sein oder beide Phänomene könnten durch einen dritten Faktor hervorgerufen werden (s. Kasten »Korrelation und Kausalität«). Experimente zu diesen Spekulationen sind Mangelware. Falls vorhanden, fördern sie eher Petitessen zu Tage, beispielsweise dass Männer, die kurz zuvor maskuline Wörter (z. B. »Schnauzbart«) beiläufig gelesen hatten, vermeintlich ungesündere Lebensmittel (Pommes frites statt Ofenkartoffeln) bevorzugen als Männer, die feminine Wörter (z. B. »Lippenstift«) gelesen hatten. Frauen reagieren übrigens ähnlich (Zhu et al., 2015). Wie aus solchen Experimenten die Gesundheitsgefahr einer »traditionellen maskulinen Ideologie« abgeleitet werden kann, ist unklar. Noch radikalere Strömungen handeln dieses Thema unter dem Begriff »toxische Maskulinität« ab, ohne dass aber gesagt wird, welche Art der Maskulinität nicht toxisch sei und freilich ohne von einer »toxischen Femininität« zu sprechen (Karner, 1996).
Читать дальше