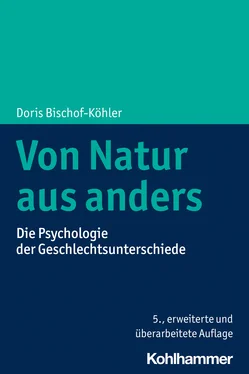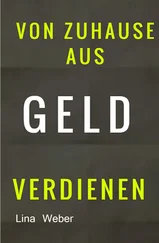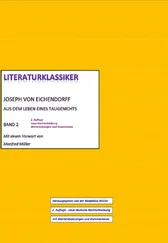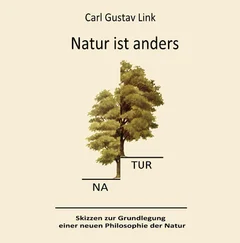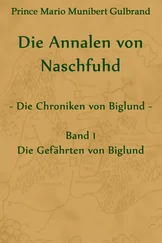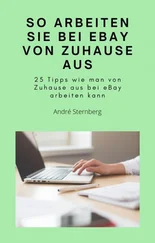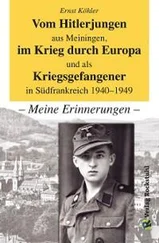1 ...8 9 10 12 13 14 ...34
Korrelation und Kausalität
Nicht immer, wenn sich zwei Größen gemeinsam verändern, liegt das daran, dass die eine die andere verursacht hätte. Statistiker kennen viele Anekdoten, die das belegen. Man kann zum Beispiel anhand von Daten des statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt zeigen, dass dort im Zeitraum zwischen 2005 und 2014 der Verdienstabstand zwischen Männern und Frauen einerseits und die Anbaufläche von Gemüse andererseits mit nahezu 0.9 korrelierten. Betrachtet man die Verläufe, die während dieser Jahre mannigfach herauf- und heruntergingen und dies immer getreulich im Gleichschritt, so kann es gut möglich sein, dass da irgendeine Art von Kausalität vorgelegen haben könnte. Aber niemand wird ernsthaft erwägen, dass eine der beiden Variablen die Ursache der anderen war; wenn überhaupt hat es vorgeordnete Umstände gegeben, die auf alle beide Einfluss hatten. Man kann der Sache natürlich experimentell auf den Grund gehen, aber das ist bei gesellschaftlichen Fragen, zum Beispiel bei Geschlechtsunterschieden, häufig aus ethischen oder praktischen Gründen nicht möglich. Wenn man einer Korrelation dann eine bestimmte Kausalität unterlegt, muss man sich klar sein, dass diese Deutung spekulativ ist.
Politisch findet der Versuch, Geschlechtergerechtigkeit herzustellen seit etlichen Jahren in einer Bewegung Ausdruck, die als Gender Mainstreaming bezeichnet wird – ein Begriff, der dem Normalverbraucher nicht gerade das Verständnis erleichtert. Gender Mainstreaming hat in Form großzügig finanzierter Projekte die Gleichstellung der Geschlechter zum Ziel und begründet dies in der oben zitierten Broschüre des Bundesfamilienministeriums dahingehend, »bei allen gesellschaftlichen Vorhaben [seien] die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern von vornherein und regelmäßig zu berücksichtigen, da es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt« – was immer das heißen mag (Bundesfamilienministerium, 2002, S. 5; kritisch hierzu: Hollstein, 2004). So ganz scheint man sich aber auch hier nicht von einem gewissen Misstrauen gegen die Männlichkeit verabschiedet zu haben, wohl weil man befürchtet, man würde »dem Paradigma von der weiblichen Benachteiligung‚ auf die Füße treten’« (Rose, 2007, S. 77). Diese Sorge drückt sich beispielsweise in der Gestaltung des Global Gender Gap Index aus, der das Ausmaß an Geschlechtergerechtigkeit eines Landes ermitteln soll und von der Stiftung Weltwirtschaftsforum jährlich berechnet wird. Hierbei ergibt sich immer eine Ungleichheit zwischen den Geschlechtern zu Lasten der Frauen, die von Land zu Land lediglich unterschiedlich stark ausfällt. Das liegt jedoch an einer recht eigenwilligen Berechnungstechnik. Es gehen verschiedene Faktoren mit unterschiedlicher Gewichtung ein, wie beispielsweise das Einkommensverhältnis von Frauen zu Männern oder das Verhältnis der Lebenserwartung von Frauen und Männern. Der Index kann scheinbar Werte zwischen 0 und 2 annehmen. Der Wert 0 drückt völlige Ungleichheit zu Lasten der Frauen aus, der Wert 1 vollständige Gleichheit und der Wert 2 wäre theoretisch völlige Ungleichheit zu Lasten der Männer. Pikanterweise werden allerdings nahezu alle Faktoren, die einen Wert von größer 1 annehmen und damit eine Ungleichheit zu Lasten der Männer anzeigen, auf 1 gekürzt. Durch eine besondere Berechnung beim Faktor »Gesundheit und Lebenserwartung« liegt der Gesamtwert immer unter 1. Das Ergebnis zeigt also unabhängig von den gesellschaftlichen Verhältnissen stets eine Ungleichheit zu Lasten der Frauen an.
Der Basic Indicator of Gender Inequality mit einer ergebnisoffenen Berechnungsweise zeichnet ein differenzierteres Bild (Stoet & Geary, 2019). In Sachen Bildungschancen, Lebenserwartung und Lebenszufriedenheit registriert er zwar auch in weiten Teilen der Welt Ungleichheit zu Lasten der Frauen. Gerade aber in wirtschaftlich hoch entwickelten Ländern wie Deutschland registriert er einen leichten Vorteil für Frauen, was vor allem an ihrer höheren Lebenserwartung liegt. Ob damit die Lebenswirklichkeit von Frauen und Männern hierzulande tatsächlich abgebildet wird, ist natürlich offen. Allerdings erscheint ein Verweis auf den Global Gender Gap Index in Sachen Geschlechtergerechtigkeit bei Kenntnis seiner Berechnung reichlich unbedarft.
Wofür unter dem Stichwort »Gender Mainstreaming« Geld ausgegeben wird, ist tatsächlich in vielen Fällen erstaunlich. Beinahe kabarettreif ist die Empfehlung einer von der nordrhein-westfälischen Landesregierung mit 27 000 Euro gesponserten Studie zum »Gender Mainstreaming im Nationalpark Eifel«: In ihr wird allen Ernstes empfohlen, Bilder der Hirschbrunft im Werbematerial zukünftig möglichst zu vermeiden oder wenigstens in eine Darstellung der »Vielfalt der Tierwelt« einzubetten, um keine stereotypen Geschlechterrollen zu fördern (Hayn, 2005). Eltern, die an traditionellen Geschlechtsrollen festhalten, werden in einer vom Berliner Senat finanzierten »Handreichung« für Kindergärten mit dem Titel »Murat spielt Prinzessin, Alex hat zwei Mütter und Sophie heißt jetzt Ben« ins Visier genommen. Wenn die Eltern mit Ablehnung auf das geschlechtsvariante Verhalten ihres Kindes reagieren und »keine Gesprächsbereitschaft zeigen, sollte die Situation auch unter dem Blickwinkel einer möglichen Kindeswohlgefährdung betrachtet werden« (Günther, 2018, S. 5). Es mag ein wünschenswertes Ziel sein, dass Eltern nicht repressiv gegenüber den kindlichen Eigenarten auftreten, doch stimmt die unverhohlene Androhung der Inobhutnahme als Ultima Ratio doch recht nachdenklich.
Sicher handelt es sich bei den angeführten Zitaten um Auswüchse und es kann nichts schaden, wenn Lehrkräfte und Erzieher dafür sensibilisiert werden, Geschlechtsrollenverhalten nicht ausdrücklich auch noch zu unterstreichen. Kontraproduktiv ist es aber, wenn das zu einer völligen Verunsicherung führt, wie man sie unter praktizierenden Pädagogen gegenwärtig nicht selten beobachtet, die einfach ratlos sind, welche Maßnahmen sie überhaupt noch ergreifen dürfen.
Einen akademischen Anstrich bekommen diese Aktivitäten durch ein neues Fach an Hochschulen, das sich als »Gender Studies« bezeichnet. Eine genaue Verortung ist schwierig, versteht sich das Fach doch als interdisziplinär. Die Wurzeln lägen sowohl in der Frauen- und Geschlechterforschung wie auch in der Frauenbewegung und aktuell beschäftige man sich mit der Frage »wie Geschlecht, Gesellschaft, Kultur und Wissen (schaft) zueinander vermittelt sind« (Brand & Sabisch, 2018, S. 2). Das Thema ist weder trivial noch uninteressant. Die einschlägigen Publikationen erwecken allerdings häufig den Eindruck, dass es sich um ein Sammelbecken von verschiedenen ideologisch aufgeladenen Themen handelt, zu denen eine politisch korrekte Haltung eingenommen wird. Denn bei aller Interdisziplinarität spielen biologische Überlegungen keine Rolle, und wenn, dann lediglich als Projektionsfläche für alles Schlechte dieser Welt, das es zu bekämpfen gilt. In einem Aufruf, Manuskripte bei der Zeitschrift »Gender« zum Thema »Antifeministische Mobilisierungen« einzureichen, wird die Biologie unter dem Begriff »(Re-)Naturalisierung von Geschlecht« problematisiert, wobei eine entsprechend motivierte Kritik am ideologischen Charakter der Gender Studies »diskursive Anschlüsse für Rassismen und Ideologien zur Legitimierung von Ungleichheit« böte (Gender, S. 1). Diese Art der Immunisierung gegenüber Kritik ist einzigartig für eine Disziplin mit wissenschaftlichem Selbstverständnis.
Dabei ist eine breite akademische Kritik an den Gender Studies überfällig. Besonders viel Material für Kritik liefert beispielsweise ein sexualpädagogisches Handbuch, in dem prominente Vertreter dieses Fachs der Idee folgen, Geschlecht und Sexualität seien sozial konstruiert. In der Absicht, »Verwirrung und Veruneindeutigung« in Sachen »Sexualitäten, Identitäten, Körpern etc.« (Tuider et al., 2012, S. 40) bei Kindern und Jugendlichen zu stiften, schlagen Elisabeth Tuider und Kollegen darin zahlreiche Übungen vor. Eine Übung namens »Der neue Puff für alle« etwa stellt Jugendliche vor die Aufgabe, ein »Freudenhaus der sexuellen Lebenslust« in der Großstadt zu modernisieren. Dabei sollen sämtliche sexuelle Vorlieben berücksichtigt werden. Bemerkenswert ist, dass die Autoren keine empirischen Belege vorlegen, die ihre Ideen als hilfreich ausweisen. Offenkundig besteht auch kein Verständnis für die Tatsache, dass eine pädagogische Intervention nicht alleine deswegen gut ist, weil sie vermeintlich »theoretisch gut fundiert« sei. So verwies Tuider bei einer Fachtagung zu dieser Frage zunächst auf Adornos Aussage, dass man »ohne Angst verschieden sein« können müsse. Sie wollte allerdings einem »weißen, deutschen Professor« nicht das letzte Wort zu ihren Praxisvorschlägen überlassen. Stattdessen zitierte sie Jugendliche, die an diesen Maßnahmen teilgenommen hatten – so etwa einen Jungen, der zu Protokoll gab: »Wir fanden es damals alle gut, über solche Themen zu reden, weil wir danach endlich alle darüber Bescheid wussten.« 2 Die methodische Naivität dieses Evaluationsversuchs ist erschütternd. Abgesehen davon, dass man diese Übungen pädagogisch für prinzipiell ungeeignet halten kann, wäre grundsätzlich eine empirische Untersuchung solch pädagogischer Maßnahmen notwendig, bevor man deren Einsatz empfiehlt (s. Kasten »Korrelation und Kausalität«) (Zmyj, 2016).
Читать дальше