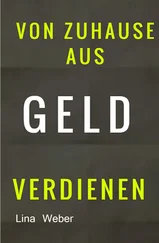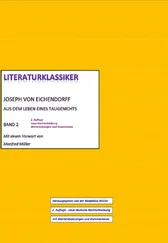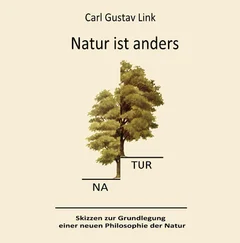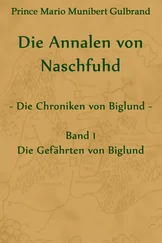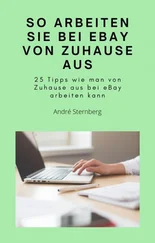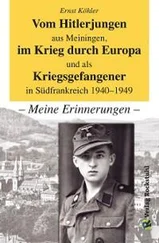Mit der richtigen Zuordnung des Geschlechts ist zwar ein erster wichtiger Schritt zum Verständnis der Geschlechtsidentität getan, die Entwicklung ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Noch versteht das Kind nicht, dass die Geschlechtsidentität ein Merkmal ist, das eine zeitüberdauernde Charakteristik hat, sich also durch Permanenz auszeichnet. In der Literatur wird dieser Aspekt des Identitätsverständnisses unter Bezugnahme auf Slaby und Frey auch als Geschlechtsstabilität bezeichnet (Slaby & Frey, 1975).
Folgendes Beispiel von Kohlberg illustriert anschaulich, was darunter zu verstehen ist. Johnny (4;6) und Jimmy (4;0) führen folgenden Dialog:
Johnny: Wenn ich groß bin, werde ich Flugzeugbauer.
Jimmy: Wenn ich groß bin, werde ich eine Mama.
Johnny: Du kannst keine Mama sein, du musst ein Papa werden.
Jimmy: Doch, ich werde eine Mama.
Johnny: Nein, du bist kein Mädchen, du kannst keine Mama sein.
Jimmy: Doch, ich kann!
Im Gegensatz zu Johnny versteht Jimmy noch nicht, dass er immer seinem Geschlecht angehören wird, auch als Erwachsener. Und er begreift, wie einschlägige Befunde zeigen, auch noch nicht, dass er in der Vergangenheit immer schon ein Junge war. In Untersuchungen wird dieses Verständnis üblicherweise geprüft, indem man den Kindern Fragen der folgenden Art stellt:
Wenn du groß bist, wirst du dann eine Mama oder ein Papa?
Könntest du auch (das Gegenteil) ein Papa/eine Mama werden?
Als Baby, warst du da ein Junge/Mädchen?
Nun wissen Dreijährige, wie wir gesehen haben, schon ziemlich genau, ob sie ein Junge oder ein Mädchen sind. Sie nehmen aber dennoch an, dies für ihr Erwachsensein ändern zu können, wenn sie nur wollen, und nennen häufig auch das andere Geschlecht in Bezug auf ihre Babyvergangenheit.
Um diese Fehlleistung richtig einzuordnen, muss man berücksichtigen, dass sich die Vorstellung von Zeiträumen und zeitlichen Dauern erst zwischen dreieinhalb und vier Jahren entwickelt (Bischof-Köhler, 1998, 2000). Jüngere Kinder leben ohne Zeitbezug in der Gegenwart. Wie sie die Frage verstehen, was sie »als Babys« oder »als Erwachsene« waren oder sein würden, wissen wir nicht; hier und jetzt sind sie eben keines von beiden. Vermutlich spricht die Frage einfach nur jene vage Sphäre der Imagination an, in der auch das kindliche Als-Ob-Spiel zuhause ist. Erst im Laufe des vierten Lebensjahres entsteht die Fähigkeit, sich sich selbst in Situationen vorzustellen, die in der Zukunft oder in der Vergangenheit liegen, also gleichsam in der Fantasie auf Zeitreise zu gehen und die Verbindlichkeit des aktuellen Ichgefühls auf diese Reise mitzunehmen (Bischof-Köhler, 2000). Im Unterschied zu Slaby und Frey die diese Fähigkeit als Stabilität bezeichnen, haben wir sie in unserer eigenen Forschung »Permanenz« genannt.
Tatsächlich entwickeln sich im Vorschulalter bei Kindern einige Fähigkeiten, die alle mit der Vergegenwärtigung von Zeiträumen in Verbindung gebracht werden können. In einer eigenen Studie zu diesem Thema wurden Kinder zwischen 3 und 5 Jahren auf verschiedene Fähigkeiten hin getestet (Zmyj & Bischof-Köhler, 2015). In einer Aufgabe zum Zeitverständnis sollten sie bei drei Sanduhren mit unterschiedlicher Füllhöhe beispielsweise angeben, welche als erstes und welche als letztes fertig sei, nachdem man sie umgedreht hatte. Kinder, die bei dieser Aufgabe gut abschnitten, waren auch häufiger zur Geschlechtspermanenz in der Lage. Eine Interpretation dieses Zusammenhangs besteht darin, dass sowohl das Sanduhrverständnis als auch die Geschlechtspermanenz auf ein und dieselbe Fähigkeit zurückgreift, sich Zeiträume vorstellen zu können.
6.5 Geschlechtskonsistenz
Nun hat das Verständnis der Geschlechtsidentität bei Kindern dieses Alters aber noch eine weitere Dimension. Auch hierauf hat Kohlberg erstmals aufmerksam gemacht; allerdings ordnet er diese Dimension gemeinsam mit der eben beschriebenen Permanenz unter einem einzigen Begriff ein, er spricht von »Geschlechtskonstanz«. Dieser zweite Aspekt hat aber genau genommen mit der Permanenz nichts gemein: Kinder im Vorschulalter gehen von der Annahme aus, das Geschlecht verändern zu können, indem sie die äußere Erscheinung ändern. Es fehlt ihnen also nicht nur am Verständnis für die zeitüberbrückende Charakteristik der Identität, sondern sie machen diese irrtümlicherweise auch an der äußeren Erscheinung fest. Da dieser zweite Aspekt zeitlich nicht mit dem ersten korreliert – Kinder können paradoxerweise schon die Geschlechtspermanenz erreicht haben und dennoch eine Veränderung aufgrund äußerer Merkmale noch für möglich halten – wollen wir diesen Aspekt als Geschlechtskonsistenz bezeichnen. Der Junge, der plötzlich meinte, ein Tiger zu sein, ist ein drastisches Beispiel für einen Mangel an Konsistenz.
Tatsächlich glauben Kinder bis zum Alter von durchschnittlich fünf Jahren, zum Teil aber auch noch ältere, dass ein Junge, um zu einem Mädchen zu werden, nur einen Rock anzuziehen brauche und sich die Haare lang wachsen lassen müsse. Wenn er dann gar noch mit einer Puppe spielt, also eine gegengeschlechtliche Tätigkeit ausübt, dann erscheint ihnen der Wechsel perfekt, und ganz entsprechend nehmen sie an, dass sich auch ein Mädchen durch geeignete Veränderung der äußeren Attribute in einen Jungen verwandeln könnte. Wir haben das anhand zweier Videofilme bei Kindern dieser Altersgruppe genauer belegen können (Zmyj & Bischof-Köhler, 2015). Die Filme zeigten einen Jungen, respektive ein Mädchen, die sich allmählich durch Umkleiden in das andere Geschlecht verwandelten und sich dann auch mit einem, jeweils für dieses Geschlecht typischen Spielzeug (Lastwagen, Puppe) beschäftigten. Jüngere Kinder waren regelmäßig überzeugt, dass die Akteure ihr Geschlecht gewandelt hatten.
Für jüngere Kinder genügt sogar der bloße Wunsch; wenn man nur wollte, könnte man ein Kind des anderen Geschlechts werden. Manchmal behaupten Kinder in diesem Altersabschnitt fest, dem anderen Geschlecht anzugehören, Im Allgemeinen ist dies kein Grund zur Beunruhigung und wird sich nach kurzer Zeit wieder ändern. Die Kinder verstehen in diesem Alter einfach noch nicht, dass die Geschlechtszugehörigkeit ein Merkmal ist, das absolut festliegt und nicht beliebig gewechselt werden kann wie ein Kleidungsstück.
Wenn man nach den Gründen dieses Fehlschlusses sucht, dann stellt sich natürlich zunächst die Frage, an welchen Kriterien die Geschlechtszuweisung überhaupt festgemacht wird. Haartracht und Kleidung spielen dabei eine zentrale Rolle (Golombok & Fivush, 1994), aber wahrscheinlich auch die Bewegungsweise, in der sich die Jungen und Mädchen schon im Kleinkindalter deutlich unterscheiden (  Kap. 8.9), ferner die Stimme und der Körperbau, wobei der Einfluss der zuletzt genannten Merkmale in Tests aber schwer zu erfassen ist.
Kap. 8.9), ferner die Stimme und der Körperbau, wobei der Einfluss der zuletzt genannten Merkmale in Tests aber schwer zu erfassen ist.
Nun stellt sich in diesem Zusammenhang natürlich die Überlegung ein, die Unsicherheit der Kinder könnte daher rühren, dass sie die eigentlich wirklich relevanten Kriterien für die Geschlechtszugehörigkeit nicht kennen, nämlich die Genitalien. So meinte etwa Freud, Kinder hätten deshalb Probleme, die Geschlechtlichkeit zu verstehen, weil ihnen die Eltern das entscheidende anatomische Detailwissen vorenthielten. Kohlberg widerspricht dieser Annahme aufgrund eigener Untersuchungen, bei denen er seine Versuchskinder unter anderem gefragt hatte, ob man Jungen und Mädchen unterscheiden könne, wenn sie ausgezogen seien. Bereits in den 1960er Jahren, als er die Befragung vornahm, bekundeten die Kinder durchweg, dass sie den Unterschied der Genitalien kannten. Mittlerweile wird man davon ausgehen können, dass dies die Regel ist.
Читать дальше
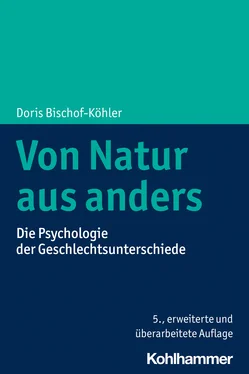
 Kap. 8.9), ferner die Stimme und der Körperbau, wobei der Einfluss der zuletzt genannten Merkmale in Tests aber schwer zu erfassen ist.
Kap. 8.9), ferner die Stimme und der Körperbau, wobei der Einfluss der zuletzt genannten Merkmale in Tests aber schwer zu erfassen ist.