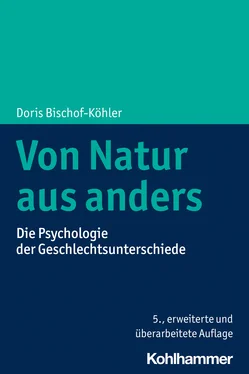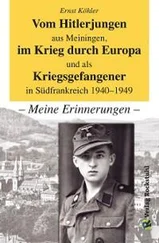Als Erstes fiel auf, dass sich geschlechtstypische Verhaltenspräferenzen bereits in diesen frühen Altersabschnitten manifestierten: Die Jungen rauften lieber, transportierten größere Baumaterialen und bauten mit diesen, die Mädchen bevorzugten Puppen, verkleideten sich gern und malten und bastelten viel. Da solche zum gängigen Stereotyp passenden Vorlieben bei den kleinen Mädchen bereits etwas eindeutiger ausgebildet waren als bei den Jungen, nahmen die Autorinnen zunächst an, Mädchen würden intensiver für geschlechtsadäquates Verhalten belohnt. Es stellte sich dann aber heraus, dass sowohl männliche als auch weibliche Erzieher in der Häufigkeit verstärkender Interventionen keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern machten.
Interessant ist aber, dass auch noch in einer anderen Hinsicht Gleichbehandlung zu konstatieren war, nämlich darin, wofür die Kinder gelobt wurden. Dies war bei beiden Geschlechtern ein eher dem femininen Stereotyp entsprechendes oder allenfalls geschlechtsneutrales Verhalten. Ruhiges Spiel wurde gleichermaßen von männlichen wie weiblichen Erziehern bevorzugt, wohl weil es ihnen das Leben erleichterte, während die als typisch jungenhaft geltenden Verhaltensmerkmale wie Aggressivität, wildes Spiel und Freude am Raufen nicht eigens verstärkt wurden. Das hielt die Jungen aber keineswegs davon ab, Präferenzen gerade für diese Aktivitäten auszubilden. Inzwischen ist es so, dass – wohl auch aus ideologischen Gründen – die Hälfte der Erzieher das jungentypische spielerische Raufen mehrmals die Woche oder gar täglich ausdrücklich unterbindet (Logue & Harvey, 2010).
Kein eindeutiges Bild zeichnet auch eine kürzlich erschienene Studie zur geschlechtsspezifischen Erziehung, die die Reaktionen der Erzieher auf kindliches Spielverhalten untersuchte. Im Zentrum der Beobachtung standen dabei Hilfsangebote oder Anregungen zum weiteren Spiel der Kinder. Dabei gilt allerdings zu berücksichtigen, dass wildes Spiel, Raufen und Aggressivität als jungentypische Aktivitäten und das Spiel mit Puppen als mädchentypische Aktivität gar nicht erst berücksichtigt wurden und diese Studie damit nur bedingt vergleichbar zur Studie von Fagot ist. Als jungentypisch übrig blieben etwa das Spiel mit Bauklötzen, Fahrrädern, Lastwagen, Computern oder Bällen. Mädchentypisch waren den Autoren zufolge die Themenbereiche künstlerische Aktivität, Verkleiden und Küche. Dabei zeigte sich nun, dass das Unterstützungsangebot der Erzieher sehr wohl geschlechtsspezifisch war: Jungen wurden eher bei jungentypischem, Mädchen eher bei mädchentypischem Spiel unterstützt – Ersteres sogar häufiger als Letzeres. Die Autoren schließen mit der Hoffnung, dass sich das Spielverhalten angleichen könne, böten die Erzieher keine geschlechtsspezifische Unterstützung mehr an (Granger et al., 2017). Dabei wird freilich nicht bedacht, dass dieses selektive Unterstützungsangebot auch eine Reaktion der Erzieher auf unterschiedliche Vorlieben der Mädchen und Jungen sein könnte und nicht die Ursache für den Geschlechtsunterschied. Möglicherweise reagierten die Erzieher darauf, dass sich die Kinder besser in das Spiel vertieften, wenn ihren etwas unterschiedlichen Interessen Rechnung getragen wurde, wobei diese Haltung nicht ausschloss, dass sie Mädchen und Jungen mit eher geschlechtsuntypischen Interessen sehr wohl auch unterstützten. Für diese Interpretation spricht auch, dass das geschlechtsspezifische Unterstützungsangebot nicht mit den Geschlechtsstereotypen der Erzieher zusammenhing, die separat in einem Fragebogen erfasst wurden (Granger, 2014).
5.4 Erziehung durch Gleichaltrige
Nun muss man allerdings noch einen anderen wichtigen Umstand berücksichtigen. Fagots Untersuchung ergab, dass Jungen generell weniger auf Erwachsene hörten als Mädchen. Einen wesentlichen Einfluss übten bei ihnen dagegen die gleichgeschlechtlichen Peers – also andere Jungen – aus: Sie verstärkten sich gegenseitig, und dies in der Tat vor allem für geschlechtstypisches Verhalten. Beobachtungen dieser Art sind durch mehrere Studien belegt (z. B. Langlois & Downs, 1980; Martin & Fabes, 2001) und führten zu einer neuen Variante der Sozialisationseuphorie: Vergesst die Erwachsenen, die Kinder erziehen sich gegenseitig (Harris, 1995)!
In Wirklichkeit muss man schon etwas kurzgefasst denken, um sich mit solchen »Lösungen« zufrieden geben zu können. Zwar dürfte außer Frage stehen, dass sich der Gruppendruck bei älteren Kindern auf das Verhalten der Einzelnen geschlechtsprofilierend auswirkt. Was aber die jüngeren Kinder betrifft, so erhebt sich die unbequeme Frage, wie die gleichaltrigen Spielgefährten denn überhaupt zu einer geschlechtstypischen Präferenz in ihrem Verstärkungsverhalten gekommen sind. Man muss sich vor Augen halten, dass die beobachteten Kinder noch nicht einmal zwei Jahre alt waren. Wie wir noch sehen werden, ist dies ein Alter, in dem sie noch Schwierigkeiten haben, das eigene Geschlecht und das der anderen richtig einzuordnen. Die erste Frage ist also schon einmal, wieso ein kleiner Junge überhaupt unter den bevorzugten Einfluss männlicher Peers gerät, und die zweite, woher diese wissen sollen, was sich für einen »richtigen« Jungen gehört.
So waren in der Studie von Langlois und Downs negative Reaktionen, die sich auf das Geschlecht bezogen, unter den Kindern auch eher selten. Wenn solche Reaktionen überhaupt auftraten, dann bei Jungen, die ihren Spielkameraden zu verstehen gaben, dass man nicht mit Mädchen oder Mädchenspielsachen spielt. Kleine Mädchen des gleichen Alters dagegen fanden bei ihren Geschlechtsgenossinnen jede Form von Verhalten akzeptabel, unabhängig davon, ob es geschlechtsadäquat war oder nicht. Im Übrigen wurden die Mädchen als gehorsamer beschrieben, allerdings nur gegenüber den Betreuern; von den Jungen ließen sie sich nichts sagen.
Neuere Studien aus Carol Martins Arbeitsgruppe zur Beeinflussung durch Peers sind von der Anlage her wenig überzeugend. Zwar wurde das geschlechtsstereotype Verhalten der Kinder festgestellt, nicht aber deren Versuche, andere Kinder zu beeinflussen (Xiao et al., 2019). Stattdessen wurden die Kinder einfach nur gefragt, wer von den anderen Kindern ihnen sage, dass sie mit etwas nicht spielen sollten, weil sie ein Junge oder ein Mädchen seien.
Zudem neigten die Autoren zu einer Überinterpretation ihrer Befunde. Es zeigte sich, dass Kinder zu mehr Geschlechtsstereotypen tendierten, je mehr Zeit sie mit Kindern verbrachten, die häufig als Verstärker von Geschlechtsstereotypen nominiert wurden. Nun wäre natürlich auch denkbar, dass sie sich mit diesen Kindern von vornherein besser verstanden und deswegen gern mit ihnen zusammen waren, dass der Verursachungszusammenhang also genau umgekehrt ist.
Geradezu abenteuerlich wirken die praktischen Schlüsse, die aus solchen Ergebnissen gezogen wurden. So sollten Kinder, zumeist Jungen, die in den Augen der Autoren zu viel geschlechtsrollenverstärkendes Verhalten zeigten, besonderen Schulungen zugeführt werden. Darüber hinaus sollten sie in regelmäßigen Abständen ihre Spielpartner wechseln, um einen nicht zu schädlichen Einfluss auf die anderen Kinder zu entfalten, die sonst zu viel Zeit mit ihnen verbrächten.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass geschlechtsdifferenzierendes Erziehungsverhalten nicht nur durch das Geschlecht der Kinder, sondern auch durch das der Sozialisationsagenten beeinflusst wird. Hinzukommt, dass die Verstärkungspraxis auch von der Situation abzuhängen scheint, wie sich daran zeigt, dass Jungen im Kindergarten sogar von männlichen Betreuern für Verhaltensweisen gelobt werden, die eigentlich dem gegengeschlechtlichen Stereotyp zuzurechnen sind.
Bei Jungen zeichnet sich das Bild ab, dass Mütter und Erzieher eher neutrales und mädchenhaftes Verhalten fördern, während Väter eher Nachdruck auf Geschlechtsrollenkonformität legen. Bei Mädchen sind Väter dagegen toleranter gegenüber Abweichungen, und hierin stimmen sie weitgehend mit der Haltung der Mütter und anderer kleiner Mädchen überein. Besonders interessant ist das Verhalten kleiner Jungen: Sie scheinen neben den Vätern noch am ehesten Geschlechtsrollenverstärkung auszuüben – und das, obwohl sie ihrerseits eigentlich widersprüchliche Botschaften erhalten. Da sie im fraglichen Alter auch kaum über explizite Kenntnisse zur Geschlechtlichkeit verfügen, stellt sich die interessante Frage, wie sie so frühzeitig dazu kommen, Maßstäbe für geschlechtsrollenkonformes Verhalten zu entwickeln. Dieses Thema müssen wir allerdings auf ein späteres Kapitel verschieben.
Читать дальше