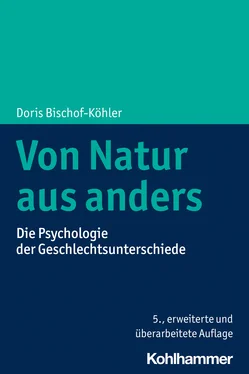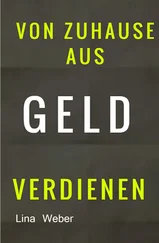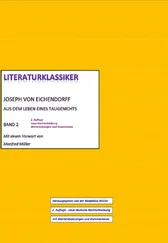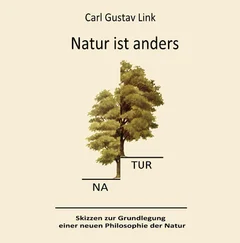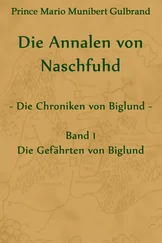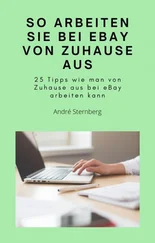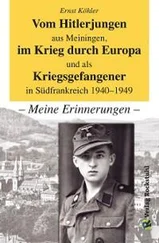Die Töchter hingegen haben dieses Problem nicht; sie können im warmen Nährboden emotionaler Geborgenheit reifen und gedeihen. Sie »definieren sich […] nicht im selben Maße wie Jungen durch Verleugnung präödipaler Beziehungsmuster. Regression zu diesen Mustern wird von ihnen demnach nicht als so grundlegende Bedrohung ihres Ichs erlebt« (Chodorow, 1978, S. 167, übersetzt von der Autorin). Zu ihrer Geschlechtsidentität gehören also weder Loslösung noch Individuation, sie haben beide gewissermaßen nicht nötig und ersparen sich damit auch die ständigen Beziehungsprobleme, mit denen Männer ihre aufgezwungene Ich-Abgrenzung bezahlen müssen.
Das könnte so verstanden werden, als seien Männer im Leben zwar unglücklich und psychisch verkrüppelt, aber immerhin wenigstens reif, während Frauen das Los seliger Infantilität in Zweieinigkeit mit der Mutter beschieden wäre. Damit ist Chodorow aber nicht einverstanden. Wenn in unserer Gesellschaft Persönlichkeitsentwicklung mit Ablösung gleichgesetzt werde, so sei dies bereits die Auswirkung der von Männern beanspruchten Richtlinienkompetenz, die einfach einseitig ihren eigenen Lebensstil als verbindlich deklarierten und die weibliche Mentalität daran mäßen. Im Übrigen bleibt der Autorin nicht verborgen, dass Mädchen auch Konflikte mit ihrer Mutter haben und sich vom Vater fasziniert zeigen. Letzteres deutet sie als Reaktion auf den Umstand, dass der Vater sich ihren Kontaktwünschen so oft durch Abwesenheit entziehe. Spannungen mit der Mutter wiederum erklärten sich dadurch, dass dieser in der frühen Kindheit so uneingeschränkte Allmacht zukam.
Verglichen mit dem Ansatz Freuds zeichnet Chodorow sicher ein deutlich anderes Bild der affektdynamischen Prozesse. Davon abgesehen treten aber unverkennbare Gemeinsamkeiten beider Theorien hervor: Beide postulieren eine ursprünglich gleiche Erlebnisweise von Jungen und Mädchen, in beiden Fällen fungiert die Mutter als primärer Bindungspartner, der anatomische Geschlechtsunterschied wird hier wie dort zum Auslöser der Diskrimination, und in beiden Fällen ermöglicht bzw. erzwingt ein Elternteil – bei Freud der Vater, bei Chodorow die Mutter – durch die Art, wie es mit dem Kind interagiert, die geschlechtliche Identifikation (Chodorow, 1978, S. 167).
Kritisch einzuwenden ist auch gegen Chodorow, wie schon gegen Freud, dass die Identifikation mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil eine größere Ähnlichkeit des Charakters zwischen Müttern und Töchtern einerseits und Vätern und Söhnen andererseits bedingen müsste, für die es keine empirischen Belege gibt. Was die starke Betonung der positiven Beziehung zwischen Mutter und Tochter und den Ausschluss des Sohnes betrifft, so geben hierzu insbesondere Befunde der Bindungstheorie zu denken. Diese unterscheidet – je nach Qualität der Mutter-Kind-Beziehung – »sicher« und »unsicher gebundene« Kinder, wobei die unsichere Bindung dadurch bedingt ist, dass die Mütter Probleme haben, emotionale Nähe zu ihren Kindern herzustellen. Während sicher Gebundene sozial kompetent sind und affektiv einen guten Rapport herstellen können, gelten unsicher Gebundene als emotional eher problemgeladen und neigen dazu, sich zurückzuziehen (Ainsworth et al., 1978; Bretherton, 1985). Wenn Chodorow Recht hätte, dann müssten Jungen in erster Linie in der zweiten Gruppe zu suchen sein. In den zahlreichen Untersuchungen, die in der ganzen Welt zur Bestimmung des Bindungstyps an kleinen Kindern vorgenommen wurden, findet sich aber kein Hinweis für die Überrepräsentation des männlichen Geschlechts bei unsicher Gebundenen (vgl. auch Maccoby, 2000).
5 Dressur und Nachahmung
5.1 Theorie der geschlechtstypischen Verstärkung
Freuds Theorie hat in der Diskussion unseres Themas bis in die Gegenwart hinein Spuren hinterlassen. Offiziell beruft sich heute, außer in orthodox psychoanalytischen Kreisen, freilich kaum mehr jemand ernsthaft auf sie. Heute liefern vor allem vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Popularität der »Gender Studies« vielmehr lerntheoretische Konzeptionen die eindeutig favorisierten Erklärungsansätze für geschlechtstypisches Verhalten. Dabei geht man von der als selbstverständlich betrachteten Voraussetzung aus, dass beide Geschlechter von Natur aus gleich veranlagt sind. Das Auftreten geschlechtstypischen Verhaltens wird ausschließlich soziokulturellen Effekten zugeschrieben, unter deren Einfluss Kinder allmählich in ihre Rolle als Mann oder Frau hineingeformt würden.
Bei den lerntheoretischen Erklärungen lassen sich zwei Stoßrichtungen unterscheiden. Die eine steht in der Tradition des Verstärkungslernens. Geschlechtsunterschiede entstehen ihr zufolge durch Belohnung und Bestrafung. Der zweite Ansatz rückt die Wirkung von Modellen und das Nachahmungslernen in den Vordergrund; man bezeichnet diese Richtung als Theorie des sozialen Lernens.
Für das Verstärkungslernen beruht soziale Rollenübernahme darauf, dass entsprechende Verhaltensweisen andressiert werden. Man nimmt an, dass die Erwartungen, die sich in den Geschlechtsstereotypen einer jeden Kultur niederschlagen, als Leitbild für das Erziehungsverhalten dienen. Die Konditionierung stellt man sich als eine Art »shaping« vor, also ein Vorgehen in kleinsten Schritten. Jede Verhaltensandeutung in Richtung des Leitbilds wird belohnt, während Tendenzen in die gegengeschlechtliche Richtung entweder nicht zur Kenntnis genommen oder bestraft werden.
Da die Überzeugung, Geschlechtsunterschiede seien ausschließlich ein Lernprodukt, in diesem Theorieansatz als Nullhypothese gilt, hält man es nicht für nötig, sich Gedanken darüber zu machen, ob diese Annahme je bewiesen wurde. Häufig begnügt man sich mit dem Hinweis, Jungen und Mädchen würden ja von Geburt an unterschiedlich behandelt, also verstehe es sich von selbst, warum sie verschieden sind. Wir werden diesen Annahmen in den folgenden Abschnitten noch auf den Grund gehen. Dabei wird sich zeigen, dass man bei genauerer Sichtung der empirischen Befundlage keineswegs den Eindruck gewinnt, Lob und Tadel hätten wirklich das Gewicht bei der Geschlechterdifferenzierung, das ihnen unterstellt wird. Bereits Maccoby und Jacklin haben in subtiler Weise die Probleme artikuliert, vor die man gestellt wird, wenn man ausschließlich der Konditionierungshypothese folgt (Maccoby & Jacklin, 1974). Generell monieren sie, dass die Wirksamkeit geschlechtstypischer Verstärkung häufig nur innerhalb eines Geschlechts geprüft wird. Man stellt dabei fest, welche Erziehungspraktiken ein als geschlechtstypisch geltendes Merkmal besonders prägnant hervortreten lassen und generalisiert daraus, dass die entsprechende Praxis überhaupt die Ursache für das Merkmal sei.
Wie problematisch ein solches Vorgehen sein kann, demonstrieren die Autorinnen an folgendem Beispiel: Eine stark strafende Erziehungshaltung begünstigt nachweislich Verhaltensweisen, die dem femininen Stereotyp zugehören, und zwar gleichermaßen bei Jungen wie bei Mädchen. Strafe »verweiblicht« also. Geht man nun davon aus, dass beide Geschlechter von Natur aus gleich sind, dann läge es nahe zu erwarten, dass Mädchen sich deshalb femininer als Jungen verhalten, weil sie von den Eltern häufiger gestraft werden. Tatsächlich war früher aber das genaue Gegenteil der Fall, wobei sich heute die Erziehungspraxis der Eltern wohl eher angeglichen hat (Endendijk, Groeneveld, Bakermans-Kranenburg & Mesman, 2016).
5.2 Erziehungspraxis der Eltern
Im Folgenden wollen wir nun prüfen, wieweit sich die Annahme belegen lässt, dass Eltern, Spielkameraden und sonstige Sozialisationsagenten bei Kindern ausschließlich oder bevorzugt Verhaltensweisen verstärken, die als geschlechtsangemessen gelten. Jungen würden dieser Theorie zufolge in erster Linie für selbstbewusstes, aggressives, leistungs-und wettbewerbsorientiertes Verhalten belohnt, Mädchen dagegen, wenn sie nett, entgegenkommend, fürsorglich und hilfsbereit sind, um nur die gängigsten Stereotype aufzugreifen. Sofern die Kinder ein nicht rollenkonformes Verhalten zeigten, müsste dies Ablehnung, Befremden, vielleicht gar Spott und Strafe hervorrufen.
Читать дальше