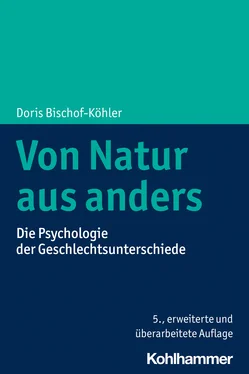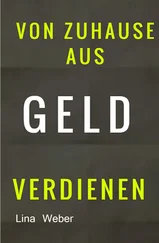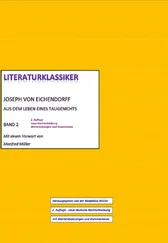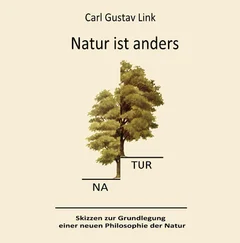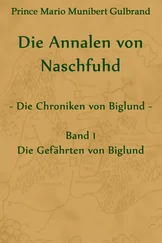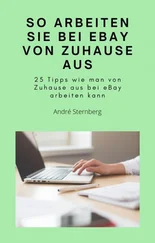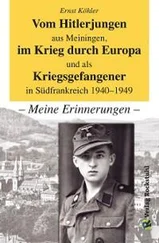Ob und wie sich Moral überhaupt legitimieren lässt, gehört zu den schwierigsten Fragen (Bischof, 2012). Ihre Beantwortung ist nicht Gegenstand dieses Buches, eins aber ist sicher: Naturgegebenheiten können nicht herangezogen werden, um daraus moralische Normen abzuleiten. Was auch immer wir beschließen, für richtig zu halten, es wird darunter immer auch Regeln geben, die sich gegen die Natur richten. So sind wir von Natur aus dazu angelegt, viele Kinder in die Welt zu setzen, und für viele Kulturen ist dies auch heute noch ein hoher moralischer Wert. Der dramatische Bevölkerungszuwachs legt den Weiterdenkenden aber nahe, dass eigentlich genau das Gegenteil, nämlich Geburtenkontrolle, angebracht wäre. Da wir die Umwelt, an die wir natürlicherweise angepasst sind, längst drastisch verändert haben, ist vieles, was unseren natürlichen Neigungen besonders entgegenkommen würde, unserem Wohlbefinden abträglich. Davon abgesehen wäre auch schon im Mittelalter niemand auf die Idee verfallen, den Zölibat für sittenwidrig zu halten, nur weil er dem natürlichen Geschlechtstrieb zuwiderläuft.
3.7 »Die Biologie legitimiert die Abwertung der Frau«
Ebenfalls mit dem Rückbezug auf die Veranlagung gerechtfertigt wird eine weitere, eine der folgenschwersten Maßnahmen der Gesellschaft. Sie betrifft die unterschiedliche Wertung der Geschlechter. Typisch weibliche Eigenschaften und Frauen überhaupt gelten in vielen Kulturen als minderwertig, während Tätigkeiten allein schon dadurch ein höheres Prestige erhalten, dass sie von Männern ausgeübt werden. Das muss nicht so sein, wie der Kulturvergleich zeigt. Aber aus Gründen, die noch genauer erörtert werden, ist die Gefahr, dass es zu einer Abwertung des weiblichen Geschlechts kommt, größer als umgekehrt. Es wird sich zeigen, dass es in der Tat bestimmte Unterschiede in der Veranlagung sind, die eine solche Entwicklung begünstigen, was aber natürlich wiederum nicht heißt, dass sie damit auch unvermeidlich oder gar legitim wäre.
Die Befürchtung, Anlageunterschiede könnten dazu missbraucht werden, eine Diskriminierung von Frauen zu rechtfertigen, kann gar nicht ernst genug genommen werden. Der berechtigte Wunsch, einer solchen Legitimierung den Boden zu entziehen, darf aber nicht so weit gehen, die wissenschaftliche Diskussionen über Anlageunterschiede einzuschränken oder gar zu verbieten, wie das bei Kreisen, die dem Gender Mainstreaming und den Gender Studies nahestehen, die Tendenz ist. Letztlich erweist man Frauen – und im Übrigen auch Jungen und Männern – keinen guten Dienst, wenn man wichtige Einsichten unterbindet und denjenigen, die sich mit den Auswirkungen biologischer Mechanismen befassen, fragwürdige Motive unterstellt. Bischof spricht in diesem Zusammenhang von einem »moralistischen« Trugschluss, in dem er das Pendant zum naturalistischen Trugschluss sieht (Bischof, 2012). Wenn etwas als moralisch nicht wünschenswert deklariert wird, dann besteht die Tendenz, seine Existenz überhaupt zu leugnen, »weil nicht sein kann, was nicht sein darf« (Morgenstern, 1909): Geschlechtsunterschiede gibt es nicht, weil man sie sonst zur Legitimation von Diskriminierung heranziehen könnte.
Es ist ein zentrales Anliegen dieses Buches, die Missverständnisse aufzuklären, die zu der hartnäckigen Fehleinschätzung biologischer Faktoren führen. Nur wenn wir vorbehaltlos auch über die biologischen Aspekte unserer Verhaltensorganisation Rechenschaft ablegen, werden wir eine Chance haben, bestehende Vorurteile abzubauen und den Schwächen beider Geschlechter wirksam gegenzusteuern. Ob daraus dann letztlich eine Angleichung resultieren sollte oder ob nicht vielmehr die Gleichbewertung bei beibehaltenen Unterschieden das Erstrebenswerte wäre, mag zunächst offen bleiben.
Teil I Theorien und ihre Evidenz
Wie im 1. Kapitel erwähnt, fordert Jeanne Block, man müsse immer erst ausloten, ob und wieweit Unterschiede auf die Sozialisation zurückzuführen seien, bevor man biologische Einflussfaktoren in Erwägung ziehen dürfe. Gegen dieses Postulat lässt sich, wie wir festgestellt haben, allerlei einwenden; es beruht auf einer höchst willkürlichen Festsetzung der Nullhypothese. Da es aber nicht viel einbringt, im Vorfeld der Sachfragen über Verfahrensregeln zu streiten, wollen wir auf die Forderung eingehen. Unterziehen wir also zunächst die zugunsten der Sozialisationsannahme anführbare Evidenz einer genaueren Betrachtung.
Es empfiehlt sich, dabei in zwei Schritten vorzugehen. Sozialisationsprozesse, die zu einer stabilen Polarisierung geschlechtstypischer Verhaltensstile führen, liegen nicht so offen zutage, dass sie von vornherein als trivial vorausgesetzt werden könnten. Man kommt also nicht umhin, sie in Form theoretischer Annahmen zu spezifizieren. Als Erstes wäre demnach zu klären, welche theoretischen Standpunkte in diesem Problemkomplex überhaupt vertreten worden sind. In einem zweiten Schritt wollen wir sodann die Befunde überprüfen, die mit den vorgestellten Theorien im Einklang oder auch im Widerspruch stehen. Auf diese Weise erhalten wir eine Anschauungsgrundlage, auf deren Basis wir beurteilen können, wieweit die Annahme soziokultureller Verursachungen ihre Bestätigung findet und wo sie gegebenenfalls an Grenzen stößt.
Die Theorien zur Übernahme der Geschlechterrolle, die in der Fachwelt diskutiert werden und mehr oder weniger auch Akzeptanz gefunden haben, lassen sich an einer Hand abzählen. Es handelt sich im Wesentlichen um die Theorie Freuds, die abgesehen von einigen kritischen Modifikationen auch von seinen Anhängern vertreten wird, ferner um lerntheoretische Erklärungsansätze, die zum einen im Rahmen der Bekräftigungstheorie formuliert wurden, zum anderen in der Theorie des sozialen Lernens die Rolle der Imitation betonen, und schließlich um den kognitivistischen Ansatz von Lawrence Kohlberg mit seiner Fortführung in der Genderschema-Theorie.
4 Freud und die Folgen
4.1 Ödipus- und Kastrationskomplex
Aus historischen Gründen sei die Theorie Sigmund Freuds an erster Stelle behandelt, wobei wir uns darauf beschränken wollen, seine Überlegungen soweit zu skizzieren, wie es erforderlich ist, um seinen Einfluss auf die anderen zu erörternden Ansätze verständlich zu machen. Ein weiterer Grund, warum Freud nicht unerwähnt bleiben darf, ist seine unverkennbar abwertende Haltung dem weiblichen Geschlecht gegenüber. Diskriminierende Argumente bei den nachfolgenden Generationen haben nicht selten bei ihm ihren Ursprung.
Freud hat sich in erster Linie mit der männlichen Entwicklung befasst, während er sich zur weiblichen wohl nur auf Drängen von Mitarbeiterinnen gegen Ende seines Lebens mehr anekdotisch äußerte. Zwar betont er, dass diese Äußerungen nur vorläufigen Charakter haben; da man aber in seiner Anhängerschaft dazu neigt, seine Worte prinzipiell für verbindlich zu halten, haben diese Bemerkungen gleichwohl ihren – zum Teil eben wenig erfreulichen – Einfluss ausgeübt (Freud, 1925).
Freud misst – bei Jungen und Mädchen gleichermaßen – zwei Ereignissen im Alter zwischen drei und fünf Jahren besondere Bedeutung für die Ausbildung des Geschlechtsrollenverständnisses zu. Einmal handelt es sich darum, dass Kinder die anatomischen Unterschiede entdecken, wobei die Feststellung, dass Mädchen keinen Penis haben, für beide Geschlechter gravierende Folgen haben soll. Den zweiten wichtigen Vorgang in diesem Altersabschnitt sieht Freud darin, dass »die Libido die Genitalregion besetzt«, dass also die Genitalien erstmals zum Zentrum lustvoller Erregung werden.
Bekanntlich nimmt Freud eine allgemeine Triebenergie an, die er »Libido« nennt. Am Beginn des Lebens sei diese zunächst auf den oralen Bereich fixiert, weil Nahrungsaufnahme so ziemlich das Einzige ist, wobei ein Säugling schon eigene Aktivität entwickelt. Darin ist ein elementarer Symmetriebruch grundgelegt: Für Jungen ebenso wie für Mädchen wird die Mutter als Vermittlerin der Nahrung zum ersten Beziehungsobjekt. Es folgt dann die anale Phase, in der die Ausscheidungsorgane in den Fokus des Erlebens rücken, und schließlich die sogenannte phallische oder genitale Phase, in der die Triebenergie erstmals eine sexuelle Orientierung im eigentlichen Sinn erhält. Der gegengeschlechtliche Elternteil erscheint jetzt als begehrenswert. Dadurch gerät nun aber die Beziehung zu den Eltern in eine Krise.
Читать дальше