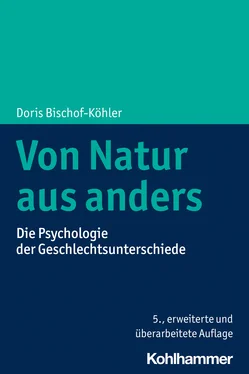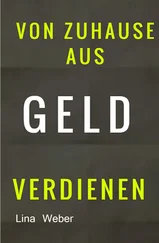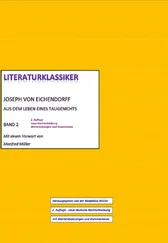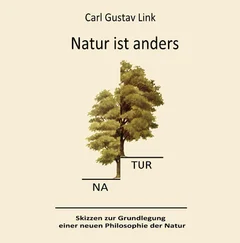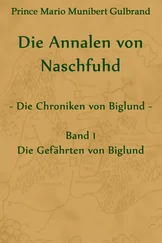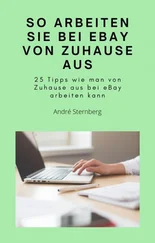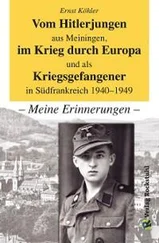4.3 Kritische Anmerkungen
Auf den Punkt gebracht, beruht für Freud die Übernahme der Geschlechtsrolle auf der Identifikation mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil, wobei diese Identifikation dazu dienen soll, dessen Rache dafür, dass man seinen Partner sexuell begehrt, abzuwenden. Der Mechanismus der Identifikation ist insofern für unsere weiteren Überlegungen wichtig, als er erklären würde, wie Kinder dazu kommen, sich auf den gleichgeschlechtlichen Elternteil auszurichten, ihn als Modell für ihr Verhalten zu bevorzugen und sich damit geschlechtsangemessen zu orientieren.
Im Übrigen ist der Erklärungswert der Theorie mit vielen Fragen behaftet, auf die im Folgenden kurz eingegangen wird. So führt Asendorpf gegen Freud an, dass geschlechtstypisches Verhalten, falls es denn allein durch Identifikation mit dem gleichen Elternteil zustande käme, eine viel größere Stilähnlichkeit zwischen Söhnen und Vätern bzw. Töchtern und Müttern erkennen lassen müsste, als sich in der Realität beobachten lasse (Asendorpf, 1996). Auch erklärt Identifikation kaum, wieso Geschlechtsunterschiede bereits lange vor der ödipalen Phase auftreten. Des Weiteren ist einzuwenden, dass es zwar eine Vielzahl von Aufsätzen zum Ödipuskomplex in Fachzeitschriften gibt, diese Aufsätze aber keine kritische Prüfung der Existenz des Ödipuskomplexes darstellen. Sie sind lediglich persönliche Überlegungen oder einzelne Fallstudien zur Ausgestaltung des Komplexes von Patienten, deren Rezeption den Glauben an seine Existenz voraussetzen. Dagegen liefern die nur wenigen kritischen Überprüfungen keine überzeugenden Befunde, die das Auftreten des Ödipus- und des Elektrakomplexes bzw. des Penis- und des Gebärneids im einschlägigen Alter belegen (Goldman & Goldman, 1982, Roos & Greve, 1996, Bischof, 1985). Für manche Kinder ist es zwar beunruhigend, wenn sie die anatomischen Unterschiede entdecken, und sie legen sich hierzu in der Tat eigene Erklärungen zurecht, wie etwa: der Penis der Mädchen sei kleiner, würde noch wachsen, sei abgeschnitten, irgendwie seien Mädchen komisch, nicht richtig, anders. Nun halten Kinder im Vorschulalter aber alle äußeren Merkmale der Erscheinung einer Person für wandelbar und machen dabei, wie unten noch zu zeigen sein wird, auch nicht vor den Geschlechtsattributen halt. Vor diesem Hintergrund bereitet es Mühe, sich vorzustellen, dass die Entdeckung des anatomischen Geschlechtsunterschieds im Normalfall traumatische Auswirkungen haben soll, die dann auch noch geeignet sind, daraus gesetzmäßig die gesamte Geschlechtsrollenübernahme und gar noch die Gewissensbildung abzuleiten.
Freud hat seine Folgerungen über die kindliche Entwicklung weitgehend aus Berichten erwachsener Patienten mit psychischen Problemen rekonstruiert. Nur in einem Fall bestand seine Induktionsbasis in Gesprächen mit einem Vorschulkind, das über seine Ängste berichtete (Freund, 1909). Die empirische Evidenz steht also auf schwachen Beinen. Dieser Mangel wird von psychoanalytischer Seite gern mit dem enormen Verdrängungspotential begründet, das sich daraus ergäbe, dass den gegengeschlechtlichen Elternteil zu begehren so ungeheuer unstatthaft und dieses Begehren bei Erwachsenen daher unbewusst sei. Nun mögen in den Trauminhalten erwachsener Patienten, die aus psychoanalytischer Sicht einer der Königswege zum Unbewussten sind, ja durchaus auch Bilder geschlechtlicher Vereinigung mit – im Übrigen – beiden Elternteilen auftauchen. Aber bedeutet das allein schon, dass sich darin Kindheitswünsche und -ängste widerspiegeln müssen? Könnten Träume dieser Art nicht vielmehr auch eine Möglichkeit darstellen, metaphorisch und symbolisch ganz andere als sexuelle Motivkonflikte zum Ausdruck zu bringen?
4.4 Bindung ist nicht gleich Sexualität
Damit klingt bereits ein viel grundsätzlicherer Einwand an. Er wendet sich gegen eine der wenigen Thesen, an denen Freud bis zum Schluss mit unbeirrbarer Hartnäckigkeit festgehalten hat und in gleicher Weise ein Großteil von Psychoanalytikern unter seiner Anhängerschaft – die These von der Homogenität der Liebe, konkreter: die Gleichsetzung von Sexualität und Bindung. Jeder, der bereit ist, bei einem so allgemeinbiologischen Sachverhalt wie der Sexualität auch aus der Beobachtung tierischer Lebensformen zu lernen, sieht sich mit dem offensichtlichen Tatbestand konfrontiert, dass die Motivation, sich affektiv an den Sexualpartner zu binden, seine Nähe zu suchen und ihn zu unterstützen, vom Fortpflanzungstrieb unabhängig sein muss. Viele Tiere leben in eheähnlichen Gemeinschaften, die über viele Jahre erhalten bleiben, obwohl die sexuelle Brunftzeit sich nur auf einen kleinen Ausschnitt des Jahres erstreckt (Bischof, 1985; Bischof-Köhler, 2011).
Auch das von Freud in Anspruch genommene Faktum des Inzestwunsches spricht, richtig betrachtet, nicht für, sondern gerade gegen die Homogenität: Wie schon Westermarck (1891) richtig vermutet hat, stellt gerade die frühe Bindung des Kindes an seine Eltern nicht eine Vorbereitung, sondern eine entscheidende Hemmung der Sexualität dar. Am eindrücklichsten belegen dies Beobachtungen in israelischen Kibbuzim. Lange Zeit war es in Kibbuz-Gemeinschaften üblich, Kinder gemeinsam mit Gleichaltrigen in einem »Kinderhaus« aufzuziehen. Die Kinder waren also zwar mehrheitlich nicht verwandt, aber von Geburt an miteinander vertraut. Wie Shepher in einer eingehenden Recherche aufzeigen konnte, genügte diese Vertrautheit, um zu verhindern, dass unter den Betroffenen auch nur eine einzige eheliche Verbindung eingegangen wurde, obwohl niemand auf den Gedanken gekommen wäre, ihnen das auszureden, da sie ja nicht verwandt waren (Shepher, 1983). Die Vertrautheit von früher Kindheit an fungiert unter normalen Entwicklungsbedingungen als sicheres Hemmnis für die erotische Anziehung. Das gilt nicht nur zwischen Geschwistern, sondern auch für das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern. Bei Inzest sowohl zwischen Eltern und Kind als auch zwischen Geschwistern liegen häufig beim Initiator des Inzests Bedingungen vor, die den Aufbau einer Eltern-Kind-Beziehung oder Geschwisterbeziehung erschweren. Zu diesen Bedingungen zählen etwa eigene Vernachlässigungs- und Missbrauchserfahrungen (Griffee et al., 2016; Seto et al., 2015). Besonders offenkundig ist die Auswirkung fehlender – gewöhnlicherweise seit der frühen Kindheit bestehender – enger Vertrautheit bei Inzest, der durch Stiefeltern oder Stiefgeschwister initiiert wird.
4.5 Feministische Alternativen
Der unverblümt diskriminierende Unterton der Theorie Freuds, bei dem sich zu seinen Lebzeiten kaum jemand etwas dachte, hat später zunehmend Anstoß erregt und dazu geführt, dass einige von Freuds Schülern und vor allem Schülerinnen Vorstellungen entwickelten, die explizit frauenfreundlicher ausfielen und dafür im Gegenzug das männliche Geschlecht problematisierten.
Am bekanntesten unter diesen ist Nancy Chodorow geworden (Chodorow, 1978). Für sie stellt sich das Bild etwa wie folgt dar: Auch hier, darin gleicht ihr Ansatz dem Freuds, bildet die Mutter als natürliche Quelle von Nahrung und Geborgenheit das primäre Bindungsobjekt für Kinder beiderlei Geschlechts. Beide unterscheiden sich daher auch zunächst nicht im Stil des Verhaltens und Erlebens – sie suchen gleichermaßen Bindung, Verschmelzung, emotionale Wärme. Alsbald beginnt jedoch die Mutter, den anatomischen Unterschied zwischen Sohn und Tochter zum Angelpunkt diskriminativen Verhaltens zu machen: Sie erlaubt der Tochter, die ihr als Erweiterung ihres eigenen Selbst erscheint, weiterhin an der Mutter-Kind-Symbiose zu partizipieren, während sie den Sohn mehr und mehr als andersartig erlebt und ihn dies auch spüren lässt. Mit dieser Deprivation kann der arme Kerl nur dadurch fertig werden, dass er hart wird, sich fortan seinen Gemütsbedürfnissen verschließt und jede empathische Anwandlung unterdrückt, da ihn diese ja nur wieder dazu verführen würde, sich jene emotionale Verschmelzung zu erhoffen, die ihm von der Mutter verwehrt bleibt.
Читать дальше