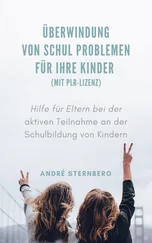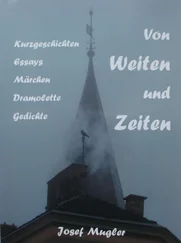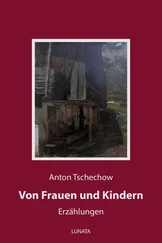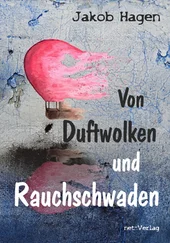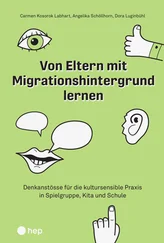Dass die bis hierher erwähnten – der nomothetischen Vorgehensweise zuzurechnenden – Gütekriterien nur eingeschränkt verwendet werden können, ist augenscheinlich. Insofern sollte man die Beobachtung zukünftig eher als qualitativen Beschreibungsprozess ausweisen und nicht versuchen, dessen Methodik in vollständige Übereinstimmung mit dem quantitativ orientierten nomothetischen Paradigma zu bringen. Stattdessen bieten sich folgende Merkmale für die Bestimmung und Verbesserung der Güte qualitativen Vorgehens an:
• die strukturierte Verfahrensdokumentation
• regelbezogene Datenverarbeitung
• argumentative Absicherung der Interpretation
• profunde Kenntnis und Kompetenz in Bezug auf den Untersuchungsgegenstand sowie
• Triangulation 7(Flick, 2011; Klein & Sauer-Kramer, 2017 und im Überblick: Mayring, 2016; Döring & Bortz, 2016).
• Timesampling: Bei diesem Verfahren wird der Zeitstrom in kurze, kontinuierlich aufeinanderfolgende Zeiteinheiten, deren Grenzen für den Beobachter klar erkennbar sind, aufgeteilt. Diese Intervalle nennt man Einheitsintervalle. Entschieden wird bzgl. jedes Einheitsintervalls, ob im Voraus definiertes Verhalten in dem Intervall auftritt oder nicht und dies unabhängig von dessen Auftretenshäufigkeit nach dem Alles-oder-Nichts Prinzip codiert.
• Eventsampling: Es wird die Auftretenshäufigkeit eines vorher definierten Verhaltens in einer festgelegten Zeitspanne erfasst.
• Rating-Verfahren: Die Auswertenden schätzen den Ausprägungsgrad einzelner oder komplexer Verhaltensweisen ab und bewerten diesen anhand einer Messskala. Das Rating-Verfahren ist in der Interaktionsbeobachtung die am häufigsten angewandte Methodik, da dessen Vorteile, nämlich die relativ leichte Handhabung und die meistens hohe Plausibilität bei einem ansonsten hoch komplexen und dynamischen Geschehen, in der Praxis überzeugen. Dennoch oder gerade deshalb soll an dieser Stelle auch auf die kritischen Aspekte eingegangen werden.
Diskussion der Skalenniveaus
Aus messmethodischer Sicht ist zu konstatieren, dass die Skalenniveaus häufig nicht expliziert sind und sich in der Regel kaum anspruchsvoller als ordinalskaliert erweisen. Dennoch kommt es nicht selten zu Verrechnungen von Itemwerten, die eigentlich für andere Skalenniveaus bestimmt sind. Beschäftigt man sich mit der Bedeutungshaltigkeit der Ratings (Semiotik) fällt die oft stark variierende Interraterbeurteilung trotz Trainings und Instruktion auf. Dies schränkt die Generalisierbarkeit, Prognose und Stabilität des Urteils erheblich ein. Einige Ratingskalen bleiben zudem unklar in der Unterscheidung von zu beobachtendem Verhalten und dessen Interpretation. Nicht nur das Verhalten, sondern auch die daraus abgeleiteten Schlussprozesse auf zugrunde liegende Einstellungen o. ä. müssten daher möglichst eindeutig in den Anleitungen beschrieben und in Trainings geübt werden, um Bedeutungsverzerrungen und vorschnellen Schlüssen entgegenzuwirken.
2.4 Beobachtung der nonverbalen und verbalen Kommunikation
Systematische Beobachtung erstreckt sich auf die Erfassung der nonverbalen sowie der para- und verbalen Kommunikation.
 Beobachtung nonverbalen Verhaltens
Beobachtung nonverbalen Verhaltens 
Die Beobachtung des nonverbalen Verhaltens orientiert dabei auf die Aspekte von Körperhaltung, Bewegung und Gesichtsausdruck. Auf Haltung und Bewegung fokussiert beispielsweise William Donaghi (1989, S. 298–300) und unterscheidet zwischen »generischen« Kodierungen (beziehen sich auf alle wichtigen Gesten und Verhaltensweisen), »restriktiven Kodierungen« (Erfassung vorher festgelegter, ausgewählter und sehr differenziert beschriebener Gesten und Verhaltensweisen) und der »direktiven Evaluation« (welche nicht mehr das direkt beobachtbare Verhalten erfasst, sondern dessen Interpretation – wie z. B. Traurigkeit anstelle von herabgezogenen Mundwinkeln). Diese Vorgehensweisen beschreiben und bewerten in der Regel die Verhaltensweisen einzelner Personen.
Frey und Hirsbrunner (nach Gehrau, 2002, S. 176) entwickelten dagegen das Berner Time-Series Notation System (TNS), das nicht die Ausdrucksweisen des Einzelnen, sondern die Veränderung der Situation erfasst. Mit Hilfe dieses Kodiersystems werden die Körperpositionen dann festgehalten, wenn sie sich verändern. Dieses Verfahren reduziert die Kodes erheblich und bewertet diese zusätzlich anhand einer siebenstufigen Skala. SoftReturn
Fast alle diese Verfahren sind sehr aufwändig und erhielten bisher kaum Einzug in die Praxis.
Der Analyse des Gesichtsausdrucks wurde bis heute bei der Bewertung kommunikativ bedeutsamer nonverbaler Handlungen das größte Augenmerk geschenkt, gilt dieser doch als Spiegel der Emotionen. So entwickelten beispielsweise die Emotions- und Ausdrucksforscher Paul Ekman und Wallace V. Friesen Ende der 1980er Jahre die »Facial Affect Scoring Technique« (FAST), die sie im weiteren Verlauf modifizierten. Die neueste Variante ist als »Facial Action Coding System« (FACS) bekannt (Kurzbeschreibung z. B. in Gehrau, 2002; Original: Ekman, Friesen & Hager, 2002). Sachkundige, die nach diesem System arbeiten, werden sehr intensiv geschult und erst nach dem Erreichen eines Reliabilitätswertes von 0,8 für die selbständige Beurteilung zugelassen.
Die nicht-inhaltlichen Aspekte der verbalen und paraverbalen Kommunikation werden über die Stimm- sowie die Interaktionsanalyse untersucht.
 Beobachtung verbalen Verhaltens
Beobachtung verbalen Verhaltens 
Stimmanalyse: Da Stimmqualität, Stimmhöhe, Stimmumfang und Timbre sehr invariante Merkmale einer Person mit zugleich hohem emotionalem Gehalt darstellen und zudem erheblich zwischen den Personen variieren, lassen sich Veränderungen beim Einzelnen verhältnismäßig eindeutig abbilden und auch interpretieren. Die Analysen können durch Menschen oder mit Hilfe von elektro-akustischen Techniken erfolgen (Kaufmann & Baumann, 2015). Bisher verwendete Analyseverfahren sind nach Kenntnisstand des Autors bisher nicht für die Praxis außerhalb der Forschung entwickelt worden.
Interaktionsanalyse: Die nicht inhaltsbezogene verbale Interaktionsbeurteilung erfasst in der Regel formale Parameter von Sprechakten, wie z. B. Häufigkeit und Länge der Rede (Chappel, 1940). Einen Übergang zu semantischen Relationen der Sprache unternahm Robert Bales seit Beginn der 1970er Jahre (Bales, 1972). Nach mehreren Reduktionsstufen liegt heute ein Analyseinstrument mit insgesamt 12 Ausprägungen in vier Bereichen vor, das vorwiegend zur Beurteilung des Gesprächsverhaltens in Kleingruppen eingesetzt wird. Weil es in diesem Feld bemerkenswerte Anregungen liefert, sei es an dieser Stelle kurz (nach Gehrau, 2002, S. 185 f.) skizziert:
• positive Reaktionen im sozialemotionalen Bereich mit den Ausprägungen: (1) zeigt Solidarität, (2) entspannte Atmosphäre, (3) stimmt zu,
• Versuch, Fragen zu beantworten, mit den Ausprägungen: (4) Vorschläge machen, (5) Meinung äußern, (6) orientieren,
• Fragen mit den Ausprägungen: (7) erfragt Orientierung, (8) fragt nach Meinung, (9) erbittet Vorschläge,
• negativer sozialemotionaler Bereich mit den Ausprägungen: (10) stimmt nicht zu, (11) zeigt Spannung, (12) zeigt Antagonismus.
Jeweils zwei der 12 Verhaltensweisen bilden die Pole einer Dimension.
Читать дальше
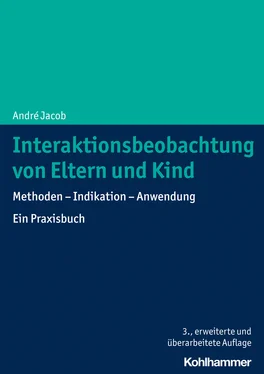
 Beobachtung nonverbalen Verhaltens
Beobachtung nonverbalen Verhaltens