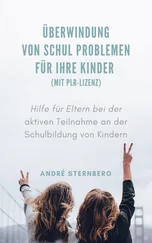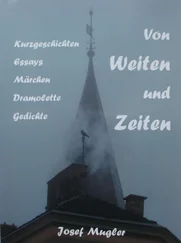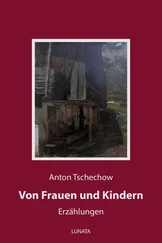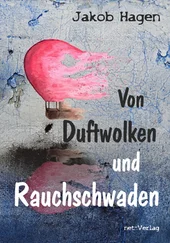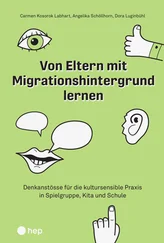Entwicklungsadäquanz
Entwicklungsadäquanz 
5. Bindungsqualität: Diese Kategorie scheint in der Fachliteratur nicht vollständig ausdefiniert zu sein, weil in der Regel unklar bleibt, ob beobachtbares kindliches Bindungsverhalten beschrieben wird (was ja eher der Perspektive des Kindes zuzurechnen wäre) oder ob es sich tatsächlich um eine neue bidirektionale Gesamtqualität handelt, wofür die Autorinnen und Autoren auf die klassischen Bindungsmusterbegriffe bzw. die dazu passenden elterlichen Verhaltensweisen zurückgreifen.
 Bindungsqualität
Bindungsqualität 
6. »Joint attention « (auch »geteilte Aufmerksamkeit«) »wird als Anzeichen einer triadischen Interaktion gewertet, weil Mutter, Kind und Objekt beteiligt sind, auf das beide fokussieren. […] Baron-Cohen […] interpretiert dies als einen Hinweis auf ein erstes Verständnis mentaler Zustände. Das Kind verstehe, dass die Mutter seine Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Objekt hinlenken möchte. Im umgekehrten Fall möchte das Kind die Mutter dazu bringen, dasselbe zu sehen wie es selbst, um ihre Aufmerksamkeit mit ihm zu teilen« (Bischof-Köhler, 2011, S. 248; vgl. auch Pauen, Frey & Ganser, 2012, S. 31; Siposova & Carpenter, 2019).
 Joint attention
Joint attention 
Diese Kategorien bilden – bis auf die der Entwicklungsadäquanz, die wohl eher der Elternperspektive zuzurechnen ist – eine erste Anregung zur weiteren Erforschung und fundierten Beschreibung der Eltern-Kind-Beziehung, wurden jedoch bisher wissenschaftlich noch nicht so weitgehend operationalisiert, dass eindeutige Beobachtungsindikatoren ableitbar sind.
1.1.3.3 »Beziehung« als »Gesamtindex«
 Care-Index
Care-Index 
Mit dem CARE-Index geht Patricia Crittenden (2005) schließlich einen dritten Weg, indem sie eine Art Gesamtindex aus verschiedenen Teilurteilen bestimmen lässt. Die entsprechenden Bewertungsvarianten der Beziehung lauten in diesem Fall: »sensitiv«, »adäquat«, »unbeholfen« oder »gefährdet«. Diese Beurteilungen scheinen deutlich aus der Perspektive der Eltern und mit dem Fluchtpunkt der kindlichen Entwicklung(-sgefährdung) formuliert zu sein (  Kap. 4.1).
Kap. 4.1).
Es scheint plausibel, will man die Beziehung als Entität beurteilen, ein Beurteilungsziel wie die »Förderung bzw. Behinderung dieser oder jener entwicklungspsychologischen Kategorie des Kindes« zu implementieren. Aus pragmatischer Sicht verweist ein solches Vorgehen deutlich auf die Auswahl von Interventionszielen und -methoden. Allerdings stellt sich dann auch die Frage, ob es überhaupt noch einer holistischen Beziehungseinschätzung bedarf oder ob diese Einschätzung in die Beurteilung des Elternteils mit aufgenommen werden kann.
1.1.4 Perspektive »Elternbeziehung«
In zahlreichen Veröffentlichungen werden »elterliche Erziehungspartnerschaft«, »Eltern-Allianz« oder »Co-Parenting« als Beziehungstypus beschrieben (z. B. Gabriel & Bodemann 2006, Asendorpf, Banse & Neyer, 2017; Teubert, 2011). Allerdings findet sich einzig im Lausanner Trilogspiel (Fivaz-Depeursinge & Corboz-Warnery, 1999; Schwinn & Borchardt, 2012; Schröck & Eickhorst, 2019) eine ausgefeilte Dramaturgie zur Durchführung und zur Beschreibung der elterlichen Interaktion in triadischen Kontexten. Zur Beurteilung gelangen bei diesem Vorgehen die folgenden Kriterien, die in den  Kap. 4.1und
Kap. 4.1und  Kap. 7.4noch ausführlicher vorgestellt werden:
Kap. 7.4noch ausführlicher vorgestellt werden:
1. gegenseitige Unterstützung und Kooperation, Co-Parenting
2. Konflikte und Interferenzen
3. kommunikative Fehler und ihre Reparatur, Dynamik der Interaktion in Bezug auf den Elternpartner
1.2 Formale Operationalisierung
Bisher sind inhaltliche Kategorien für die Eltern-Kind-Interaktion herausgearbeitet worden. Für deren formale Operationalisierung empfiehlt es sich nun, jede Kategorie möglichst in gleicher Art zu differenzieren. Ein aus Sicht des Autors geeigneter Vorschlag stammt von Patry und Perrez (2003), die vier Bewertungsaspekte unterscheiden:
1. Quantität: Ist das Beobachtete zu viel (Exzess) oder zu wenig (Defizit) ausgeprägt?
2. Modus: In welcher Art und Weise wird operiert (z. B. körperlich, verbal, mimisch)?
3. Angemessenheit: Ist das Handeln in Bezug auf das Ziel (z. B. altersentsprechende Beruhigung des Kindes) angemessen?
4. Kontinuität: Tritt das beobachtbare Verhalten kontinuierlich auf (i. S. von verlässlich bzw. ausrechenbar für das Kind) oder diskontinuierlich?
Diese Bewertungsaspekte eignen sich nunmehr, um aus den inhaltlich-funktionalen Kategorien beobachtbare Indikatoren zu operationalisieren.
Wie bereits mehrfach erwähnt, sind nicht immer eindeutige Zuordnungsregeln bestimmbar; entweder weil das gleiche Verhalten verschiedenen Zwecken dient oder aber weil Verhalten selbst mehrdeutig ist. Die bisher am häufigsten benannten oder die am plausibelsten gelisteten Indikatoren in den jeweiligen Perspektiven werden ausschnittsweise in der folgenden Übersicht zusammengetragen. Allerdings lassen sich Überschneidungen mit den zuvor aufgeführten funktionalen Kategorien nicht vollständig vermeiden.
1.3 Beispiele für Indikatoren zur Beschreibung der Eltern-Kind-Interaktion
1.3.1 Perspektive des Kindes
Die folgenden Indikatoren helfen, die beim Kind zu beobachtenden Verhaltensmerkmale zu erfassen:
• Vitalität: Aktivierung und Wachheit
• Augenkontakt: Vermeidung, Aufrechterhaltung, Beendigung
• Körpergestik (speziell soziale Gesten): Vermeidung, Aufrechterhaltung, Beendigung, Zielorientierung
• Lautsignale (verbal, paraverbal)
• Spiel: Initiative, Aufrechterhaltung, Beendigung, Spielarten
• Ausrichtung der Aufmerksamkeit
• Reaktivität (Folgeverhalten)
• Initiative
• Verhalten bei Übergängen
• Affektausdruck (mimisch/gestisch/vokalisierend/dynamisch…) in Bezug auf: Teilnahme, Interesse, Ärger, Traurigkeit, Ängstlichkeit, Unsicherheit, Irritation, Aufmerksamkeit, Zufriedenheit, Freude, Ekel, Scham usw.
• Affektsharing (Spiegelung und Abstimmung)
• Affektregulation
1.3.2 Perspektive des Elternteils
Indikatoren, die vorwiegend das elterliche Verhalten in Bezug auf das Kind markieren, enthält die folgende Aufzählung:
• Rahmung: Zeit- und Lagestrukturgebung
• Affektausdruck (mimisch/gestisch/vokalisierend/dynamisch/etc.) in Bezug auf: Teilnahme, Interesse, Ärger, Traurigkeit, Ängstlichkeit, Unsicherheit, Irritation, Aufmerksamkeit, Zufriedenheit, Freude, Ekel, Scham usw.
Читать дальше
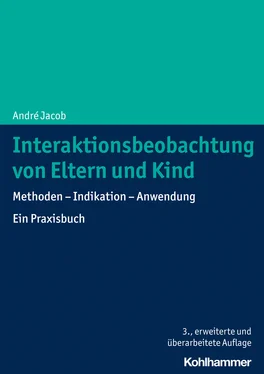
 Entwicklungsadäquanz
Entwicklungsadäquanz