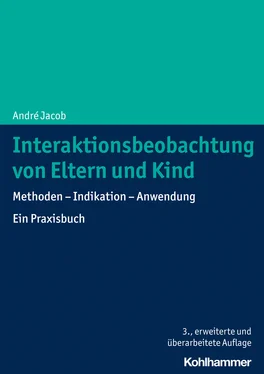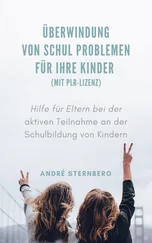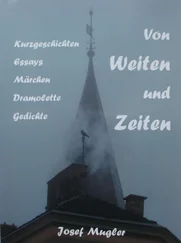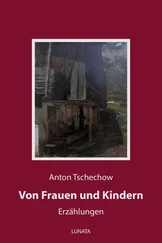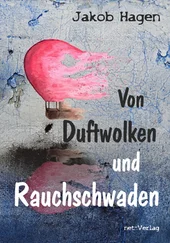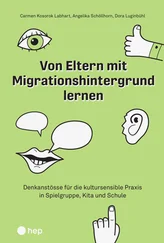3. der Entwicklung von »Autonomie« des Kindes (vs. Abhängigkeit) (vgl. z. B. Keller & Chasiotis, 2008; Keller, 2011)
4. der Entwicklung von Interdependenz (»Bezogenheit vs. Unbezogenheit«) (vgl. z. B. Keller & Chasiotis, 2008; Keller, 2011; Lohaus, Ball, & Lißmann, 2004)
5. der Entwicklung kognitiver und exekutiver Funktionen des Kindes (z. B. Berger, 2010; Lepach, Lehmkuhl, & Petermann, 2010; Pletschko et al., 2020)
6. der Entwicklung perzeptiver und motorischer Funktionen sowie der sensomotorischen Integration (z. B. Karnath & Thier, 2012; Pletschko et al., 2020)
7. der Entwicklung selbstregulativer Kompetenzen insbesondere der Impulskontrolle und der Affektregulation (z. B. Papoušek, 2012; Klinkhammer & von Salisch, 2015)
Diese zentralen entwicklungspsychologischen Themen sind teilweise verschränkt, jedoch (noch) nicht durch ein gemeinsames theoretisches Konzept gerahmt. Deshalb kann diese Aufzählung auch keineswegs als abgeschlossen gelten. Dennoch stellt sie den »Fluchtpunkt« interaktioneller Diagnostik in Bezug auf das Kind dar.
1.1.2 Perspektive »Elternteil«
Ebenfalls funktional betrachtet, denn dies wird quasi genuin aus dem Begriff »Elternschaft« definiert, stehen mit Blick auf ein Elternteil die folgenden – sich zum Teil ebenfalls überschneidenden – Themen im Fokus von Interaktionsbeobachtung:
1. Rahmung und Sicherung der Interaktionsepisode, insbesondere durch Strukturgebung in Raum und Zeit, Instruktion und Antizipation von Handlungen
2. Vermittlung von Sicherheit, insbesondere durch Gestaltung des affektiven Klimas (Wärme und Geborgenheit), durch Schützen und Trösten
3. Regulationshandlungen und Förderung selbstregulativer Handlungen des Kindes bei Stress, bei positiven, negativen und ambivalenten kindlichen Signalen, auch bei »Übergängen« (insbesondere durch affektregulierende Handlungen)
4. Unterstützung und Förderung des Kindes in Bezug auf dessen Autonomie- (Exploration), Bezogenheits- (Nähe) und Erholungswünsche
5. Unterstützung und Förderung des Kindes in Bezug auf dessen Mentalisierung; insbesondere durch Affektmarkierung und -spiegelung, durch Unterstützung des kindlichen Symbolspiels (im »Als-ob-Modus«) sowie die Kommunikation mit dem Kind über dessen Gedanken, Fantasien und die dadurch ausgelösten Empfindungen (dem sog. »psychischen Äquivalenzmodus« vgl. Kalisch, 2012; nach Gergely im Überblick z. B. Kohlhoff, 2018; Taubner & Wolter, 2016; Taubner, Fonagy & Bateman, 2019)
6. Unterstützung des prozeduralen Lernens (Papoušek & Papoušek, 1999, S. 121 f.)
7. Korrektur eigener kommunikativer Fehler und Missverständnisse
1.1.3 Perspektive der »Eltern-Kind-Beziehung« als Entität
Bei der Annäherung an diese Perspektive lassen sich mindestens drei verschiedene Zugänge voneinander unterscheiden.
1.1.3.1 Versuche, Beziehung mit Hilfe musikalischer Qualitäten zu beschreiben
Die Autorinnen des Eltern-Kind-Interaktionsprofils (EKIP) (Ludwig-Körner, Alpermann & Koch, 2006) und deren österreichische Vorgängerinnen (Cizek & Geserick, 2004) beschreiben das Eltern-Kind-Wechselspiel als eine eigene Qualität. Dass sie sich dafür an Metaphern aus der Musik bedienen, lässt den Ansatz einerseits nachvollziehbar und praktikabel scheinen, deutet aber zugleich auf ein begriffliches und damit auch theoretisches Defizit der Psychologie der Beziehung hin.
Die Autorinnen unterscheiden drei Beziehungsqualitäten, auf die weiter unten in 
Kap. 7.3
. sowie in der 
Anlage 3
noch ausführlicher eingegangen wird:
1. Qualität der Grundmelodie bzw. Tonart: Tonalität vs. Atonalität, Balance, Harmonie vs. Disharmonie, Kongruenz vs. Dyskongruenz, Synchronizität vs. Dyssynchronizität
2. Grundrhythmus: Tempo (Allegro oder Adagio), »Speed«, Frequenz der Signalemission
3. Lautstärke: Wie laut und kräftig sind die Äußerungen? (Pianissimo bis Fortissimo), Temperament, Stärke, Kraft, Energielevel beider Dialogpartner
1.1.3.2 Beschreibung der »Eltern-Kind-Beziehung« mittels psychologischer Termini
1. Passung: Der Begriff der »Passung« kann nicht ohne seine funktionale Bedeutung definiert werden. Demnach ist jeweils die Frage zu beantworten, wozu denn die Passungsherstellung dient. Dies soll an einem Beispiel erläutert werden: Die Betrachtung einer Eltern-Kind-Fütter-Episode kann z. B. unter der Fragestellung erfolgen, ob es Elternteil und Kind gelingt, den Hunger des Kindes zu stillen. Die Beobachtung wird in diesem Fall auf Sättigungszeichen des Kindes gelenkt. Erst in zweiter Linie ist dann vielleicht von Interesse, wie effizient die Fütterung durch den Erwachsenen erfolgte. Eine Frage, die sich dagegen nicht selten bei essgestörten Eltern stellt, ist ob und inwiefern diese in der Fütter-Episode Schwierigkeiten haben, die kindlichen Affekte angemessen zu spiegeln. Weitere Fragestellungen sind denkbar. Ferner ist es erforderlich, die Passung in verschiedenen Situationen zu beobachten. Ritterfeld und Franke (1994/2009 und neuerdings: Franke & Schulte-Hötzel, 2019) inszenieren hierfür Aufgaben, die zum einen Stress evozieren und zum anderen emotionale Abstimmung und Kooperation erfordern. Die Passung kann dabei natürlich sehr unterschiedlich ausfallen. Mit Blick auf eine Gesamteinschätzung ist daher zu fragen, wie und wozu der Passungsbegriff verwendet werden kann. Ein einfaches quantitatives Urteil reicht nicht aus, da es unterschiedliche Interaktionshandlungen unzulässig miteinander verrechnen würde.
 Passung
Passung 
2. »Interaktionsverantwortung« legt den Fokus darauf, wer die Führung in welcher Interaktionsepisode sowie im gesamten Interaktionsprozess übernimmt (Franke & Schulte-Hötzel, 2019, in Weiterführung der Ideen von Ann M. Jernberg und Marianne Marschak).
 Interaktionsverantwortung
Interaktionsverantwortung 
3. »Kontakt« beschreibt, wer von beiden Interaktionsbeteiligten den kommunikativen Austausch auf welche Weise (Modus, Frequenz, Intensität) initiiert, aufrechterhält und beendet. Downing (2009) erweitert die Bedeutung um einen dynamischen Aspekt, nämlich den der Fehlerkorrektur (»match-mismatch-repair-cycles« in Anlehnung an Tronick, 2007; vgl. auch Favez, Scaiola, Tissot, Darwiche, & Frascolo, 2011). Es bleibt zu klären, ob dieser Aspekt nicht dem der »Passung« zuzurechnen ist, da diese die Wiederherstellung gelingender Kommunikation nach einem »Miss-Verstehen« impliziert.
 Kontakt
Kontakt 
4. Die Kategorie der »Entwicklungsadäquanz « (Kastner-Koller & Deimann, 2009) zielt auf die Einschätzung, inwieweit die Interaktion quantitativ für das Kind eine Unter- oder eine Überforderung bedeutet und ob sie qualitativ dem kindlichen Entwicklungsstand adäquat gestaltet wurde.
Читать дальше