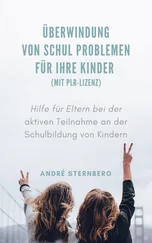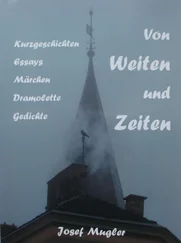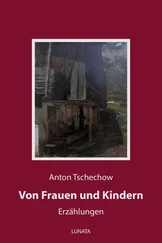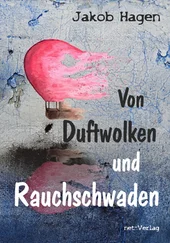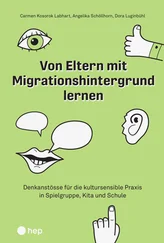Beziehung ist ein Konstruktbegriff, der sich in seinem Konstruktcharakter von der beobachtbaren, damit auch operationalisierbaren »Interaktion« unterscheidet. Welches theoretische Konzept (Konstrukt) von »Beziehung« in das jeweilige interaktionsdiagnostische Instrument einfloss, sollte in der Publikation expliziert werden.
Beziehung ist nicht statisch zu verstehen, auch wenn Begriffe wie »Muster« oder »Einstellung« eine relative Stabilität suggerieren. Ein Konzept, das der Dynamik im wechselseitigen interaktiven Geschehen gerecht zu werden verspricht, scheint das der »Wieder-Herstellung von Passung« zu sein. Darauf verweisen Thomas und Chess (1977), die ein kumulatives und wechselseitiges Verhältnis von Anlage- und Umweltfaktoren postulieren und auf »den ursprünglich von Henderson (1913) vorgeschlagenen Begriff der Übereinstimmung (›goodness of fit‹)« zurückgreifen (Resch, 2004, S. 37).
Will man diesem Konzept folgend Beziehung erkennen und beschreiben, muss es gelingen, nicht nur die Fits oder Misfits (Largo & Benz-Catellano, 2004) zu erfassen, sondern Beziehung als ein dynamisches autopoietisches System (im Sinne Luhmanns, 1984) als »Match-Mismatch-Repair-Circle« (Tronick, 2007) zu verstehen und abzubilden. Mechthild und Hanouš Papoušek entwickelten diesen Ansatz bereits im Jahr 1990. Mechthild Papoušek baut ihn – nach dem Tode ihres Mannes – bis zum heutigen Tag aus (z. B. Papoušek, 1999) und stellt immer wieder eine Kompatibilität zu neueren Forschungsergebnissen und Paradigmen her (Papoušek, 2004; Papoušek, 2015).
Beziehungseinstellung steht für die allgemeine stabile Haltung einer Person zu Beziehungen. Auf sie ist zu schließen mit Hilfe des explorierenden Gesprächs sowie über die Erfassung von Interaktionsmustern (vgl. auch Asendorpf, Banse & Neyer, 2017).
 Interaktionsbeobachtung
Interaktionsbeobachtung 
Die Arbeitsdefinition der hier gemeinten Interaktionsbeobachtung umfasst die Beobachtung und Beurteilung von bezogenem (interpersonalem) Verhalten.
Kommunikationsbeobachtung bezieht sich demzufolge auf die Beobachtung und Bewertung einer Teilmenge interaktiven Verhaltens, nämlich dem Verhalten, das dem Informationsaustausch der Beteiligten dient.
Mithilfe der Interaktionsbeobachtung soll also nicht nur Verhalten beobachtet werden, sondern auch aus beobachteten interaktiven Handlungen Schlüsse auf Beziehungsmerkmale und von diesen wiederum auf die grundlegende dyadische Beziehung (z. B. auf den Bindungscharakter) oder auf Kompetenzen zur Interaktionsgestaltung der Akteure (z. B. Feinfühligkeit) gezogen werden. Wie bedeutsam die Wahl des theoretischen Rahmens für die Schlussprozesse ist, betonen beispielsweise Gloger-Tippelt und Reichle (2007, S. 402) mit Verweis auf die Heuristik des Bindungskonzeptes nach Bowlby.
In der Praxis ist sehr exakt darauf zu achten, ob es sich bei den Interaktionsbeschreibungen um beobachtbares Verhalten oder bereits um Zuschreibungen/ Deutungen handelt. So wird beim CARE-Index, der in Kapitel 4 vorgestellt wird, beispielsweise versucht einzuschätzen, welche Funktionalität das kindliche Verhalten hat. Streng genommen ist dies bereits ein Schlussprozess, der in vielen Urteilsbildungen jedoch nicht entsprechend expliziert wird, obwohl sich damit sprunghaft der Grad von Subjektivität in der Beurteilung erhöht.
Einige interaktionsbeobachtende Instrumente erfüllen den Anspruch, nicht nur interpersonale (speziell kommunikative) Handlungen zu erfassen, sondern auch Schlussprozesse auf Handlungsmuster sowie auf diesen zugrunde liegende Einstellungen und Repräsentationen vorzunehmen. Dies ist für die Praxis von größtem Interesse, denn was soll man mit streng ausgezählten rein beobachtbaren Daten, wie z. B. den »Blickkontakten des Kindes zum Elternteil je Minute« anfangen, wenn ihnen kein inhaltliches Referenzsystem zur Verfügung steht?
Analysiert man die bisher vorliegenden Instrumente, so scheint es am angemessensten, die Beobachtungskategorien zur Einschätzung der Eltern-Kind-Interaktionen nach zwei Gesichtspunkten zu ordnen:
1. nach der Funktionalität der Interaktion möglichst aus vier Perspektiven: Kind, Elternteil, Elternteil-Kind sowie Elternbeziehung.
Der hier gemeinten Einschätzung von Funktionalität des interaktiven Verhaltens liegt bereits ein erster Deutungsprozess des Diagnostikers zugrunde. Daher ist es methodisch und psychologisch sinnvoll und erforderlich, diesen ersten Schlussprozess mit Hilfe eines Bewertungsinstrumentes auch plausibel 4zu begründen und methodisch so zu gestalten, dass eine möglichst große Übereinstimmung der Beurteilenden bezüglich Validität und Reliabilität erzielt wird.
2. Differenzierung der Kategorien zur Interaktionsbeobachtung unter formalen Gesichtspunkten
Diese beiden Aspekte der »Funktionalität« und der »formalen Operationalisierung« werden im folgenden Abschnitt in einer ersten Annäherung – und zwar jeweils geordnet nach der Perspektive »Kind«, »Eltern«, »Eltern-Kind-Beziehung als Entität« und »Elternbeziehung« – überblicksartig dargestellt. Auf diese Weise sollen die Lesenden die Möglichkeit erhalten, die dann im zweiten Teil folgenden inhaltlichen Bewertungen bei der Skizzierung einzelner Verfahren besser nachvollziehen zu können. Am Ende des 4. Kapitels ( 
Kap. 4.3 4.3 Schlussfolgerungen 4.3.1 Verfahrensbeurteilung Zur leichteren Orientierung bei der Verfahrensauswahl in der Praxis wurden drei Beurteilungskriterien zusammengestellt, die der folgenden Tabelle entnommen werden können: Tab. 4.24: Beurteilungskriterien Bezieht man diese Beurteilungskriterien und ihre Ausprägungen auf die interaktionsdiagnostischen Verfahren, die eher einen »Breitbandcharakter« aufweisen und die in einem ausführlichen Steckbrief vorgestellt wurden, so lässt sich trotz der erwähnten Einschränkungen und mit größter Vorsicht beim Versuch, die Bewertungen zu generalisieren, eine gewisse Rangfolge in Bezug auf die inhaltliche Verwendbarkeit und die Praktikabilität abbilden. Folgende Übersicht listet die Bewertungsergebnisse auf: Tab. 4.25: Verfahrensbeurteilungen Eine relativ hohe Bewertung erhalten damit das Eltern-Kind-Interaktionsprofil (EKIP), der CARE-Index, die Mannheimer Beurteilungsskalen (MBS-MKI), die Heidelberger Marschak-Interaktionsmethode (H-MIM), die Münchner klinische Kommunikationsskala (MKK), das Bonner Modell zur Interaktionsanalyse (BMIA) sowie das Lausanner Trilogspiel (mit FAAS). Die Verwendbarkeit dieser Instrumente wird in den Kap. 6 und 7 anhand unterschiedlicher Fragestellungen diskutiert.
) wird schließlich eine synoptische Betrachtung der Facetten und Indikatoren der ausgewerteten Beobachtungsinstrumente vorgestellt, die als Grundlage für weitere Forschung aber auch bereits zur praktischen Nutzung als eine Art Checkliste verwendet werden könnte (  Anlage 1).
Anlage 1).
1.1 Inhaltlich-funktionale Kategorien 5
1.1.1 Perspektive »Kind«
Unter funktionalem Aspekt ist zu fragen, worauf die Eltern-Kind-Interaktion hinzielt? Entwicklungspsychologisch dient sie insbesondere:
1. der Befriedigung sinnlich-vitaler Bedürfnisse und der Regulation der Verhaltenssysteme des Kindes (vgl. z. B. Als & McAnulty, 2001; Ziegenhain & Fegert, 2018)
2. der Entwicklung der Mentalisierung des Kindes (vgl. im Überblick z. B. Fonagy, Gergely, Jurist, Target & Vorspohl, 2006; Bischof-Köhler, 2011; Kalisch, 2012; Taubner & Wolter, 2016)
Читать дальше
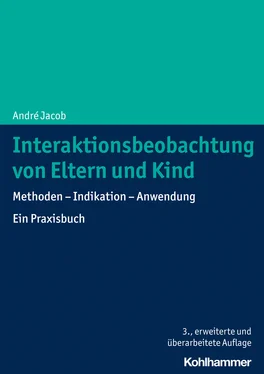
 Interaktionsbeobachtung
Interaktionsbeobachtung