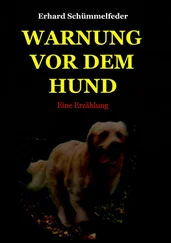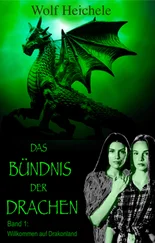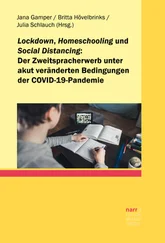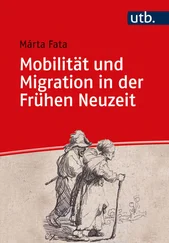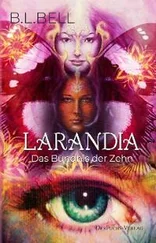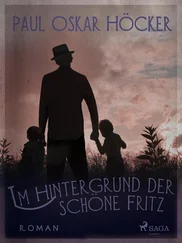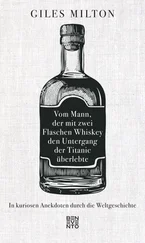Nicht unproblematisch ist auch die Definition der Umgangssprache, die Hofmann zugrundelegt, setzt er diese doch mit dem sermo familiaris gleich und sieht sie als „die lebendige mündliche Redeweise der Gebildeten“ (Leumann/Hofmann 1928:10). Wie bereits dargelegt (v. supra) ist die Zuordnung zu dem vorwiegend bei Cicero gebrauchten Terminus nicht so einfach. Innerhalb der Umgangssprache wiederum erkennt er mehrere Abstufungen wie die gewählte Sprache der Konversation, den familiären Stil und den niedrigen Stil, während die Vulgärsprache einfach mit noch niedriger verankert wird. Trotz fehlender Differenzierung von diatopischer, diastratischer und diaphasischer Ebene hält sich diese Dreiteilung Schriftsprache (bzw. enger gefaßt Literatursprache) vs. Umgangssprache vs. Vulgärlatein hartnäckig, nicht nur in der Klassischen Philologie (cf. Palmer 1990, Meiser 2010, Willms 2013).256
In der Romanistik dagegen wird diese Trichotomie meist zu einer Dichotomie weiter verkürzt, indem eine Opposition Klassisches Latein vs. Vulgärlatein formuliert wird (cf. z.B. Rohlfs 1951, Vossler 1954, Silva Neto 1957, Herman 1967, Väänänen 11963/ 42002, Coseriu 2008). Exemplarisch sei dabei auf Herman (1996) verwiesen, der relativ klar die diasystematische Vielfalt der lateinischen Sprache erkennt und definiert, in seiner weiteren Beschreibung dann jedoch in alte Muster verfällt:
[…] en effet les Anciens eux-mêmes étaient conscients de l’existence d’usages que nous appellerions dialectaux ou socio-culturels […], et la recherche relative au latin connaît depuis toujours une longue nomenclature de variétés conformes à différents paramètres, sans même parler des étapes chronologiques s’échelonnant au cours de la longue histoire de la langue. (Herman 1996:45)
In seiner folgenden Abhandlung der variationsbedingten Unterschiede im Lateinischen faßt er trotz dieser Erkenntnis jegliche substandardliche Abweichung unter ‚Vulgärlatein‘.
Aus Sicht der Romanistik, die in einer diachronen Perspektive bestrebt ist die Ursprünge der romanischen Sprachen zu ergründen, ist diese Arbeitshypothese, auch im Sinne der im 19. Jh. formulierten genetischen Verwandtschaft der Sprachen, bei der eine Sprachfamilie durch eine gemeinsame Ursprache definiert wurde, durchaus legitim und praxisnah. In dieser Hinsicht ist es ausreichend jegliche Abweichung vom standardisierten Latein unter einen Begriff zu fassen, welche Sprachrealität auch immer damit verbunden ist (zur Diskussion v. infra).
Soll hingegen die lateinische Sprache als lebendige, sich wandelnde Sprache beschrieben und möglichst präzise in ihrer Vielfalt erfaßt werden, so ist diese Unterscheidung zu grobkörnig. Aus diesem Grund sei hier der Versuch unternommen, auf Basis der analysierten Begrifflichkeiten und der bisherigen Systematisierung der variationsbedingten Heterogenität des Lateins (siehe dazu das Modell zur Sprachen- bzw. Varietätenwahl in Kap. 3.1.3) eine diasystematische Auffächerung darzustellen.257 Soweit möglich sei dabei auf die antiken Termini rekurriert, diese aber, wenn nötig, um weitere ergänzt.258
| Diasystem des Lateinischen |
| diatopische Ebene |
Dialekte |
Regiolekte (tertiäre Dialekte) |
Urbanolekte |
|
primäre Dialekte: ( sermo rusticus/agrestis )Römisch Praenestinisch Lanuvinisch Tiburinisch Tusculanisch Satricanisch Aricianisch etc. |
Varietäten der Provinzen: ( sermo rusticus/agrestis )Italia Belgica Lugdunensis Narbonensis Aquitania Tarraconensis Lusitania Baetica Britannia Raetia Noricum Mauretania Africa etc. |
Varietäten der Städte: ( sermo urbanus )Roma Mediolanum Mogontiacum Lugdunum Tarraco Augusta Treverorum Nemausus Narbo Olisipo etc. |
|
sekundäre Dialekte: ( sermo rusticus/agrestis )in Italien: mit oskischem mit umbrischem mit griechischem mit keltischem, etc. Einfluß außerhalb Italiens: mit iberischem mit germanischem mit lusitanischem etc. Einfluß |
|
|
|
Soziolekte |
|
| diastratische Ebene |
schichtenspezifisch |
sermo urbanus sermo usitatus/sermo communis sermo plebeius/sermo vulgaris |
|
|
|
Situolekte |
|
| diaphasische Ebene |
Superstandard Standard Substandard |
sermo urbanus/sermo latinus sermo usitatus/sermo communis sermo familiaris/sermo cotidianus sermo humilis/sermo vulgaris |
|
|
|
Technolekte |
|
| diatechnisch |
gruppenspezifisch ( sermo technicus ) |
sermo philosphicus sermo medicus sermo religiosus sermo architectonicus sermo argrarius etc. |
|
|
|
Helikialekte |
|
| diagenerationell |
altersspezifisch |
Gerontolekt (Sprache der Senioren) |
Neotolekt (Sprache der Kinder und Jugendlichen) |
|
|
Sexolekte |
|
| diasexuell |
geschlechtsspezifisch |
Androlekt (Sprache der Männer) |
Gynaikolekt (Sprache der Frauen) |
Abb. 3: Das Diasystem des Lateinischen
Diese hier präsentierte Idee einer Architektur des Lateinischen als lebende Sprache in der Antike ist natürlich insofern defizitär, als die diachronische Entwicklung und die sich daraus ergebenden Verschiebungen bzw. Nuancierungen – wie oben beschrieben – nicht abgebildet sind. Es bleibt weiterhin in vielerlei Hinsicht hypothetisch, da wir aus der historischen Konstellation heraus rein auf schriftsprachliche Zeugnisse angewiesen sind, die nicht nur die Frage nach der Mündlichkeit schwer beantwortbar machen, sondern jede Art der diasystematischen Variation nur fragmentarisch hinter der weitgehend standardisierte Schriftlichkeit sichtbar werden lassen. Insofern beruht das obige Schema zwar durchaus auf Studien und Belegmaterial, welches vorsichtige Rückschlüsse auf eine bestimmte Varietät zulassen, sie vollständig zu erfassen ist jedoch nicht möglich. Es sollte dabei jedoch im Anschluß an die neuere Forschung deutlich werden, daß das Lateinische der Antike eine vollausdifferenzierte Sprache war, deren Heterogenität sich eben nicht wie bisher üblich auf zwei oder drei Begriffe reduzieren läßt.
5. Ein kurzer Abriß zur Begriffsgeschichte des Vulgärlateins seit Hugo Schuchardt
Bei einer Darstellung, die der Frage nachgeht, wie ein tiefergehendes Verständnis für das Latein der Antike entstanden ist und wie Sprachentwicklung in das Bewußtsein der Gelehrten rückte, ist es unumgänglich den zentralen Begriff des Vulgärlateins zu betrachten. Dieser Terminus ist insofern entscheidend, als hierin zum Ausdruck kommt, daß es noch eine andere Form des Lateins gab, die nicht den gleichen Grad an Normiertheit und Invariabilität aufwies wie die Schriftsprache im Allgemeinen bzw. das sogenannte Klassische Latein im Besonderen. Dieser Unterschied wird bereits bei den antiken Autoren greifbar, die wie im vorherigen Kapitel deutlich wurde, verschiedene Arten des Lateins unterschieden, wie auch immer die jeweilige diasystematische Abgrenzung gedacht war.
Читать дальше