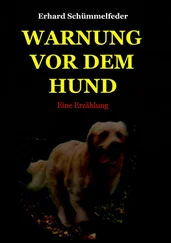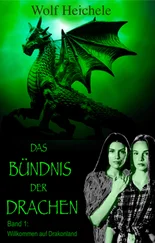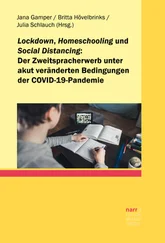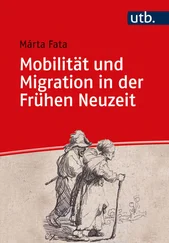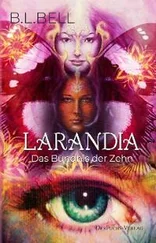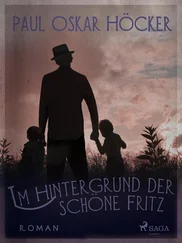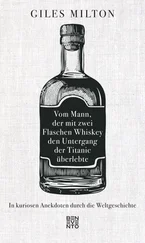Das Konzept der latinitas im Sinne einer überprüfbaren Sprachrichtlinie ist bei Varro, überliefert durch Diomedes ( fragm. gramm . I, 439, 17; GLK 1857 I:439), näher erläutert, und zwar mit den Kriterien natura , analogia , consuetudo und auctoritas und auch bei Quintilian ( Inst. orat. I, 6, 1; 2001 I:160–184), der als Kriterien ratio ( analogia u. etymologia ), vetustas , auctoritas und consuetudo zugrunde legt (cf. Siebenborn 1976:53). Das sich ab dem 2. Jh. v. Chr. konstituierende Sprachideal der latinitas , beruhend auf einem Kanon von auctores , den classici , grenzt sich gegenüber diatopischen Varietäten (cf. sermo rusticus, agrestis ) und diastratisch niedrig markierten Varietäten ab (cf. sermo vulgaris, cotidianus, familiaris, plebeius ) und ist gleichzeitig gekoppelt an ein gesellschaftlich als vorbildlich angesehenes Verhalten (cf. recte vivere ) und Denken (cf. recte sentiendi et cogitandi ), was sich letztlich auch auf die Bereiche der Philosophie (cf. vere loqui ), der Rhetorik (cf. bene loqui ) und der Grammtik (cf. correcte loqui ) ausdehnt; d.h. Teil eines gesamtgesellschaftlichen Ideals ist (cf. Poccetti/Poli/Santini 2005:401–403).
Im Bereich der Stilregister oberhalb des Standards sind aus der antiken metaprachlichen Reflexion im Wesentlichen zwei Markierungen überliefert, und zwar die des sermo urbanus sowie die des sermo latinus mit den jeweils dahinterstehenden Konzepten der urbanitas und der latinitas . Beides sind keine diaphasischen Einordnungen sui generis , sondern je anderer Provenienz. Die Bezeichnung sermo urbanus ist erstmals bei Livius belegt, und zwar im Sinne der diatopischen Abgrenzung gegenüber rusticus , d.h. es wird auf das stadtrömische Leben, der damit zusammenhängenden Kultur und der entsprechenden sprachlichen Ausdrucksweise abgehoben (cf. die urbs ‚Stadt‘ schlechthin: Rom). Dies bedeutet auch, daß diese Kennzeichnung von Anbeginn neben einer rein lokalen Komponente eine dezidiert positive Konnotation hatte, und zwar im Sinne eines gehobenen Registers. Bei Cicero gewinnt letzterer Aspekt zunehmend an Gewicht, wobei er beispielsweise vage von einem urbanitas color spricht, ohne dies an sprachlichen Einzelelementen festzumachen; es sei jedoch ähnlich dem des ἀττικισμὸς im Griechischen. Quintilian schließlich schärft hier das Verständnis, indem er die Redeweise nicht nur mit der stadtrömischen Bevölkerung in Verbindung bringt, sondern auch mit entsprechender Bildung der Sprecher, so daß der sermo urbanus zumindest in partieller Korrelation mit der conversatio doctorum steht. Eine ursprüngliche diatopische Markierung verschiebt sich hier demgemäß zu einer diastratisch-diaphasischen, ohne die lokale Komponente ganz zu verlieren, denn im Laufe der Zeit überträgt sich das Konzept der urbanitas von Rom auch auf die Metropolen der Provinz, wobei die Abgrenzung zur Sprechweise auf dem Land ( rusticus ) erhalten bleibt.250 Stilistisch wird mit dem sermo urbanus somit letztendlich das gute, (haupt)städtische Sprechen ausgedrückt, welches sich von der mit sermo latinus gekennzeichneten Redeweise dadurch unterscheidet, daß bei letzterer eher die regelkonforme Korrektheit im Vordergrund steht und bei der als urban gekennzeichneten Redeweise, die damit verbundene Eleganz und Kultiviertheit zum Ausdruck gebracht wird (cf. Müller 2001:219–230; Lüdtke 2019:450–452).
Es stellt sich nun die Frage, wie diese vornehmlich im Zuge der antiken Rhetoriktheorien entstandenen Begrifflichkeiten zu bewerten sind. Dabei ist prinzipiell zu berücksichtigen, daß die Verfasser der Rhetoriken oder andere Autoren, die metasprachliche Betrachtungen anstellten, weniger die Beschreibung der sprachlichen Wirklichkeit zum Ziel ihrer Abhandlungen hatten, sondern die jeweilige Sprechweise auf ihre Funktionalität hin für öffentliche Reden untersuchten. Nichtsdestoweniger ist darin in gewissem Grad ein Spiegelbild tatsächlicher diaphasischer Ebenen zu erkennen. Allerdings stellt sich wie bei der Beschreibung moderner, lebender Sprachen auch das grundsätzliche Problem der Abgrenzung von diaphasischer und diastratischer Ebene, da diese eng zusammenhängen. Zusätzlich kommt angesichts der Ausdehnung des römischen Reiches der diatopische Aspekt zum Tragen. Auch dies ist grundsätzlich nicht anders als bei aktuellen, diversifizierten Sprachen, allerdings mit dem Unterschied, daß die Standardsprache aufgrund geringerer Verbreitung von Schulbildung, niedrigerer Alphabetisierungsrate und dem Fehlen der modernen Medien als Katalysator von Standardisierungsprozessen weniger präsent war als heutzutage bei den großen Nationalsprachen. Es bleibt als Parallele zu heute aber auch die Schwierigkeit der Bestimmung der Anzahl der diaphasischen Ebenen, die oft nicht scharf getrennt voneinander sind. Versucht man nun die Ergebnisse aus der metasprachlichen Analyse von Müller (2001) auf eine mögliche Sprachrealität anzuwenden, so scheint es neben einem Standard, der als sermo usitatus oder communis gekennzeichnet ist, zumindest zwei Substandardregister gegeben zu haben, d.h. einerseits den sermo familiaris oder sermo cotidianus und andererseits niedrig markierter den sermo humilis oder sermo vulgaris . Im Bereich des Superstandard ist mit sermo urbanus oder sermo latinus der gehobene Sprachgebrauch anzusetzen. Es ist wahrscheinlich, daß sich auch der schriftliche und der mündliche Gebrauch nochmal unterschieden, ganz nach dem von Koch/Oesterreicher (2011:12) formulierten Diktum der jeweiligen Affinitäten von phonischem Code zu Nähesprache und graphischem zu Distanzsprache (v. supra).
4.2 Lingua morta (viva) : Latein vom Mittelalter bis zur Frühen Neuzeit
Die Frage wann die Epoche des Mittellateins beginnt und damit auch die Phase, in der Latein – zumindest aus heutiger Sicht – nicht mehr als lebende Sprache wahrgenommen wird, ist untrennbar mit der Entstehungsgeschichte der romanischen Sprachen verbunden. Dabei ist die Frage nach einem mehr oder weniger präzise datierbaren Ablösezeitpunkt prinzipiell nicht wirklich sinnvoll gestellt, wie Kramer (1997) unmißverständlich deutlich macht:
Eine scharfe Grenze zwischen spätantikem und frühmittelalterlichem Latein läßt sich natürlich nicht ziehen. Die Frage, wann die spätlateinische zur frühromanischen Umgangssprache wurde, mit anderen Worten, wann man aufhörte lateinisch, und wann man anfing, romanisch zu sprechen, ist in dieser Form falsch gestellt. Beide Sprachformen folgen bruchlos aufeinander, und man kann nur sagen, daß die romanischen Charakteristika in dem Maße zunehmen, wie die lateinischen Wesensmerkmale abnehmen […]. (Kramer 1997:151–152)
Steinbauer (2003:514) benennt als Richtwert die Zeit um 600 n. Chr., in der die gesprochene Sprache sich so weit von der Schrift- und Literatursprache entfernt habe, daß man von einer Diglossiesituation ausgehen muß, die schließlich im 9. Jh. in eine Verschriftung und Verschriftlichung einzelner Volkssprachen auf dem Boden des ehemaligen römischen Reiches mündet. Auch Müller-Lancé (2006:40), der den Zeitraum ähnlich faßt (650 n. Chr. bzw. 6./7. Jh.), sieht aus linguistischer Sicht gravierende Veränderungen, die eine neue Epoche in der Sprachgeschichte rechtfertigen. Reutner (2014:200) folgt ihm in dieser Datierung, genauso wie in der Gesamtperiodisierung. Meiser (1998:2) hingegen datiert das Ende der spätlateinischen Phase auf Ende des 7. Jh. n. Chr. Paradigmatische Autoren an dieser Epochenschwelle wie Gregor v. Tours (540–594 n. Chr.) oder Isidor v. Sevilla (560–636 n. Chr.) ordnet Müller-Lancé (2006:37) aus linguistischer Sicht noch dem Spätlatein zu, wobei er doch bereits recht deutliche Abweichungen von der klassischen Morphologie und Syntax konzediert. Berschin (2012:106) hingegen sieht die Sprache von Gregor nur noch in euphemistischem Sinne dem niedrigen Stil zugehörig, da sie in Wahrheit voller Barbarismen und Solözismen sei. Wichtiger aber ist seine Beobachtung, daß im Spätlatein der sprachgeographische Schwerpunkt der Literaturproduktion in Nordafrika lag (christl. Autoren 2.–6. Jh.), während er sich dann nach Norden und spezieller nach England und vor allem nach Irland verschob, also in wenig bzw. gar nicht romanisierte Regionen Europas, wo eine insular-lateinische Literatur entstand (cf. Berschin 2012:105).
Читать дальше