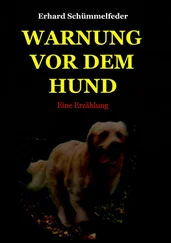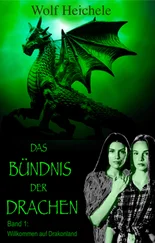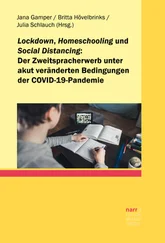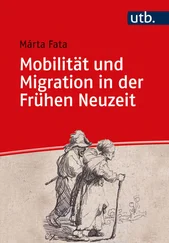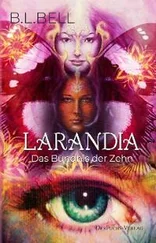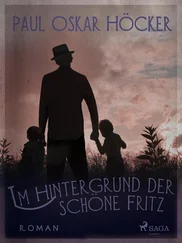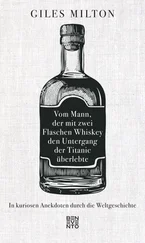Eine andere neue Textgattung, die in der klassischen Zeit erstmals für das Lateinische erschlossen wird und damit das Spektrum des diskurstraditionellen Ausbaus vergrößert, ist der Brief, nicht so sehr als Gebrauchstext, sondern vielmehr als literarische, für die öffentliche Rezeption bestimmte Form.202 Auch hier gibt es griechische Vorbilder wie die Lehrbriefe Epikurs ( Ἐπίκουρος , 342/341–271/270 v. Chr.) als spezifische Ausformung der Gattung, an die Seneca ( Lucius Annaeus Seneca , ca. 1–65 n. Chr.) mit seinen Epistulae morales ad Lucilium anknüpft. Frühester römischer Gebrauch ist jedoch bei Cornelia, der Mutter der berühmten Volksstribunen Tiberius und Gaius Gracchus bezeugt (Quint. I, 1, 6). Die wichtigsten Korpora von Briefen, die literarisch über die Antike hinausgewirkt haben, sind diejenigen von Cicero ( Ad familiares , Ad Atticum, Ad Quintum fratrem ) und von Plinius d.J. ( Gaius Plinius Secundus , 61/62–112/113 n. Chr.), die auch sprachlich insofern bemerkenswert sind, als die ciceronischen mitunter stilistisch stark von seinem sonstigen elaborierten Duktus abweichen und als Quelle für vulgärlateinische Phänomene gelten, während die Episteln des Plinius eine elaborierte Kunstform in verschiedenster Ausprägung darstellen (Ekphrasis, Essay, Panegyrikon) und als einzige die Forderungen nach der brevitas und der Monothematizität weitgehend einlösen. Während diese beiden Autoren die Briefe in Prosa abfaßten, waren die Epistulae des Horaz, in denen auch die Ars poetica enthalten ist, in hexametrischen Versen abgefaßt und demnach ab ovo für die Publikation bestimmt (cf. Baier 2010:101–104; Albrecht 2012 I:430–435).
Die römische Literatur wird hierbei um eine neue Gattung bereichert, indem auf verschiedene Spielarten einer Textsorte zurückgegriffen wird (Privatbrief, Lehrbrief, öffentlicher Brief, essayistischer Brief etc.), der partiell zwar in der griechischen Literatur (und auch in anderen Kulturkreisen) bereits vorgegeben ist. Von den Römern wurde sie aber weiter ausdifferenziert und zu einem festen neu interpretierten Bestandteil der literarischen Ausdrucksmöglichkeiten wurde, wobei aus diskurstraditioneller Perspektive das Lateinische in einen weiteren Bereich vorrückt, der Ausbau der Sprache durch die neuen Arten der Versprachlichung vorangetrieben wird.
Die bereits in altlateinischer Zeit sich herausbildende Tradition der Rhetorik bzw. der öffentlichen Rede bei den Römern wurde in der klassischen Periode nun auch schriftlich fixiert, und zwar sowohl in Form von Lehrbüchern bzw. Anleitungen zur richtigen Anwendung rhetorischer Ausdrucksmittel und Verhaltensweisen als auch durch konkret gehaltene oder zu haltende Reden. Diesbezüglich ist vor allem Cicero zu nennen, der nach der ersten – ihm nur zugeschriebenen – Rhetorik Auctor ad Herennium die Werke De oratore , Brutus und Orator verfaßte. An konkreten Reden seien auswahlweise nur Pro Sexto Roscio Amerino , Divinatio in Q. Caecilium , Pro Marcello , Pro Ligario und Pro rege Deiotaro, genannt. Wegweisend im Bereich der Rhetorik ist außerdem Quintilian, der mit seiner Institutio oratoria ebenfalls einen erheblichen Einfluß auf spätere Grammatikwerke ausübte (v. infra Varro et al.). (cf. Baier 2010:107–114).
Eine Textgattung, die bei den Römern nicht zur Literatur sensu strictu gehörte, die Fabel, wurde von Phaedrus ( Φαῖδρος , 1. Jh. n. Chr.), einem Freigelassenen griechischer Herkunft, erstmals in lateinischer Sprache etabliert. Vorbild für die von Phaedrus im der Komödie nahestehenden altertümlichen Versmaß des Senaren nachgedichteten, sich durch ihre brevitas auszeichnenden Tierparabeln mit gesellschaftskritischen Unterton und bisweilen moralisierender Tendenz (cf. Promythien, Epimythien) sind die Fabeln von Äsop ( Αἴσωπος , 6. Jh. v. Chr.) (cf. Baier 2010:79–80). Im Zuge der aemulatio entfernt sich Phaedrus dabei zunehmend von seinem Modellautor und übernimmt nach und nach weniger Motive und programmatische Schlußfolgerungen (cf. Kleine Pauly 1964 I:199). Auch wenn innerhalb der römischen Literatur die Rezeption eher verhalten ist und eine Nachwirkung erst in neuzeitlichem europäischen Kontext einsetzt (La Fontaine, Lessing), ist die Erweiterung der lateinischen Prosa um ein weiteres Genre sprachwissenschaftlich insofern von Bedeutung, als hier neue diskurstraditionelle Bereiche mit bestimmten Versprachlichungsstrategien (d.h. unterschiedlichen stilistischen Mitteln) erschlossen werden (cf. Baier 2010:79–80).
Es sei an dieser Stelle dezidiert darauf verwiesen, daß alle bisher aufgezählten Textgattungen in der römischen Literatur bisher nicht zum Tragen kamen, also neue Formen und Inhalte mit der lateinischen Sprache ausgedrückt wurden.
In der Periode des klassischen Lateins wurden aber auch in Ansätzen bereits existierende Textgattungen weiter ausgebaut. Dies gilt beispielsweise für das Epos als die literarische Form mit dem größten Prestige, welches durch die Aeneis von Vergil ihren unbestreitbaren Höhepunkt erfuhr. Aus einer ex post Perspektive läßt sich konstatieren, daß der größte römische Dichter den größten griechischen zum Vorbild nahm. Ganz im Sinne der interpretatio Romana gibt Vergil den Römern ein Identifikationswerk in geschliffenen Hexametern mit Elementen der Ilias ( Ἰλιάς ) und Odysee ( Ὀδύσσεια ) von Homer ( Ὅμηρος , ca. 7./8. Jh. v. Chr.). In der Nachfolge von Vergil dichten Lukan ( Marcus Annaeus Lucanus , 39–65 n. Chr.), der neben kleineren Dichtungen ( Iliaca, Orpheus, Silvae ), das Epos Pharsalia ( bellum civile ) über den Bürgerkrieg schreibt, unter anderem Silius Italicus ( Tiberius Catius Asconius Silius Italicus , ca. 25–100 n. Chr., Punica ) und Statius, der mit seiner Thebais antithetisch an die Aeneis anknüpft (cf. Baier 2010:17–27).
Die Satire, die bereits in altlateinischer Zeit von Lucilius gepflegt wurde (v. supra), erfährt mit den saturae des Horaz ihre sprachliche und literarische Vollendung. Auch wenn er auf ein römisches Vorbild zurückgreifen kann, bleibt der Rekurs auf die griechische Tradition bestehen – so knüpft er beispielsweise an die kynische Diatribe im Stile des Bion von Borythenes ( Βίων Βορυσθενίτης , ca. 335–252 v. Chr.) an. Satirendichtung betreiben im Folgenden auch Persius Flaccus ( Aulus Persius Flaccus , 34–62 n. Chr.) und Juvenal ( Decimus Iunius Iuvenalis , ca. 67–127 n. Chr.), wobei insbesondere letzterem nicht zuletzt durch einige bonmots (z.B. panem et circenses , 10, 81; mens sana in corpore sano , 10, 356; difficile est satiram non scribere , I, 30) eine nicht unerhebliche Nachwirkung beschieden war. Eine dezidierte Anknüpfung an die Menippeische Satire, mit der sich schon Varro ( Marcus Terentius Varro , 116–27 v. Chr.) beschäftigt hat ( De compositione saturarum ), findet sich dann bei Seneca (d.J.) in seiner Apocolocyntosis Divi Claudii . Auch wenn die Textgattung der Satire keine „Erfindung“ der Römer war, bekam sie in der lateinischen Sprache und Literaturtradition doch eine ganz eigene Ausformung und Prägung, so daß Quintilian sie schließlich pointiert ganz vereinnahmen kann: „Satura quidem tota nostra est […]“ ( Inst. orat. X, 1, 93; 2001 IV:302) (cf. Burdorf/Fasbender/Moennighoff 2007:677–679; Baier 2010:56–58).
In den Bereichen, die man im weiten Sinne der Wissenschaft zuordnen kann und die in der Periode des Altalteins bereits Werke in lateinischer Sprache gezeitigt haben, ist für die Epoche des Klassischen Lateins ein weiterer intensiver Ausbau dieser Diskurstraditionen zu konstatieren.
Читать дальше