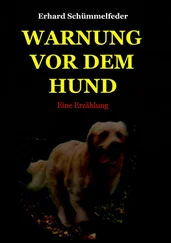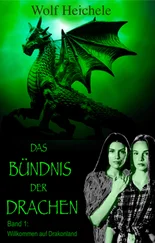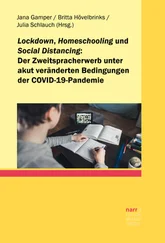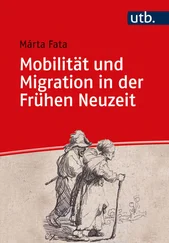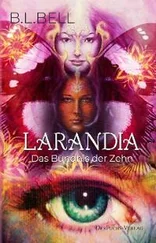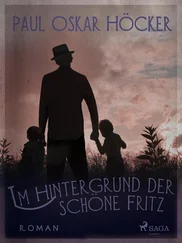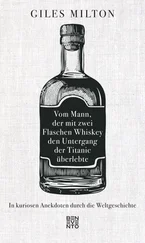Eine weitere Diskurstradition, in der das Lateinische Fuß faßt, ist die der Geschichtsschreibung. Hierbei sind im Wesentlichen zwei Entstehungsstränge auszumachen, und zwar einerseits die ca. ab dem 4. Jh. in Rom übliche Praxis, daß der pontifex maximus die wichtigsten Ereignisse (z.B. Amtsinhaber, Prodigien, Getreidepreis, Mond- u. Sonnenfinsternis) jahreschronologisch aufzeichnen ließ und auf Tafeln in der regia ausstellte sowie andererseits die bereits in vielen Facetten etablierte griechischen Historiographie. Aus der Tradition der Annales entstand somit die annalistische Geschichtsschreibung, deren Werke nach Amtsjahren der einzelnen Konsuln von Beginn der Stadtgründung bis zur Abfassungszeit geordnet war (cf. Ogilivie 1983:18–19; Brodersen/Zimmermann 2000:33). Die Umsetzung der römischen Chronologie – gesammelt als 80 Bücher in den Annales Maximi bis 133 v. Chr. – in ein Geschichtswerk wurde jedoch zu Beginn auf Griechisch geleistet, um einen größeren Leserkreis zu erreichen, so beim ersten Annalisten Fabius Pictor ( Quintus Fabius Pictor , ca. 254–201 v. Chr.) in seinem Werk Rhomaíon Práxeis . Erst danach setzt sich in der sogenannten Älteren Annalistik das Lateinische durch und wird wie bei C. Hemina ( Lucius Cassius Hemina , 2. Jh. v. Chr., Annales ), Cn. Gellius ( Gnaeus Gellius , 2. Jh. v. Chr.), Calpurnius Piso ( Lucius Calpurnius Piso Frugi , 2. Jh. Chr.), Asellio (Sempronius Asellio), Coelius Antipater ( Lucius Coelius Antipater , ca. 180–120 v. Chr., Bellum Punicum ) oder C. Sisenna ( Lucius Cornelius Sisenna , 118–67 v. Chr., Historiae ) zur Sprache der Historiographie. Eine andere Art von Geschichtsschreibung wird das erste Mal auf Latein von Cato d.Ä. praktiziert (cf. brevitas Catonis ), der mit seinen Origines an die hellenistische Textgattung der Gründungssage ( κτίσεις ) anknüpft (cf. Flach 1985:56–79; Baier 2010:81–84; Albrecht 2012 I:307). Mit dem Vorrücken in diese neuen diskurstraditionellen Bereiche wird auch ein wesentlicher Beitrag zum Ausbau der lateinischen Prosa erbracht, insofern die Variationsbreite und Anzahl der auf Latein verfaßten Texte zunimmt.189
Dies gilt auch für einen Bereich, den man heutzutage der wissenschaftlichen Literatur zuordnen würde. Während die ersten Textgattungen Epos und Tragödie in Versen gedichtet wurden, ist mit De agri cultura Catos das erste vollständige in Prosa verfaßte Werk überliefert und damit ein Grundstein für weitere Schriften und die wachsende Elaboriertheit der Sprache gelegt.
Der Ausbau des Lateinischen wurde in der altlateinischen Epoche auch in Bezug auf die mündliche Distanzsprache vorangetrieben. Hierbei ist insbesondere der in der römischen res publica wichtige Bereich der Rhetorik zu nennen.190
Im 2. Jh. v. Chr., als Rom auch vermehrt ins östliche Mittelmeer ausgriff, ergab sich allgemein eine vermehrte Rezeption griechischer Literatur, Philosophie und weiterer Wissenschaftsbereiche. Die Rhetorik, traditionell in der philosophischen Kontroverse zwischen den einzelnen Schulen (Stoa, Akademie, Peripatos) verortet, fand durch griechische Lehrer in der römischen Oberschicht Verbreitung, in der Griechisch alltägliche Bildungssprache war.191 Dabei ist die Rhetorik zwischen der Auseinandersetzung um den logos und der in der ars grammatica fixierten richtigen Sprechweise ( recte loqui ) bzw. der ‚korrekten‘ Sprache ( latinitas bzw. ̔ Ελληισμός ) anzusiedeln (cf. Baier 2010:105; Poccetti/Poli/Santini 2005:389–390).192 Im römischen Kontext erreicht die Rhetorik dann vor allem im öffentlichen Leben der republikanischen Institutionen einen wichtigen Stellenwert und wurde ein geradezu konstitutiver Bestandteil der res publica .193 Bestimmte herausrragende Redner (cf. z.B. Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus minor , 185–129 v. Chr.; Tiberius Sempronius Gracchus , 162–133 v. Chr.; Gaius Sempronius Gracchus , 153–121 v. Chr.) genossen daher ein hohes Prestige in der Gesellschaft (cf. Albrecht 2012 I:413–414).194 Die schriftliche Niederlegung der auf diese Weise neu ausgeformten Diskurstradition der öffentlichen Rede beginnt erst im Übergang zur folgenden Epoche (cf. Rhetorica ad Herennium , Cicero), genauso wie die der sich daran anschließenden Grammatik (cf. Varro).
Insgesamt ist demzufolge für die Periode der altlateinischen Sprachgeschichte eine wichtiger Wendepunkt dahingehend festzustellen, daß der Ausbau des Lateinischen maßgeblich vorangetrieben wurde. Durch die Übernahme von Diskurstraditionen aus dem griechisch-hellenistischen Raum, aber auch aus dem italischen Kontext sowie aufgrund von deren Weiterentwicklung rückt das Latein in dieser Epoche in immer mehr Bereiche der mündlichen, aber vor allem schriftlichen Kommunikation vor und wird zu einer vollfunktionsfähigen Distanzsprache. Der maximale Ausbaugrad wird zwar erst in der nächsten Phase erreicht, doch sind bereits zahlreiche Grundsteine gelegt. Der Aufstieg des Lateinischen zur überregionalen und dann internationalen Prestigesprache bedingt auf der anderen Seite auch einen Rückgang zahlreicher einheimischer Sprachen, so daß die Latinisierung der italienischen Halbinsel im 1. Jh. v. Chr. weitestgehend vollzogen ist. Aus der einstigen Vielsprachigkeit bleibt für nicht wenige Teile der Bevölkerung Einsprachigkeit übrig, für die Oberschicht Diglossie mit dem Griechischen.
4.1.1.3 Klassisches und Nachklassisches Latein
In der Literaturgeschichte wird nicht selten der Beginn der Epoche des Klassischen Lateins mit der ersten Rede Cicero präzise im Jahre 81/80 v. Chr. verortet und man folgt dann der stark wertenden Feingliederung in „goldene“ (80 v. Chr.-14 n. Chr.) und „silberne“ (14–117 n. Chr.) Latinität (cf. Meiser 2010:2, § 2) nach Maßgabe einer traditionell verankerten Beurteilung der Qualität der literarischen Produktion. Sprachwissenschaftlich gesehen ist es eher sinnvoll, den Beginn dieser Periode, die auch sprachliche Neuerungen zeitigt, gröber ins 1. Jh. v. Chr. zu datieren.
Müller-Lancé (2006:32) datiert die Epoche des „nachklassischen Lateins“ analog zu Meiser (2010:2; § 2), der diese Zeit jedoch „archaisierende Periode“ nennt und ebenso exakt vom Tode Trajans (117 n. Chr.) bis zum Tode Marc Aurels (180 n. Chr.) andauern läßt. In Anlehnung an die Datierung von Steinbauer (2003:513), der diese Zeit durch eine an vorciceronianische Vorbilder anknüpfende Literatur zwischen 120–200 n. Chr. verortet, sei hier diesem folgend, gröber ein Ende an der Wende vom 2. zum 3. Jh. n. Chr. postuliert. Klassisches und Nachklassisches Latein seien hier zusammengefaßt, da es einerseits in der nachklassischen Zeit keine signifikanten sprachlichen Änderungen im Vergleich zur klassischen Epoche gab und andererseits aus der hier fokussierten Perspektive von Ausbau, Diskurstraditionen und Sprachkonstellationen kein wirklicher Paradigmenwechsel zu verzeichnen ist.
Es ist in diesem Rahmen weder möglich, noch notwendig den Umfang und die Breite der Literatur dieser Periode zu behandeln, sondern es soll sinnvollerweise auf die wesentlichen Neuerungen in Bezug auf die diskurstraditionelle Perspektive eingegangen werden sowie den damit einhergehenden sprachlichen Ausbau, der zu dieser Zeit weitestgehend vollendet wird. Das bereits in altlateinischer Zeit wichtige Modell der griechischen Textgattungen und Diskurstraditionen erfüllt diese Funktion auch weiterhin und zeitigt in der römischen Literatur neue Formen. Dabei sind die Griechen nicht nur Vorbild, sondern gleichzeitig Maßstab des zu Erreichenden, an dem sich die Römer in einer Art kulturellen ἀγών abarbeiten und dies ist nicht nur objektiv als Prozeß zu konstatieren, sondern durchaus Teil der römischen Selbstreflexion wie bei Quintilian ( Marcus Fabius Quintilianus , ca. 35–96 n. Chr.) dokumentiert:
Читать дальше