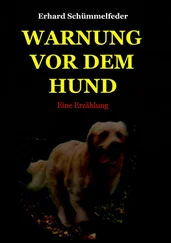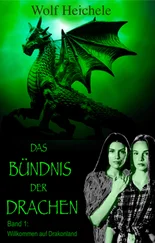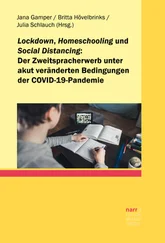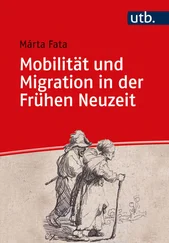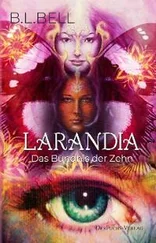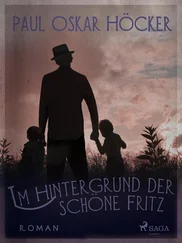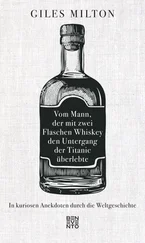Der Osten blieb weiterhin griechischsprachig und das Lateinische tat sich als Amtssprache schwer, auch wenn es durchaus bezeugte Bemühungen von Seiten der Griechen gab, das Lateinische zu erlernen (cf. Adams 2003:15).
Durch die massive Expansionspolitik in dieser Epoche wurde das Latein als Sprache der Eroberer in zahlreiche neue Regionen getragen, wirkte aber auch über die politischen Grenzen hinaus und wurde so zur Weltsprache in Rahmen der damaligen Welt (cf. röm. Anspruch der Herrschaft über den orbis terrarum ).
Für die Bevölkerung in den neu eroberten Gebieten ergab sich somit entweder ein zum Teil dauerhafter Bilingualismus bzw. eine Diglossie-Situation in den Regionen, die weniger latinisiert waren oder es vollzog sich über eine mehr oder weniger lange Phase der Mehrsprachigkeit ein Sprachwechsel hin zum Lateinischen.
Fuhrmann (1999:19) postuliert dabei einen eher abrupten, schnellen Sprachwechsel ohne eine größere Übergangsphase. Dies wäre aber womöglich en detail zu betrachten, da auch hier die Frage nach sozialer Stratifikation, urbaner oder ruraler Struktur u.ä. Kriterien eine Rolle spielen könnten.
Für die Elite Roms und des römischen Reiches ist prinzipiell weiterhin eine Diglossie-Situation mit dem Griechischen anzusetzen. Während Fuhrmann (1999:345) allerdings mit einem gewissen Rückgang des Philhellenismus in der nachklassischen Phase des Archaismus rechnet, sieht Kramer (1997:146) eine „ausgeprägte Zweisprachigkeit“ gebildeter Kreise bis ca. 250 n. Chr., was auch an der Übernahme fremder Strukturen, d.h. vor allem im Bereich der Syntax, aber auch auf lautlicher, morphologischer und semantischer Ebene ersichtlich sei.
Insgesamt ist dennoch zu konstatieren, daß das römische Reich in dieser Epoche nicht nur ein Vielvölkerstaat wurde (mehr denn je zuvor), sondern auch ein Vielsprachenstaat, in dem Bilingualismus und Mehrsprachigkeit durchaus gängig waren, nicht zuletzt auch bedingt durch die relativ hohe Mobilität bzw. Migration innerhalb des Imperiums. Als high-variety fungierte dabei einerseits das Latein, das inzwischen sowohl durch seine politisch-gesellschaftliche Stellung als auch durch seine nun reichhaltige Literatur zur unzweifelhaften Prestigesprache aufgestiegen war und in dieser Epoche einen Standardisierungsprozeß durchlief,207 andererseits auch das Griechische als „alte“ Kultursprache, aber auch als nach wie vor gültige Verkehrssprache im östlichen Teil des Imperiums
Die Frage, ab wann die Epoche des Spätlateins anzusetzen ist, hängt eng mit der unterschiedlich gehandhabten Begrenzung des Klassischen bzw. vor allem des Nachklassischen Lateins zusammen (v. supra), während ihr unscharfes Ende in erster Linie mit der Herausbildung der Romanischen Sprachen verknüpft ist. Müller-Lancé (2006:34) verweist deshalb mit Recht auf den Charakter einer Übergangsepoche. Es sei aus der dort gegebenen, relativ exakten Datierung (ca. 180–650 n. Chr.) und der ebenfalls präzisen, aber leicht verschobenen bei Steinbauer (2003:513), nämlich ca. 200–600 n. Chr, hier eine etwas fließenderen Grenze angenommen, d.h. ein Zeitraum vom 2./3. Jh. – 5./6. Jh. postuliert. Das etwas frühere Ende sei damit begründet, daß mit dem Fehlen der Reichseinheit spätestens ab dem 7. Jh. geistes- und kulturgeschichtlich genauso wie politisch eine andere Ära beginnt. Der Beginn der spätlateinischen Epoche fällt mit dem von Berschin (2012:94) charakterisierten „dunklen III. Jahrhundert“ zusammen, in dem nicht viel von der lateinischen Kultur überliefert ist, aber sich ein Wandel in Schrift, Sprache und Literatur vollzog.
Aus der soziolinguistischen Sicht des sprachlichen Ausbaus ist für die spätlateinische Phase vor allem die neu aufkommende christliche Literatur von Relevanz, die sich in vielen Facetten zeigt. Ohne in vollem Umfang auf alle Schriftsteller und Genres eingehen zu können, seien hier an erster Stelle die lateinischen Kirchenväter ( patres ecclesiae ) genannt, und zwar die kanonischen großen vier: Ambrosius ( Aurelius Ambrosius , 339/340–397 n. Chr.), Hieronymus ( Sophronius Eusebius Hieronymus , 345/348–420 n. Chr.), Augustinus ( Aurelius Augustinus , 354–430 n. Chr.) und Gregor d. Große ( Gregorius , 540–604 n. Chr.).
Chronologisch sollen zunächst aber einige andere wichtige Vertreter aus der Reihe der Kirchenlehrer genannt sein, die den Ausbau der religiösen Fachliteratur maßgeblich vorangetrieben haben. Dabei ist sicherlich an erster Stelle Tertullian ( Quintus Septimus Florens Tertullianus , ca. 150/170–220 n. Chr.) zu nennen, von dem ein umfangreiches und vielfältiges Schrifttum überliefert ist. Dabei kann man das Gesamtwerk in apologetische Schriften (z.B. Ad nationes, Apologeticum, De Testimonio animae, Adversos Iudeos ), in praktisch-asketische Schriften (z.B. Ad martyras, De spectaculis, De baptismo ) und in dogmatisch-polemische Schriften (z.B. De praescriptione haereticorum, Adversos Praxean ) gliedern. Seine literarischen Modelle sind zum einen bei den zeitgenössischen christlichen griechischen Autoren zu suchen, aber auch in der klassischen Philosophie (Platon, Stoa). Ein prägendes Moment ist dabei auch die Auseinandersetzung mit aktuellen Strömungen wie dem aufkommenden Gnostizismus. Dabei legt Tertullian nicht nur die Grundlage für eine facettenreiche religiöse Literatur des Lateinischen im Allgemeinen, sondern schafft mit seiner Art der Apologetik (werbend und verteidigend zugleich) ein neues Subgenre, welches so zuvor weder in der lateinischen noch in der griechischen Tradition existierte (cf. Albrecht 2012 II:1315–1324).
Ein wahrscheinlich etwas jüngerer Zeitgenosse Tertullians ist Minucius Felix (2./3. Jh. n. Chr.), von dem nur die Schrift Octavius überliefert ist.208 In dieser dialogisch gestalteten erstmaligen Auseinandersetzung mit den paganen Überzeugungen aus christlicher Perspektive werden Vorbilder wie Homer, Platon, Cicero, Seneca oder Vergil sichtbar (cf. Albrecht 2012 II:1337–1340).
Als ein weiterer nicht unbedeutender Vertreter aus dem Kreis der frühen Kirchenlehrer ist Cyprian ( Thascius Caecilius Cyprianus , ca. 200/210–258 n. Chr.) zu nennen, der im Zuge der Profilierung der frühen katholischen Lehre sowohl wichtige Bekehrungsschriften (z.B. Ad Donatum, Ad Detrianum, De ecclesiae catholicae unitate ) wie auch die Gattung der Erbauungsschriften (z.B. De habitu virginum, De dominica oratione ) hervorgebracht hat (cf. Albrecht 2012 II:1348–1351).
Ebenfalls zu den Großen und Einflußreichen gehört Laktanz ( Lucius Caecilius Firmianus Lactantius , ca. 250–320), der in seinen Divinae institutiones Elemente aus der juristischen Tradition mit solchen aus der Rhetorik verbindet. Neben weiteren wichtigen apologetischen Schriften wie De opificio Dei , De ira Dei oder De mortibus persecutorum – wobei vor allem letzteren eine größere Nachwirkung beschieden war, nicht zuletzt als Geschichtsquelle – soll er auch weltliche Schriften verfaßt haben, die allerdings nicht erhalten sind ( Symposium, Itinerarium, Grammaticus ) (cf. Albrecht 2012 II:1370–1371).
Was die sogenannten großen Kirchväter anbelangt, so ist zunächst Ambrosius zu nennen, der ein vielseitiges Œuvre hinterlassen hat, bestehend aus moralisch-asketischen Schriften ( De officiis ministorum, Exhortatio virginitatis, De Tobia ), dogmatischen Schriften ( De fide, De spiritu sacto, De incarnationis dominicae sacramento ), einer politischen Flugschrift ( Contra Auxentium de basilicis tradendis ), Trauerreden, Hymnen und einer verlorenen philosophischen Abhandlung ( De philosophia ). Dabei war auch bei ihm, wie im Falle anderer Kirchenlehrer, der griechische Einfluß durch seine klassische Vorbildung gegeben. Er hat unzweifelhaft Philosophen wie Plotin ( Πλωτῖνος , 205–270 n. Chr.) oder Porphyrios ( Πορφύριος , ca. 233–305 n. Chr.) genauso rezipiert wie römische kanonische Autoren (z.B. Cicero, Vergil) (cf. Albrecht 2012 II:1402–1406).
Читать дальше