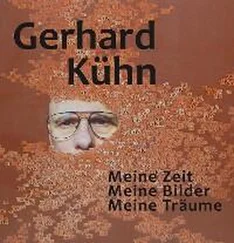Als die Großmutter aus dem Haus war, wurde es ruhig. Zuerst flocht Helene ihrer Puppe versonnen die Haare, die aus schlammfarbenen Wollfäden bestanden, sang ihr vor und lauschte den vertrauten Geräuschen im Mietshaus. Ein Scheppern, ein Fluch, Gespräche, Wasser lief, irgendwo bellte ein Hund. Die Stunden vergingen, es begann zu dämmern.
Inzwischen war sie längst allein gelassen worden mit Renate. Eine Frau hatte circa zwei Stunden nach Omas Aufbruch an die Tür geklopft und ihre Mutter mit eindringlicher Stimme um Hilfe gebeten. Seitdem war Mutter unterwegs. Helene wusste nicht, wo. Aber sie wusste, was sie bei Renate, ihrer Minischwester, zu tun hatte, das hatte sie schon oft getan: Wickeln, im Arm halten, Fläschchen geben. Doch in den letzten Stunden hatte Renate immer nur geschrien. Helene hatte sie herumgetragen, ihr vorgesungen, sie im Nacken gekitzelt, wie sie es sonst so gern mochte. Doch Renates Gesichtchen war immer röter geworden. Ihr kleiner Körper immer heißer und Helene immer verzweifelter.
Als es dunkel wurde, nahm sie also, wie es ihr aufgetragen worden war, die schwere Glasflasche zur Hand und setzte den Nuckel darauf. Sie prüfte die Temperatur der Milch, damit sich ihre Baby-Schwester nicht den Mund verbrannte. Das hatte Mama ihr genau gezeigt. Schon vorhin hatte Renate nichts trinken wollen, ihre verquollenen Augen waren nur noch Schlitze, so sehr strengte sie das Schreien an.
Helene wandte sich Renate zu, die gefühlt seit Tagen weinte. Unterbrochen wurde ihr Schreien heute nur von immer öfter einsetzenden jämmerlichen Hustenanfällen. Sie soll viel schlafen, damit sie gesund wird, hatte Mama gesagt. Essen und schlafen, das würde helfen, vielleicht. Das Baby aber drehte den Kopf zur Seite, presste den Mund zusammen.
»Du musst doch was essen«, versuchte Helene ihrer kleinen Schwester gut zuzureden. Renate ballte die Fäustchen und öffnete wieder den Mund. Das nutzte Helene, steckte den Nuckel in das Mündchen und Renate trank, schluckte und schluckte. Endlich schrie sie nicht mehr. Helene fielen selbst schon halb die Augen zu, den ganzen Tag war sie auf den Beinen gewesen. Und hungrig war sie auch, sehr sogar.
Nun wurde es endlich besser, stiller. Renate weinte nicht mehr. Sie hustete nicht mehr. Sie war eingeschlafen. Helene legte die kleine Schwester in ihr Bettchen. So friedlich sah sie aus im Halbdunkel des Zimmers. Helene selbst schlief auch, neben ihrer Schwester wie eine Schnecke eingerollt, bis Mama kam. Die sah sie an, sah Renate an, riss das Baby aus dem Bett, schüttelte es, schrie und weinte dann. Helene war plötzlich hellwach. Renate schlief nicht. Sie atmete nicht mehr. Ihre Schwester war erstickt, wahrscheinlich beim Trinken.
Ein Polizist kam. Er sah Helene ernst an, ließ sich alles erzählen, befragte die Mutter und ging dann wieder – kopfschüttelnd und mit feuchten Augen. Renate wurde nicht zurück in ihr Bettchen gelegt, nie wieder. Sie steckten sie in eine kleine Kiste und brachten sie fort. Ihr neues Zuhause war auf dem Friedhof an der langen Mauer zur Straße hin. Das hatte ihr Mama später erklärt. Renate würde nie wieder in Helenes Armen liegen, nie wieder mit den Ärmchen rudern und Babygeräusche machen.
Als Oma später erfuhr, was geschehen war, raufte sie sich die Haare, die über Nacht weiß geworden waren, und kam nie darüber hinweg, dass sie nicht auf ihr Bauchgefühl vertraut hatte.
Helene ging noch oft an dieser hohen Mauer des Friedhofs vorbei und kämpfte mit den Tränen, weil sie es sich ganz furchtbar vorstellte, allein in einer dunklen Holzkiste schlafen zu müssen, ohne Mama, ohne Oma, ohne sie. Helene hatte lange nicht recht verstanden, was damals genau geschehen war, und vermied es jetzt tunlichst, daran zu denken. Doch noch immer fühlte sie sich schuldig, wann immer sie an Renate dachte, noch immer versuchte sie, an ihren Schwestern etwas wiedergutzumachen.
Die Kinder saßen beim Doktor und warteten. Hannes ’leichenblasses Gesicht zeugte von den Strapazen der letzten Stunden.
»Ist es sehr schlimm?«, wollte Margot wissen. Der Doktor schaute ernst drein.
»Es geht ihm den Umständen entsprechend gut«, sagte er. Und: »Ja, es ist schlimm.« Seine Patienten und deren Angehörige belog er nur im äußersten Notfall. Er war für die Wahrheit. Die kam im Alltag viel zu kurz seiner Meinung nach, vor allem in diesen Zeiten, selbst bei den Kindern.
Margot musterte Hannes erneut eindringlich, besah sich seine dick bandagierten Hände. »Wird er wieder … gesund?«
Vereinzelte Haare hingen dem Arzt in die hohe Stirn. »Ja, ich denke doch. Er ist jung und kräftig. Aber – wenn du die Finger meinst, ich bin mir nicht sicher, ob er seine Hände wieder so bewegen können wird wie früher.« Sie lauschten seinen Worten bestürzt. »Bei einigen Fingern waren die Sehnen verletzt, ich habe getan, was ich konnte«, fügte er hinzu. »Wir könnten ihn noch immer in ein Krankenhaus bringen, aber erst, wenn er stabiler ist.«
»Nee«, schüttelte Margot den Kopf. »Da werden die doch erst richtig krank. Kriegen Typhus oder Tuberkulose oder Lungenentzündung. Von denen, die reingehen, kommt die Hälfte nicht wieder heraus, sagt mein Opa. Und bei meiner Schwester war es genauso.«
Der Arzt nickte kaum merklich, Helene war sich einen Augenblick lang nicht sicher, ob sie richtig gesehen hatte. Der Moment verstrich. »Da hat dein Opa leider nicht ganz unrecht, aber die Versorgung wäre dort besser. Vielleicht würden sie nachoperieren.« Er wirkte nachdenklich.
Margot schwitzte nun vor Aufregung: »Aber, das können Sie doch jetzt übernehmen: Verband wechseln und so. Sie haben doch eh schon jetzt …« Sie unterbrach sich selbst, rotgesichtig und sichtlich aufgebracht. »Ich mein ja nur, heilen muss es doch jetzt ohnehin von allein, oder?«
Dr. Busemann nickte: »Ja, im Prinzip schon.«
»Na also. Und gesäubert muss es werden, und falls wirklich nachoperiert werden muss, können wa immer noch ins Krankenhaus gehen, oder?« Margot ereiferte sich immer mehr und sah mich flehentlich an. »Ihr wollt doch auch nicht, dass er ins Virchow oder so kommt, wo es eh nix jibt und die ganzen Kriegsversehrten da tagsüber stöhnen und nachts schreien? Wie soll er denn da jesund werden? Ick war da, ich weiß, wie es da ist.« Margot weinte jetzt. Helene versuchte sie zu trösten, doch sie ließ sich nicht beruhigen. »Bitte Dr. Busemann, Sie sind doch Arzt, Sie können dit, ich will nicht, dass er doch noch stirbt.«
Der Arzt schüttelte unwillig den Kopf, stand auf und kehrte ihnen den Rücken zu. »So einfach ist das nicht«, sagte er. »Er braucht Medikamente …«
»Die besorgen wir schon«, warf Margot leidenschaftlich ein. »Also, die bezahlen wir schon«, korrigierte sie sich.
Der Arzt sah sie an, einen nach dem anderen. »Wie Pech und Schwefel, wa?«, lächelte er. Er seufzte vernehmlich. Dann stimmte er zu. »Gut, wenn seine Eltern einverstanden sind, übernehme ich die Nachsorge.«
Helene hätte ihn umarmen mögen, Margot tat es einfach. Danach schmierte der Arzt Butterbrote für alle und sah nachdenklich aus dem Fenster zum Hof.
Helene brachte die Kleinen nach Hause; ihrer Mutter, die inzwischen wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden war, ging es heute so gut, dass sie sich kümmern konnte, solange Helene bei Hannes blieb. Als Helene ihr von dem schlimmen Unfall erzählt hatte, hatte sie die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und ihr Genesungsgrüße aufgetragen. Außerdem hatte sie Helene angewiesen, sofort Hannes’ Eltern Bescheid zu geben, aber diese waren noch auf der Arbeit.
Es dauerte Stunden in dem kleinen Behandlungszimmer, bis Hannes wieder richtig wach war. Zwischendurch hatte er ein paarmal kurz geblinzelt, »so schnell« gemurmelt und war wieder weggedriftet. Helene trank mit den anderen zusammen die dargebotene heiße Milch und dankte dem Arzt von Herzen. Sie war unfassbar erleichtert.
Читать дальше