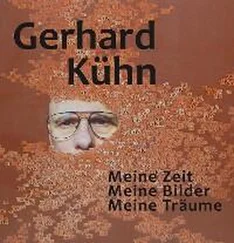Barbara Schilling
Zwischen Hunger
und Verantwortung

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen
Originalausgabe 2022
© 2022 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim
www.rosenheimer.com
Titelfoto: © Bundesarchiv, B 145 Bild-D00011453, Puck-Archiv
Lektorat: Carmen Oberlechner, Rosenheim und Christine Rechberger, Rimsting
ISBN 978-3-475-54903-8 (epub)
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Ende
Es war kalt, die Eisblumen am Fenster machten ihrem Namen alle Ehre. Helene drehte den Kopf zur Wand, blinzelte. Das Baby und die Kleinen schliefen noch. Gut. Wer schläft, ist nicht hungrig. Sobald sie wach waren, würde das Gejammer losgehen. Und sie hatte keine Ahnung, was und ob überhaupt etwas im Brotkasten zu finden war.
Behutsam zog Helene die kratzige Wolldecke bis zur Nase des Babys hoch. Sie zögerte. Sein Köpfchen war trotz des dünnen Häubchens kühl. Helene zog die Bettdecke noch ein Stückchen höher. Besser ersticken als erfrieren. Sie hielt inne. Durfte sie das? Durfte sie so etwas denken? Sie betrachtete ihren eigenen, missgestalteten Zeh, der fast erfroren war, als sie ein Kleinkind gewesen war. Es tat so weh, heute noch, ihn auch nur anzusehen. Die nie ganz verheilten Frostbeulen. Nicht einmal richtig schnell rennen konnte sie damit.
»Lahme Ente«, riefen ihr die Kinder in der Straße nach und lachten. Manchmal hatten sie Steine nach ihr geworfen. Das taten sie allerdings nicht mehr, seitdem sie einen der Strolche erwischt und nach Strich und Faden übers Knie gelegt hatte.
Seufzend legte Helene das Gesichtchen des Babys wieder gänzlich frei und achtete dabei darauf, dass die anderen zwei Geschwister ausreichend von der Decke bedeckt wurden, vor allem an den Füßen. Die ollen Wollsocken allein reichten nämlich nicht aus. Im Zimmer war es fast so kalt wie draußen, auf den Berliner Straßen, wo Dutzende frierende Menschen die Bürgersteige entlanghasteten. Jeder mit einem anderen Ziel, alle mit mehr oder weniger gebeugtem Rücken. Der kühle Morgen kroch ihr ins Gesicht. Sie wappnete sich innerlich, sie biss die Zähne zusammen, sie hasste das – diese Kälte, dieses Zimmer, dieses Leben. Aber sie hatte kein anderes. Und sie musste da sein, für die Kleinen, die brauchten sie. Die Mutter würde es nicht allein schaffen. Mühsam stemmte Helene sich vom Bett hoch, peinlich darauf bedacht, kein Geräusch zu machen, um ja noch keines der kleinen Monster zu wecken.
Bevor sie sich überlegen würde, wo sie ein Frühstück herbekam, musste sie erst einmal den Ofen befeuern. Doch ein Blick in den Kohleneimer daneben ließ sie mutlos zurücksinken. Kein Stückchen war mehr übrig. Auch das noch. Ihre Laune sank, wie sie kaum hätte tiefer sinken können. Gestern hatte sie vergessen, noch welche zu besorgen, zu leihen, notfalls zu stehlen. Missmutig beugte sie sich zum Fenster hin. Das zerkratzte Fensterbrett wies feine Risse, schwarze Linien auf weißem Grund, auf. Sie linste hinaus auf den Hof. Kein Glück. Nichts war da, das brennbar aussah. Kein Brett, kein Papier, nicht einmal Äste hatte der Wind herabgeweht. Sie unterdrückte einen Bierkutscherfluch, der sich gewaschen hatte. Im Gegensatz zu ihr; dazu war es definitiv zu kalt. Sie kramte in den Schubladen herum, fand in der untersten eine fast leere Flasche Braunen, schraubte sie auf, roch daran, überlegte kurz – ob das gegen ihren Hunger half? Aber schon bei dem scharfen Geruch des Alkohols wurde ihr übel und sie legte die Flasche zurück. In der Ecke lag ein altes Hemd, es war weich und musste einmal weiß gewesen sein; sie hob es hoch. Als sie es ausschüttelte, fiel ein vertrocknetes Lavendelsäckchen heraus. Die Motten hatten den Stoff dennoch durchlöchert, der Lavendel hatte nichts genützt. Plötzlich musste sie schlucken. Unangenehm.
Der helle Stoff erinnerte sie an das Totenhemd ihrer Oma. So hatte es ausgesehen damals, irgendwie rührend, beinahe feierlich. Noch immer erinnerte sie sich an den Geruch ihrer Großmutter. Vor allem, wenn sie sie in den Arm genommen, vor- und zurückgewiegt und »Lenchen, mein Lenchen« genannt hatte.
Nun war ihre Oma schon seit einem Jahr tot. Seitdem war viel passiert. Leider wenig Gutes. Die Befürchtungen ihrer Mutter schon damals am Grab, die Erde war hart gefroren und der Wind unerbittlich gewesen, »ick weeß et nich, ick weeß nich, wie wir das ohne Oma schaffen sollen«, hatten sich bewahrheitet. Sie schafften es nicht. Es ging bergab. Tag für Tag schien ihre Situation auswegloser zu werden. Mit Oma war es schwer gewesen, die Familie durchzubringen, nach dem Krieg, das Essen war knapp, die Kohlen waren knapp, der Wohnraum war knapp, alles Wichtige war knapp, aber ohne sie, war es schier unmöglich. Vor allem, seitdem ihre Mutter vor zehn Monaten das neue Baby zur Welt gebracht hatte. Lotta. Knautschig und rot hatte sie ausgesehen, als Helene sie das erste Mal gesehen hatte. Wie eine Puppe, über die man ein zerknittertes Tischtuch gelegt hatte.
Vom Bett her kam ein Geräusch. Susi, die Zweitjüngste, bewegte die Ärmchen im Schlaf, noch hatte sie die Augen fest geschlossen. Um keine weitere Zeit zu verlieren, stopfte Helene das zerschlissene Hemd kurzerhand in den Ofen, nahm Streichhölzer und die Zeitung zur Hand, die sie gestern auf der Parkbank ergattert hatte. Die Flammen fraßen gierig das trockene Papier. Knisternd verbrannte die Schlagzeile »Die Frauenmorde von Moabit« vor ihren Augen. Der gestrige Tag war kalt gewesen, beim Gedanken an den heutigen fröstelte sie schon jetzt.
Dabei hatte die Woche doch so gut angefangen: Frau Schulze aus dem Vorderhaus hatte ihnen ein Mittagessen spendiert, ein richtiges. Mit fettem Kohl und Fleischstückchen in der Suppe – auch wenn Helene lieber nicht zu fragen gewagt hatte, von welchem Tier das sehnige Fleisch in der Suppe stammte. Die Kleinen hatten vor Begeisterung ganz rote Wangen bekommen und zu glucksen und lachen begonnen. Wie sie alle so um den großen Topf herumsaßen, die angestoßenen aber gut gefüllten Teller vor sich, hatte Helene so etwas wie Glück empfunden, zumindest aber Zufriedenheit. Und mit Erstaunen festgestellt, dass sie seit langer Zeit das erste Mal wieder diese Wärme durch den Körper fluten fühlte, die sie bis in die Haarspitzen entspannte. Sie genoss sie noch einige Augenblicke. Dann hatte Susi eine Tasse zu Boden gestoßen und ihre Mutter war in Tränen ausgebrochen. Einfach so. Wenn sie da war, weinte sie. Das war fast schlimmer, als wenn sie nicht da war. Bevor das Gedankenkarussell Fahrt aufnehmen und seine ganze unheilige Macht entfalten konnte, wurde Helenes Aufmerksamkeit auf den Ofen gelenkt. Der Qualm bahnte sich einen Weg durch die Ritzen der Ofenklappe. Er war nicht dicht und schwarz, und doch reizte er Helenes Schleimhäute, sodass sie sich gezwungen sah, das Fenster zu öffnen. Quietschend bewegten sich die Scharniere in den Angeln. Helene fürchtete das Erwachen der Kinder.
Sie schürte das Feuer, doch allzu viel gab es da nicht zu schüren. So gierig die Flammen auch an dem dünnen Baumwollhemdchen emporgezüngelt hatten: Nun leckten sie an den Innenwänden des altersschwachen Ofens vergeblich auf der Suche nach Nahrung. Wie der winzige grau-melierte Spatz auf dem Dach, der jeden Morgen kam, und den sie manchmal heimlich fütterte. Doch heute hatte sie nicht einmal Krümel.
Читать дальше