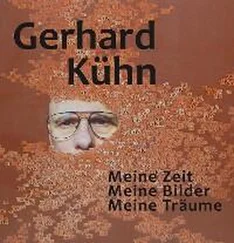Die knochige Gestalt dahinter, bereits an der Neunzig kratzend, hatte mehrfach Krieg und Hunger überstanden, Mut und Glück oder beides gehabt. Sie hustete zum Gotterbarmen. Helene zögerte jedes Mal aufs Neue, mit den Kleinen einzutreten – doch besser später an der Schwindsucht sterben, als jetzt zu verhungern. Margot war da ganz pragmatisch, wenn ihr Helene etwas verschämt von ihrer Nachbarin und ihnen als Bittsteller erzählte.
»Immer ran an die Bouletten, schlimmer wird’s nicht.« Und Margot musste es wissen, hatte sie doch schon drei Geschwister verloren, zwei im ersten Babyjahr, eines an die Schwindsucht.
Ein blassblaues, von dünner, faltiger Haut umrahmtes Auge linste durch die Lücke, die zwischen Tür und Rahmen entstanden war. Helene zwang sich zu einem Lächeln. Die alte Frau erkannte sie, zögerte.
»Na, du bist mir ’ne ganz Ausjebuffte … Schon wieder?«, fragte sie nur. Dann nichts weiter.
»Schon wieder«, antwortete Helene und schämte sich. Gleichzeitig flehte sie stumm und inständig, die Tür würde sich für sie und ihre Mädchen öffnen. Ihr Flehen wurde erhört. Es rasselte laut, als die Kette gelöst wurde. Die Frau wandte sich ohne ein weiteres Wort um und schlurfte in das Innere der kleinen, höhlenartigen Wohnung. Die Mädchen folgten ihr auf Zehenspitzen. Es roch muffig, es war stickig, es sah schäbig aus. Aber sie waren drin. Eingelassen worden.
Drinnen schimpfte die Nachbarin beim Anblick der jämmerlichen Kinderschar. »Wo ist denn eure Mutter schon wieder?«, fragte sie.
»Im Krankenhaus …«, erwiderte Helene kleinlaut und schämte sich schon wieder, obwohl weder sie noch jemand anderes etwas dafür konnte. Die alte Frau nickte nur, lächelte nichtssagend.
»Macht die Tür zu, es zieht.« Dankbar, erleichtert und doch angespannt folgte ihr Helene weiter durch den engen Flur. »Nicht in die gute Stube«, rief die Nachbarin plötzlich erstaunlich vernehmbar. Sie drängelten sich in dem schmalen Flur, was den Vorteil hatte, dass keiner mehr fror, die Luft stand. Mehr stehend als sitzend, eng aneinandergedrückt wie die Hühner auf der Stange, harrten die Kinder geduldig der Dinge, die da kommen mögen. Und es kam immer etwas bei Frau Schulze. Aus irgendeiner verstellten Schublade zauberte sie immer eine Kleinigkeit zum Essen. Auch jetzt saß Susi wieder mit großen Augen da und verfolgte aufmerksam jede Bewegung der alten Frau. Ihre Mägen knurrten im Chor.
Frau Schulze – Näherin, Wäscherin, Kriegswitwe – zog geräuschvoll den Rotz hoch und machte schmale Augen. Susi drängte sich dicht an Helene heran. Ihr war die Greisin unheimlich. Nicht eine Sekunde wollte sie mit ihr allein bleiben. Und Helene achtete darauf, dass sie das auch nicht musste. Die Mädchen stapelten ihre von der Mutter und Oma gestrickten Handschuhe, Mützen und Schals in einer Ecke und drückten sich weiter im Flur herum.
»Nun kommt schon rein, oder muss ich zweimal bitten«, winkte die Alte sie in die verrußte Küche. Sie zwängten sich an einer Reihe frisch gewaschener Liebestöter, die wie Vögel auf der Wäscheleine saßen, vorbei, ängstlich darauf bedacht, den sackartigen Unterhosen der alten Frau auszuweichen.
Als sie die niedrige Schwelle der Küche passierten, atmeten sie erleichtert auf. Die Wände zierten hier schäbige blumengemusterte Tapeten. Solch ein Muster hatte Helene schon einmal gesehen. Sie sah unwillkürlich Judith vor sich. Judith mit bleichem Gesicht, als sie vor solch einer Wand gespielt hatten, damals in den Trümmern, und plötzlich Gliedmaßen eines Toten zwischen dem Schutt entdeckt hatten. Dort, wo sie hochgeklettert waren und Vater, Mutter, Kind gespielt hatten. Judith, die beim Nachhausegehen Schnitte an den Händen aufgewiesen hatte und als Folge eine Sepsis erlitt, an der sie fast gestorben wäre – wegen der Toten dort in den Ruinen, in denen sie gespielt hatten. Und diese hatten sich das ja auch nicht ausgesucht.
»Krieg ist böse«, hatte Tinka, das jugendliche Mädchen mit dem Verstand einer Vierjährigen mal geschrien; sie wusste gar nicht, wie recht sie hatte …
Helene schüttelte die bösen Erinnerungen ab und konzentrierte sich auf ihre Aufgabe. Von Augenblick zu Augenblick; das war die einzige Möglichkeit. Der Tag hatte noch viele Stunden. Erst einmal etwas in den Magen kriegen. Sie ignorierte die dicke Luft in der Küche und freute sich wie die anderen auf eine anständige Mahlzeit bei ihrer mitfühlenden, einsamen Nachbarin.
Dort in der Küche – Tisch, Stühle, Kochstelle, Waschbecken, Unterschrank – legte die ebenso gütige wie schlecht gelaunte Nachbarin nun richtig los. Sie redete die Einsamkeit fort. Die Kinder waren ihr Publikum: Sie schimpfte wie ein Rohrspatz. Meckerte und zeterte. Auf das Wetter, den Krieg, der nichts gebracht hatte, den Frieden, der auch nichts brachte, außer höhere Kartoffelpreise, den Bäcker, der nicht mehr anschreiben ließ, die Jugend im Allgemeinen und ihre Enkelkinder im Besonderen, die entweder tot oder fort waren, sie jedenfalls nie besuchten. Sie ließ auch an Helenes Mutter kein gutes Haar, verurteilte deren Lebenswandel, ihr Aussehen und ihre Erziehungsmethoden, kommentierte das fehlende Benehmen der Kinder, die Kleidung und deren düstere Zukunft. Dabei kochte sie unablässig Mehlsuppe. Von Männern hielt die Alte absolut gar nichts. Die kamen bei ihr nicht gut weg. Kein Einziger. Helene war ziemlich froh, dass sie hier alle Mädels waren. Sie war nicht sicher, ob sie sonst immer wieder hereingelassen worden wären.
»Vertraut niemals einem Mann. Ganz gleich, wie sehr er euch Honig ums Maul schmiert, seid auf der Hut. Wenn es drauf ankommt, gönnt er euch nicht mal das Schwarze unter den Fingernägeln. So sind se, die Mannsbilder. Beknackt oder verschlagen, ick weeß nich, wat schlimmer is.« Während sie sich ereiferte, wurde ihr fast zahnloser Mund noch schmaler.
Schnell drehte Helene den Kopf weg. Sie wollte auf keinen Fall sehen, wie die alte Frau beim Reden Speichel versprühte. Nicht jetzt. Nicht beim Kochen. Helene krampfte die Hände fest um den Stuhlsitz. Gleich würde die Suppe fertig sein.
»Nicht mal in die verdammte Kirche kann man jehen, überall sind die Bänke weg, Feuerholz halt …« Helene versuchte sich die verhärmte Nachbarin demütig vor dem Kreuz niederkniend vorzustellen, es gelang ihr nicht. Sicher hätte sie noch Jesus die Leviten gelesen. Schließlich war er ein Mann gewesen. Irma grinste zu ihr herüber; sie schien ihre Gedanken zu lesen.
Schon in der Vergangenheit war es oft genauso vonstattengegangen: Frau Schulze redete und redete und schimpfte und prangerte an. Aber nach jedem Wortschwall kam etwas zu essen auf den Tisch. Das war der Preis: Zuhören gegen Futter. Worte schlucken für Suppe. Helene war es recht.
»Kann eure Mutter nicht für euch sorgen? Oder du, als Älteste?« Die Alte wartete keine Antwort ab. »Na, an dir is ja ooch nüscht dranne.« Sie hustete – es klang nicht gut.
»Nee? Dann müsst ihr ins Armenhaus, in ein Kinderheim …« Ein zu Tode erschrockener Blick von Irma traf Helene. »Wo soll denn das hinführen? Ich kann doch nicht eine ganze Kinderschar mit durchfüttern, fremde Kinder, … wo eins ist, da sind die anderen nicht weit.« Die alte Nachbarin war bei ihrem Lieblingsthema angekommen: Sich selbst …
»Nun ist das Kind in’ Brunnen jefallen«, flüsterte Helene grinsend.
Susi schaute dumm aus der Wäsche. »Welches Kind is in’ Brunnen gefallen?«, wollte sie angstvoll wissen. »Das arme Kind …«
Doch Irma lachte nur: »Flitzpiepe! Nicht in echt. Dit sagt man nur so …«
»Echt?«, entgegnete Susi gleichermaßen erleichtert wie entrüstet.
»Nee, nicht echt«, antwortete Irma. Die Verwirrung war perfekt.
Die Greisin setzte erneut an: Nun verfiel Frau Schulze in ihren leidenden Tonfall, eine Moritat auf das Leben, ein klagender Singsang. »Und ich bin selbst eine arme alte Frau, seht euch diese Hände an, ick hab nichts und niemanden – und dann wird man noch belästigt, ständig von hungrigen Mäulern, als hätte ich genug zu essen.« Sie lachte bitter.
Читать дальше