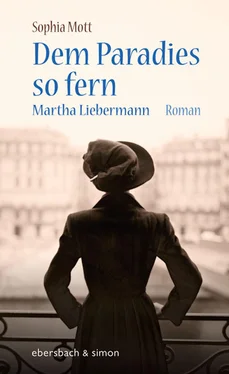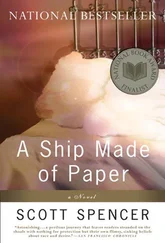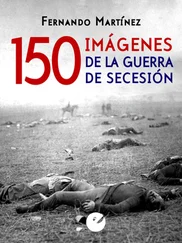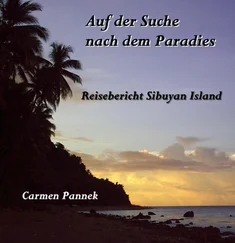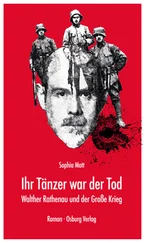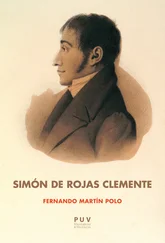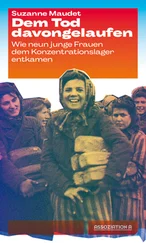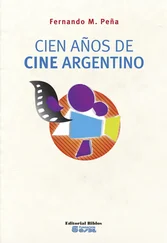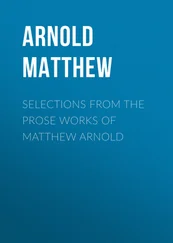Vor allem aber die Bilder! Das meiste stammt von Max selbst, wie das große Doppelporträt der Eltern, Käthe als junge Frau mit ihrer Tochter Maria und der Kinderfrau im Garten am Wannsee, Martha im schwarzen Kleid. Aber auch zwei Landschaften von Manet sind noch da, Bilder von Max Lehrer Steffeck und die beiden Porträts von Max und Martha, die Anders Zorn gemalt hat. Für Menzels Zeichnungen ist nur Platz im Küchenkorridor geblieben, trotz der Größe der Wohnung.
Gut, dass Max bereits im Jahr 33 die wertvollsten Stücke seiner Sammlung in die Schweiz geschickt hat, 14 Gemälde, alles Franzosen, sein Lieblingswerk darunter, das Spargelbündel von Manet.
Manchmal erscheinen Besucher, die unter dem Vorwand, helfen zu wollen, ihr eine Zeichnung oder ein Bild für wenig Geld abzuschwatzen versuchen. Martha bleibt freundlich, aber denen gibt sie kein Blatt.
Da ist zum Beispiel diese angebliche Freundin von Käthe gewesen. Sie trug einen Fuchs um den Hals, das tote Vieh bleckte seine spitzen Zähnchen auf solidem braunen Tweed, als gäbe es noch was zu lachen: Sieh mal, so werden sie sich demnächst die Juden um den Hals hängen, einen als Dekoration, einen zum wärmen. Und die Fuchsbeine baumelten so tot herab.
Sie sei bei einigen der fantastischen Atelierfeste gewesen am Pariser Platz, sagte die Besucherin, der Fuchs musste mit ihr nicken, erinnern Sie sich?
Die Augen der Besucherin wanderten an den Wänden entlang, parallel mit denen des Fuchses. Sie habe ja noch so herrliche Zeichnungen und Bilder. Und wenn Sie sich doch mal von etwas trennen müsse, wenn sie Geld benötige, man wisse ja, es sei nicht leicht heutzutage. Als Martha schwieg, ein freundliches, aber bestimmtes Schweigen, da ging die Frau, der Fuchsschwanz schlug hin und her mit der weißen Quaste auf dem Tweed-Rücken.
Schlimmer aber sind die, die sie tatsächlich kennt aus guten Tagen und die auch nur kommen, das Verbliebene zu sichten. Da ist es nicht leicht, die Haltung zu wahren. Und wozu denn auch? Ein Leben lang ist ihr Haltung als etwas Unerlässliches erschienen, etwas, das einen auszeichnet, eigentliches Merkmal eines gewissen Ranges in der Gesellschaft, das man nicht kaufen, sondern nur üben kann. Nun fragt sie sich, ob nicht gerade ihre Haltung in Wahrheit eine Schwäche ist, die es den Verbrechern leicht macht, mit ihr zu tun, was sie wollen. Verstellen müsste man sich, lügen können. Haltung gilt nur etwas in einer Gesellschaft, in der Regeln gelten. Hier werden die Regeln nach dem Bedarf der Machthaber jeden Tag neu geschrieben. Wenn man ihnen gehorcht, erfinden sie sofort eine andere, gegen die man verstoßen hat. Schwer ist es geworden, nicht den Rücken zu beugen. Wozu auch?! Das kostet nur Kraft, und manchen hat es schon das Leben gekostet. Ist sie das wert, die Haltung? Denen nötigt das doch keinen Respekt ab, da braucht man sich keinen Illusionen hinzugeben, das sind ja überkommene Vorstellungen einer toten Gesellschaftsform. Heute gilt einzig nur noch das Recht des Stärkeren, auch wenn die Nazis ständig von deutscher Ehre faseln. Tyrannei leerer Worte. Wie in einem Wolfsrudel beißt der Stärkere den Schwächeren vom Fressen weg. Ja, wie dumm ist man denn gewesen, dass man nicht rechtzeitig einen Stock genommen und die räudigen Viecher vertrieben hat?
Hundert Siege berichtet, keiner erdichtet
Ein Jahr nach Heinrich Marckwalds Tod, als die Siegesparade zur Feier des gewonnenen Krieges gegen Frankreich durchs Brandenburger Tor und die Linden hinauf ziehen sollte, lud Louis Liebermann Ottilie Marckwald und ihre vier Töchter ein, das Spektakel von seinem Haus aus anzusehen.
Sie hatten sich früh auf den Weg gemacht. Dennoch waren die Straßen bereits fast unpassierbar. Sie gingen über die Mauer- und die Behrenstraße bis zur Einmündung der Wilhelmstraße. Aber als die kleine Abordnung der Marckwalds an die Linden kam, ließen die Ordner sie nicht mehr passieren. Dicht gedrängt standen die Menschen bis zur Absperrung. Viele hatten sich Stühle mitgebracht, auf die sie steigen wollten, wenn der Zug sich näherte. In den Fenstern Gesicht an Gesicht, die Balkone bis zur Belastungsgrenze mit Menschen gefüllt, auf dem Brandenburger Tor standen sie, sogar auf die Dächer der Torhäuser waren einige geklettert, Fresskörbe, Kisten mit Bier und Wein wurden an Seilen hinaufgezogen, der Proviant für eine lange Wartezeit. Wer seinen Platz gefunden hatte, winkte berauscht, auch vom gemeinschaftlichen Glücksgefühl.
Sie seien eingeladen, versuchte die Mutter den Ordner zu überreden, bei Liebermanns, Pariser Platz Nr. 7. »Hier könn Se nich mehr durch.«
Martha war 14 und Margarethe gerade mal zehn Jahre alt. Beide hatten keine Lust, zu den Liebermanns zu gehen. Die Wohnung des Vormunds war zu dunkel und ungemütlich, das Leben hatte dort eine Schwere, die sie nicht gewöhnt waren, aber die Mutter bestand darauf, dass sie alle zusammen hingingen, alle außer Benno, für den machte der Besuch keinen Sinn. Denn natürlich ahnte die Mutter, dass der Vormund die Einladung ausgesprochen hatte, um die Marckwald-Töchter seinen Söhnen zu präsentieren. Ein Angebot, das man nicht ausschlagen konnte.
Immer noch fand sich keine Möglichkeit, die Straßenseite zu wechseln. Riesige Bilder, auf Segeltuch gemalt, überspannten die Linden, Historienbilder in Übergröße. Die einzelnen Truppenteile wurden auf Ehrensäulen gewürdigt.
Kurz und klar, warm und wahr! Hundert Siege berichtet, keiner erdichtet!
Das galt der Feldtelegrafie. Die Mutter näherte sich erneut einem Ordner. Sie hatte etwas aus ihrem Täschchen geholt, wechselte ein paar Worte mit dem Mann und schob ihre Hand in seine Jackentasche. Martha kannte diese Geste, diese rasche, aber diskrete Handbewegung, plötzliche Vertraulichkeit vortäuschend, wo das Geldgeschenk im Grunde unüberbrückbaren Abstand signalisierte. Peinlich! Beflissenheit folgte, ein schiefes Lächeln. »Na, denn woll’n wa mal.« Und der Ordner hob kraft seines Amtes das Absperrungsseil.
»Nun kommt bitte.« Die Marckwalds duckten sich unter dem Seil durch.
Wenn Martha wenigstens ein Kränzchen aus Lorbeer bekommen hätte. Einen Lorbeerkranz mit ein paar Blüten im Haar. Dann hätte sie ausgesehen wie eine der Ehrenjungfrauen, die ihren Lorbeer dem frisch gekrönten Kaiser überreichen durften. Aber es hatte in der ganzen Stadt keinen Lorbeer mehr gegeben. Geschäftstüchtige Berliner hatten die Buchsbaumhecken um die Rabatten auf den großen Plätzen und im Tiergarten zusammengeschnitten, aber das war nicht dasselbe.
Es war ein wunderbarer Sommertag, dieser 16. Juni 1871, als stünde der Herrgott mit den Berlinern, mit den Preußen, mit allen Deutschen im Bunde. Die meisten fanden das auch richtig so. Endlich hatte man dem blutlechzenden Franzmann Einhalt geboten und dazu die deutsche Einheit gewonnen mit dem preußischen Wilhelm als Kaiser. Berlin war nun Hauptstadt des Reiches. Wenn das nicht ein Grund zum Feiern war!
Charlottes Stirn glänzte. Sie zog ein Tuch aus dem Täschchen. Auch Else war nervös. Eben noch hatten die beiden gelacht und getuschelt. Hatten sie über die Liebermann’schen Söhne gesprochen?
Georg war bereits in die Firma eingetreten. Kam ganz nach seinem Vater. Würde bestimmt mal Kommerzienrat. Und Max? Ob der überhaupt da war? Studierte in Weimar Malerei. Das mit dem Malen war ein Minuspunkt. Bestenfalls konnte man es als Liebhaberei verbuchen. Schließlich war da noch Felix. Eigentlich zu jung, fand Charlotte, ein bisschen zu weich und sentimental in der Erscheinung, fand Else. Reich würden sie alle drei sein.
Es gab Bowle und Kuchen, für die Herren Herzhafteres. Martha versöhnte sich beinahe mit dem Besuch bei den Liebermanns. Die Wohnung war übervoll mit Gästen. So düster und ruhig, wie es ihr sonst vorkam, war es heute nicht. Der Festzug nahte und alle stürzten in Richtung Tiergarten. An den Fenstern Gedränge, wie unten auf der Straße. Einige Gäste waren auch hinauf aufs Dach gegangen. Die Mutter verbot es den Mädchen: »Kinder, wenn ihr an so einem Tag runterfallt.«
Читать дальше