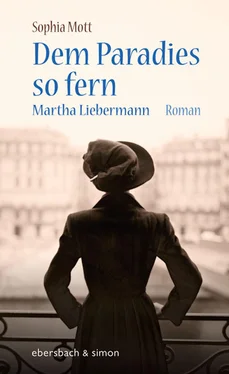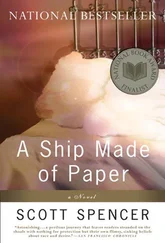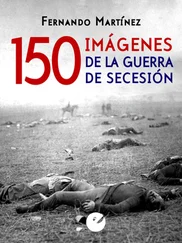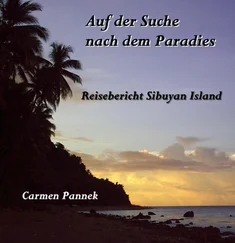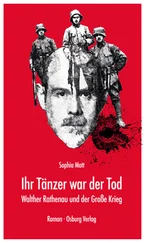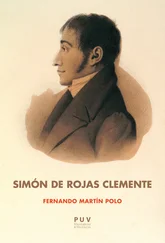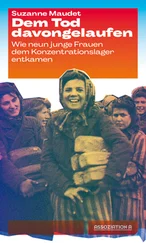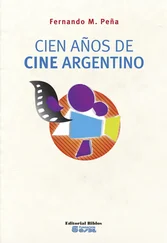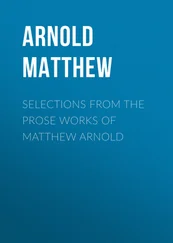Als die ersten Truppen durchs Tor hindurch waren, wechselten alle zu den Fenstern in Richtung Pariser Platz. Die Fahnen der Besiegten wurden vorbeigetragen.
Irgendjemand zählte 81 Trikoloren. »83«, sagte ein anderer. »Ne, 81 und det joldene Federvieh dazu.« Gemeint waren die Adler auf den Standarten. Ein einziger Jubelschrei toste über den Platz. Auch drinnen wurde »Hurra« gebrüllt. Martha hielt sich die Ohren zu. Die Männer tranken einen Cognac, Courvoisier. »Meine Herren, hier erleben wir Weltgeschichte.«
Dann kam der Kaiser. Vor ihm Bismarck, die Generäle Moltke und Roon. Die Menschen auf der Ehrentribüne erhoben sich von ihren Plätzen. Wieder Hochrufe, Applaus, die Militärkapelle hörte auf zu spielen, schließlich völlige Stille. Man konnte das Tschilpen eines Spatzen hören und ein sehr leises Rauschen der vieltausendköpfigen Menge, als wäre es ihr Atem. Die Ehrenjungfrauen traten vor und eine begann ein Gedicht aufzusagen. Ihre Worte verwehten über den Platz, aber Fetzen des hohen Stimmchens drangen bis zu den Fenstern hinauf. Dann nahm die Ehrenjungfrau ihren Kranz vom Haar und reichte ihn Kaiser Wilhelm. »Ein Hoch unserem Kaiser«, krächzte eine heißere Stimme in die weihevolle Stille, Gelächter. »Hoch, hoch hoch«, antwortete die Menge, die Kapelle fing wieder an zu spielen und die Herren im Liebermann’schen Salon stießen auf die neue Verfassung an. Für die Juden brachte sie die rechtliche Gleichstellung. »Nun wird alles anders.«
Ein paar besonders wilde Jungs rannten mit Holzsäbeln zwischen den Gästen herum und schrien: »Stillgestanden!« und »Achtung!« Das waren die Söhne von Max Onkel Adolph. Sie stießen mehrere Bowlegläser um und bekamen schließlich von ihrem Vater je eine Kopfnuss. »Mensch, Jungs, heute ist Anstand patriotische Pflicht.«
Willy heulte.
Emma Zorn antwortet nicht. Wahrscheinlich, das muss man in Rechnung stellen, gehen die Uhren in Mittelschweden langsamer. Wahrscheinlich gehen sie bei einer 81-Jährigen noch langsamer. Baron Uexküll hat auf eine Art seismografischer Sensibilität gehofft, denn die Nachrichten, das weiß er von seiner Freundin, Gräfin Bonde, kommen bereits gefiltert in Schweden an, nicht allein, weil man in der schwedischen Presse keine diplomatischen Verwicklungen riskieren will, die am Ende vielleicht zu kriegerischen führen könnten, es ist schließlich auch die Unmöglichkeit, mit Worten zu sagen, was droht, es ist das stete Versagen der Sprache gegenüber dem Gefühl, das die Gefahr schon wittert, wo die eigentliche Katastrophe noch bevorsteht. Man hofft, sie käme nicht.
Nach außen scheint Deutschland noch immer so etwas wie ein zivilisierter Staat zu sein. Der Krieg hat die Durchhaltemoral der Bevölkerung nicht sonderlich beschädigt. Zarah Leander singt ihre Lieder und reist ungehindert zwischen ihrer schwedischen Heimat und Deutschland hin und her. Ihre Filme sind auch in Schweden populär. Aber der Druck nimmt täglich zu.
Man kann nicht länger warten. Baron Uexküll macht sich ohne das so dringend benötigte Schreiben auf den Weg zur schwedischen Botschaft. Die liegt nur ein paar hundert Meter von seiner Wohnung entfernt in der Rauchstraße. Die Botschaft ist in einer typischen Tiergartenvilla untergebracht, die Räume sind großbürgerlich ausgestattet mit schweren Ledersesseln, Perserteppichen, Antiquitäten. Bilder zeigen schwedische Motive, die königliche Familie, das königliche Schloss, Landschaften. Uexküll erkennt ein paar zartfarbige Pastelle von Zorn, junge, rosige Bäuerinnen beim Bade, und ein paar Arbeiten des schwedischen Prinzen Eugen, dunkler im Ton, vielleicht geschmackvoller, aber lange nicht von solch überwältigender Technik wie die Zorn’schen Bilder. Niemals hat Uexküll bessere Darstellungen des Wassers gesehen, Wellen, Wogen, Kräuselungen, Spiegelungen und Reflexe, Darstellungen, die nicht allein echt wirken, sondern einen das Wasser fühlen lassen, die Kälte auf der Haut, wenn die Hand aus dem Boot heraus unter die Oberfläche taucht, das Kitzeln der kleinen Luftblasen auf dem Handrücken, während der Kahn, begleitet vom Knarren der Riemen, vorwärtsgleitet.
Der Leiter der Gesandtschaft, Arvid Richert, erwartet den Baron in einem Salon mit Blick auf die Terrasse. Dort werden im Sommer die Empfänge gegeben, Uexküll ist schon oft geladen gewesen, seiner diplomatischen Vergangenheit und der freundschaftlichen Beziehungen zu Attaché Rutger von Essen wegen. Die Beziehungen sind so eng wie die Wege nah. Kaum einer der Gäste, wenn er denn aus Berlin kommt, wohnt nicht im Tiergartenoder Alsenviertel. Man wird vorgestellt, trifft sich auf der nächsten Veranstaltung wieder, vergisst einander und erinnert sich, sobald man den anderen braucht oder selbst gebraucht wird.
Arvid Richert hat schon von Martha Liebermanns Schicksal gehört. Er werde tun, was in seiner Macht stehe. Der Standardsatz. Was steht in seiner Macht? Richert ist ein Mann knapp über die 50 mit feinen Gesichtszügen, trägt Fliege und das Haar seitlich gescheitelt, über den Ohren kräuseln sich ein paar Locken. Seine Augen sind undurchdringlich, in den leicht hochgezogenen Augenbrauen hängt Bedauern. Es gäbe schlimme Schicksale dieser Tage in Deutschland.
»Wir brauchen natürlich am Ende doch Frau Zorns Unterstützung. Tochter und Schwiegersohn in Amerika sind gut, aber keine wirkliche Sicherheit für den schwedischen Staat, weil nicht greifbar. Durch die Kriegsereignisse wird es wohl kaum möglich sein, dass Frau Liebermann kurzfristig in die USA weiterreist. Der zivile Schiffsverkehr ist fast vollständig zum Erliegen gekommen, ebenso der Luftverkehr, beides, soweit noch vorhanden, im Übrigen überaus riskant. Frau Zorns Zusage, für den Unterhalt ihrer alten Freundin aufzukommen, und ihr Antrag auf Erteilung einer Einreisegenehmigung sind unerlässlich.«
»Wir warten jeden Tag auf ihre Antwort, aber leider …«
Richert meint zu wissen, dass Emma Zorn sehr hinfällig geworden sei. Sie sei beinahe blind. Alle Post gehe durch die Hand ihrer Sekretärin Gerda Boethius. Die sei aber hauptsächlich mit der Arbeit am Zornmuseum beschäftigt. Frau Zorn wisse, dass ihr nicht mehr viel Zeit bleibe.
Zeit? Wie viel Zeit hat Martha Liebermann noch, denkt Uexküll. Verzögerungen führen vielleicht zur Katastrophe, während der Nachruhm des großen Mannes gepflegt wird.
»Frau Zorn war immer karitativ tätig«, fährt Richert fort. »Sie hat einen guten Teil ihres Vermögens in Kinderheime und Schulen investiert, sie wird auch ihre alte Freundin nicht vergessen.«
Uexküll hofft das. Ein paar Tage werde er noch warten. Aber eigentlich sei jeder weitere Tag einer zu viel. Richert habe doch auch Kenntnis von den ersten Umsiedlungen in den Osten bekommen? Man könne nicht zulassen, dass Frau Liebermann, Witwe eines weltberühmten Malers, so behandelt werde. Es sei das Ansehen Deutschlands in der Welt ohnehin ein anderes geworden, aber Schweden, Schweden habe noch eines zu verlieren. Ob man sich eventuell auch an den Prinzen Eugen wenden sollte? Dem habe Max Liebermann immerhin zur Aufnahme in die Akademie der Künste verholfen. Es müsse im Interesse einer Nation wie der schwedischen sein, der Witwe Max Liebermanns Asyl zu gewähren.
Richert lächelt. Ein Lächeln, das Verständnis ausdrückt, kein Versprechen gibt. Wir geben aber unser Bestes, sagt es. Mehr haben wir nicht. Es ist nicht immer das, was die Antragsteller wollen.
Schweden steht unter Druck. Das nordische Brudervolk der Deutschen fühlt sich in bedrohlicher Umarmung. 90% der schwedischen Exporte gehen nach Deutschland. Aus schwedischem Eisenerz bauen die Deutschen ihre Kanonen. Mit der Brüderlichkeit könnte es vorbei sein, wenn das Brudervolk nicht mehr tut, was von ihm erwartet wird.
»Ich werde Svante Hellstedt schreiben. Er ist im Außenministerium für ausländische Passanträge zuständig. Ein Freund. Ich werde ihm die Lage schildern. Er kann sich direkt an Olof Lamm wenden, Emma Zorns Neffe, der sie in finanziellen Angelegenheiten berät. Wenn Emma Zorns Gesuch eintrifft, haben wir schon den Boden bereitet.« Der Erfolg der gesamten Aktion hänge aber leider nicht allein von den schwedischen Stellen ab, fügt Richert hinzu. Die deutschen Behörden ließen einfach immer weniger Ausreisen zu. Die Strategie gegenüber den Juden habe sich verändert. Auswanderungen würden behindert, wenn überhaupt noch genehmigt, dann mit hohen Geldforderungen verbunden. Der kriegerische Staat brauche Devisen. »Es ist einfach sehr spät für Frau Liebermann!«
Читать дальше