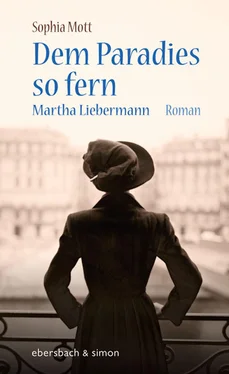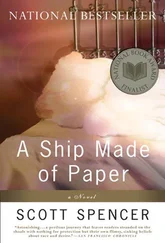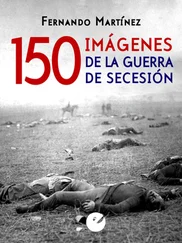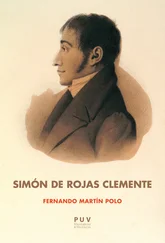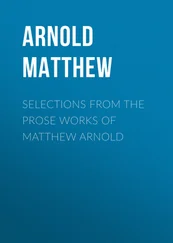Ihre Martha Liebermann .
Ich bin doch nur ein Maler
Manchmal sucht sie in ihrer Erinnerung nach einer ersten Begegnung. Vergeblich. Max ist schon immer da gewesen. Schnipsel im Kopf. Hier die Liebermann-Jungs vor der Synagoge, dort Max bei einer Bar Mizwa, die widerspenstigen Locken in der Mitte gescheitelt, mit Pomade gebändigt, die hochgezogenen Augenbrauen, plötzlich ein Schnäuzer, frühe Männlichkeit, er war ja so viel älter als Martha. Ihre Familien waren eng befreundet, es gab entfernte verwandtschaftliche Beziehungen über eine Großtante Marthas, »allet een Stamm«, sagte Max, und es war ihm gerade recht so. Gleiche Herkunft, gleiche Werte, Garanten für ein zufriedenes Leben. Das Extravagante hob sich Max für seine Kunst auf.
»Der Max Liebermann will Maler werden.« Maler! In einer Dynastie erfolgreicher Kaufleute! Der Skandal wurde hinter vorgehaltener Hand weitergegeben, am Mittagstisch auch bei den Marckwalds diskutiert. »C’est incroyable!« Durch die Betonung zum Tadel geformt, klebte dieser kurze Satz an ihm, beinahe ein Leben lang: »Max will Maler werden!« Der Erfolg sollte den Makel tilgen und tat es auch, aber sein Vater erlebte das nicht mehr, nicht die höchste Anerkennung, das Einzige, was wirklich zählte in so einer Familie, also nicht mehr die Große Goldene Medaille in Berlin, den Professorentitel, die finanzielle Unabhängigkeit.
Als sie noch Schüler waren, hatte der Vater seine Söhne durch ein Fensterchen in der Tür ihres Jungenzimmers beobachtet, ob sie auch fleißig lernten. Das Fensterchen blieb in Max Kopf. Deshalb wollte er immer alles noch besser machen, musste alles besser machen, und obwohl es längst keiner mehr verlangte, machte er alles immer besser. »Ich bin ja nur ein Maler.« Das »nur« nie vergessen zu betonen. Er meinte es wirklich so.
Marthas Vater starb, als sie 13 war. Sein Todeskampf verschluckte alles Leben. Man ging auf Zehenspitzen. Der Arzt kam, leise Gespräche, Krankenbericht der Mutter, dann entfernten sich die Schritte, die leichten der Mutter kehrten zurück, Anweisungen, Klappern von Waschgeschirr, plötzliches Hasten des Hausmädchens, eine Tür fiel zu. Innehalten. Verwandte kamen. Niemand kümmerte sich um die Kinder. Benno nahm fünf Kekse auf einmal aus der Schale. Marthas Hündchen fiel im Schlaf vom Sessel, drehte sich im Flug und landete auf den Beinen. Sie lachte und schlug sich erschrocken die Hand vor den Mund.
Max Vater wurde ihr Vormund. Wenn sie damals schon gewusst hätte, dass sie mit diesem strengen Mann einmal unter einem Dach leben würde, bis er, krank und hinfällig, gepflegt werden musste und schließlich dahinstarb wie ein welkes, bitteres Kraut!
»Achtung, Onkel Louis kommt!« Benno hatte ihn vom Fenster aus gesehen. Da war er schon auf der Treppe. Sie hörten seinen gemessenen, aber nicht schweren Schritt, das Klappern seines Spazierstocks auf den Stufen. Die Mutter ging ihm entgegen bis zur Tür, das tat sie sonst bei niemandem. Sie nahm ihm selbst den Mantel ab und reichte ihn dann erst dem Mädchen weiter.
Louis hatte einen altmodischen Backenbart, der von den Koteletten ausgehend in einem Dreieck nach unten bis zum Hals wucherte. Es sah aus, als seien die Haare, die ihm auf dem Kopf fehlten, nach unten gerutscht, und Martha hatte Lust zu lachen. Sie machte einen Knicks. Während sie in die Knie sank, verschwand ihre Hand in der knochigen, harten von Louis Liebermann. Er hielt sie lange, noch als Martha aus der Beugung wieder aufgetaucht war. Sie hatte Angst, er ließe sie nicht mehr los.
Später malte Max diese Hand mit einer gewissen Nachlässigkeit. Der Vater war böse darüber. Das war doch nicht die Hand eines Kaufmanns, die alles fest im Griff hielt. Verschwommen, beinahe konturlos lag sie auf seinem Schoß, die unvermeidliche Zigarre zwischen Zeige- und Mittelfinger. Alt fand sich der Vater dargestellt. Max malte, was er sah. Die Wahrheit fand er nie hässlich.
Viel später banden sie dem Vater bei Tisch einen Latz um, damit er seine Weste nicht bekleckerte.
Die Standuhr misst den Rest ihres Lebens. Ihr unregelmäßiger Pendelschlag hallt vom Eingang den langen Gang hinunter, vorbei an all den Zimmern, in denen sich ihr abgelebtes Leben verbirgt und die Martha seit Wochen nicht mehr betreten hat: Das Speisezimmer mit dem Renaissancetisch und den passenden Lederstühlen, auf denen sie so viele Stunden gesessen hat mit Max und Käthe, der Enkelin Maria, mit Gästen. Rechts und links stehen die beiden Kredenzen, mit den verschiedenen Servicen darin, Schalen, Tassen, Karaffen, Kerzenständern, Porzellanfiguren, schöne Dinge, die Max in nie versiegender Begeisterung von den Antiquitätenhändlern nach Hause trug. Max, der Augenmensch. Neues wurde rasch zu Vertrautem, Puzzleteile ins Gesamte gefügt, Leerstellen nicht zugelassen. Jetzt ist nichts mehr auszufüllen, jetzt gilt es, zusammenzuhalten, was noch da ist.
Das Silber ist jedenfalls weg! Alles Edelmetall hat Martha schon 38 abgeben müssen. Sie durfte gerade mal ein Messer, eine Gabel, einen großen und einen kleinen Löffel behalten, 200 Gramm pro Person, und das Zahngold im Mund, ausreichend, um weich gekochte Steckrüben und Kartoffeln zu Brei zu drücken, in den Mund zu schieben und schließlich alles mit den Goldzähnen zu kauen. Henkersmahlzeiten. Was braucht denn auch eine alte Frau noch Tafelsilber für 48 Personen! Wenn sie einen nur endlich in Ruhe ließen! Kein Widerstand also, kein Stück heimlich zurückbehalten, den großen Kasten mit dem Rokoko-Silber, das bei feierlichen Anlässen am Pariser Platz auf dem Tisch gestanden hat, zusammen mit ihrem persönlichen Schmuck, Broschen, Perlen, den Brillantringen, meist Geschenken von Max, in eine Kiste gepackt. Der Portier trug alles zur Pfandleihanstalt in die Jägerstraße, da war die Sammelstelle.
Was noch da ist, ist mit kleinen Narben und Schründen versehen, Spuren ihres Lebens. Den Querbalken im Fußkreuz des Renaissancetisches hat einer ihrer Dackel benagt, immer wenn er sich nicht genug beachtet fühlte. Die Sitzgarnitur im Salon ist auf der rechten Seite einen Hauch mehr ausgeblichen als auf der linken, da hatten sie immer eine Decke liegen. Irgendwann ließen Max und sie die Dinge altern wie Lebewesen.
Die unteren zwei Schubladen der Barockkommode klemmen. Wenn man sie öffnet, verströmen sie einen eigentümlichen Geruch, stumpf und holzig. Darin liegen Erinnerungen an andere Tage, plötzlich aufleuchtend, als benötige jenes Areal im Hirn, das sie verwahrt, nur eben den Reiz der kleinen Trouvaillen, um alles in starken Farben und, als sei es erst gestern gewesen, wieder vor Augen zu haben. Ihre Atelierfeste, die Gäste, Konversationen, gelungene Dinners werden von den Einladungs- und Menükarten erweckt, das hübsche japanische Deckchen, auf das Wachs getropft ist, ruft den alten Ärger wieder hervor, als sie das Malheur entdeckte. Daneben, in Papier eingewickelt, liegt ein Kristallstöpsel ohne Karaffe, daneben sechs chinesische Porzellanschälchen, eines mit einem Riss, daneben ein Seidenfächer. Schicht um Schicht sich absetzenden Ehelebens. Ein wunderbarer Schrecken, wenn man in der Hand hält, was man Jahre nicht mehr gesehen hat.
Wenn sie fortginge, müsste sie alles zurücklassen, die Kleinigkeiten, deren Wert mehr in der Erinnerung liegt, ebenso wie die Antiquitäten und Kunstgegenstände. Das gelebte Leben beansprucht weit mehr Platz als das noch zu lebende Leben, das beansprucht beinahe gar nichts mehr.
Martha hängt nicht an den Dingen ihres Geldwertes wegen. Nichts haben Max und sie angeschafft, um sich damit zu schmücken, vielmehr sind es die schönen Dinge selbst gewesen, denen die Ehre galt, gehegt und bewundert zu werden. Sie hat gehofft, dass Käthe das später übernehmen würde. Aufzugeben ist nun schwerer als auszuharren, vielleicht kann man einiges wenigstens nachkommen lassen.
Читать дальше