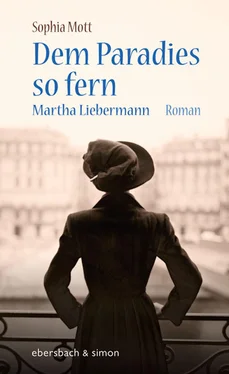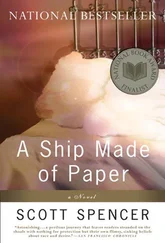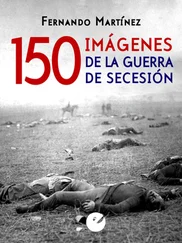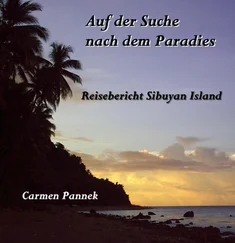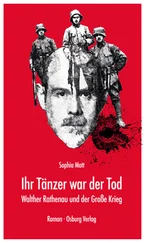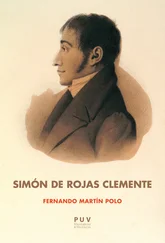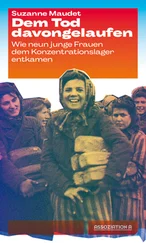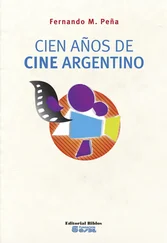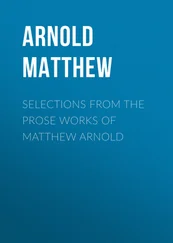»Die Siegesmeldungen sind meiner Meinung nach alle nur Propaganda«, sagt Uexküll. »Die Schlacht ums russische Reich ist noch lange nicht gewonnen.« Er kenne das Land zu gut. Sein Reservoir an Menschen sei unerschöpflich, an Leidensfähigkeit auch. »Wenn der Winter kommt, wird sich das Blatt wenden, glauben Sie mir«.
»Wir sind nicht mehr in Napoleons Zeiten.«
»Nein, aber Russland ist nicht kleiner geworden, die Winter nicht weniger streng, die Straßen nicht viel besser. Der Nachschub wird das Problem werden.«
Er wolle auf eine Wende hoffen, auch wenn natürlich niemand Lust auf den russischen Bolschewismus habe, meint Bernstorff. Vielleicht sei die Angst davor noch der einzige Antrieb für den Rest an Kriegslust im Volk.
»Die einen hoffen auf Sieg und Schluss, die anderen auf Niederlage und Schluss«, seufzt Uexküll. »Kriegsbegeisterung hat nicht die gleiche Konjunktur wie 14–18. So weit reicht das Erinnerungsvermögen der Deutschen noch.« Gerüchte hätten sich dagegen zur geltenden Währung entwickelt. Jeder kenne ein neues: Separatfrieden mit England, Militärputsch von rechts. Überhaupt das Militär! Die Unzufriedenen hofften, die Offiziere würden es schon machen. Hitler sei überhaupt ahnungslos. Alle Schuld seinen Schergen. Wenn der Führer nur wüsste, was los sei! Der gute Mensch vom Obersalzberg.
Das Abendrot, plötzlich ausgeknipst, lässt ein fahles Rauchgrau zurück und ein wenig Helligkeit hinter dem Horizont. Gleich wird es stockfinster sein. Wegen der Verdunkelungsvorschrift ist die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet. Bernstorff klemmt sich den Stock unter die Achsel und zieht eine Taschenlampe hervor.
»Geben Sie acht, nicht dass einer denkt, sie seien bewaffnet«, warnt Uexküll.
»Die Pistole habe ich in der anderen Tasche. Ich möchte mir in diesem Staat nicht noch ein Bein brechen, wenn schon der Hals in ständiger Gefahr ist.«
Der Taschenlampenstrahl zittert ihren Füßen voraus.
»Jedenfalls werden Devisen für Martha Liebermanns Flucht unerlässlich sein«, nimmt Uexküll den Faden wieder auf. »Alles, was sich in ihrer Wohnung befindet, ist längst registriert und kann nicht zu Geld gemacht werden.«
»Wir müssen jede Verbindung nutzen, vor allem Bürgen in der Schweiz oder Schweden finden. Und wie ist das nun mit der Kunstsammlung in der Schweiz?« fragt Bernstorff.
So viel er wisse, meint Uexküll, habe das Dr. Walter Feilchenfeldt organisiert. Er sei einer der Geschäftsführer der Galerie Cassirer gewesen, über die in erster Linie die Bilder Liebermanns verkauft worden seien. Seine Geschäftspartnerin Grethe Ring sei eine Nichte Martha Liebermanns. »Formidable Frau! Sie erinnern sich an den Fall Wacker, die Van-Gogh-Ausstellung 1928?! Angeblich alles Bilder aus russischem Privatbesitz und alle falsch. Es gab Expertisen von de la Faille und Meier-Graefe.« Aber Feilchenfeldt und Ring hätten sich nicht täuschen lassen. Vor allem Rings Auftreten vor Gericht sei ganz große Bühne gewesen. »33 mussten Ring und Feilchenfeldt liquidieren, jedenfalls sahen sie keine andere Möglichkeit, um einer Arisierung zuvorzukommen.«
»Und Ihre Verbindungen nach Schweden, Uex?«
»Max Liebermann war mit Anders Zorn, dem schwedischen Maler, befreundet. Seine Witwe lebt in Mittelschweden in Mora und kümmert sich um den Nachlass. Der müsste man schreiben und sie auf Martha Liebermanns Schicksal aufmerksam machen.«
Bernstorff hebt die Taschenlampe und strahlt das Standbild Otto des Faulen an. Der letzte Wittelsbacher auf preußischem Thron steht mit schlaff eingeknickter Hüfte, seine Mundwinkel hängen missmutig herab. »Otto der Faule ist mir immer der Liebste gewesen«, sagt Bernstorff, »weil Mensch. Die anderen sind doch alle nur Stein gewordene Ansprüche an ein Preußentum, das mir angesichts der heutigen Lage allerdings als kultiviert erscheint. Der Nationalsozialismus ist dagegen der Triumph des mittelmäßigen Mannes. Die Gefahr ist, dass er jede Form von Qualität hasst und alles auf sein hoffnungsloses Maß reduzieren möchte. – Und übrigens«, fährt er nach einer kurzen Pause fort, »ich liebe ihre Frau wirklich.«
Uex lächelt: »Ich weiß. Alle lieben meine Frau.«
Martha hat ihren Daumen als Lesezeichen zwischen die Seiten ihres Buches geklemmt und mit einem Seufzer innegehalten. Es ist ein Wunder, dass sie mit dieser Brille, die ein Optiker lange vor dem Krieg angefertigt hat, überhaupt noch etwas erkennen kann. Sie blinzelt in die Sonne, die tief stehend über den First des Nachbarhauses scheint. Heute ist es schwer, eine neue Brille zu bekommen. Alles ist heute schwer zu bekommen, nicht nur für Juden, aber für die besonders.
Das Reichswirtschaftsministerium bestimmt, dass Juden keine Kleiderkarten und keine Bezugsscheine für Textilien, Schuhe und Sohlenmaterial erhalten. Ihre Versorgung soll ausschließlich durch die Reichsvereinigung garantiert werden.
An manchen Tagen und wenn das Licht nicht gut ist, bemerkt sie nach einer Weile, dass sie nur noch aufs Papier starrt und aus den schwarzen Strichen, Bögen, Häkchen und Kreisen Sätze entziffert, die sie mehr träumt, als sie wirklich zu lesen. Es ist, als sei sie in ihre Kindheit zurückgekehrt, als sie voller Stolz aus den wenigen ihr bekannten Buchstaben Worte und Sätze erfand, die zu den Bildern auf den gegenüberliegenden Seiten passten. Ihr Vergnügen ist unverändert geblieben, die Seiten umzuwenden, das Papier zwischen den Fingerspitzen auf und ab gleiten zu lassen, Dünndruckpapier etwa, das beim Wenden flattert und ein wisperndes Geräusch erzeugt, während das dickere Bütten pelzig und steif sich sträubt und nur zu einem stumpfen Fauchen fähig ist.
Die Nachwelt werde sie dereinst für eine reizlose und hinfällige Person halten, hat Martha manchmal scherzhaft geklagt, weil Max sie auf seinen Bildern meist ruhend und lesen darstellte. Lesend hat sie versucht, das Leben zu begreifen, ohne die Abenteuer der Realität zu vermissen, bequem im Sessel, auf der Chaiselongue, im Liegestuhl oder auf einer Gartenbank sitzend, den Gedanken anderer folgend, wie durch ein Labyrinth mit exotischen und unbekannten Pflanzen, wilden Tieren und Abenteuern, die zu bestehen in ihrem Anspruch nicht geringer gewesen sind als das wahre Leben. Auch in der Graf-Spee-Straße haben sich ihre Gewohnheiten nicht verändert. Ihr Lesesessel hat hier seinen Platz im Türmchen gefunden, das, aus der Front des Hauses leicht vorspringend, die nördliche Ecke des Bauwerks markiert.
Im Herbst nach Max Tod ist sie in die Graf-Spee-Straße 23, Hochparterre, gezogen, eine großbürgerliche Flucht von vielen Zimmern mit allem Komfort. Es gab eine zentrale Gasheizung, einen Gaskühlschrank und einen Gasherd, natürlich Telefonanschluss. Heute wärmt die Gasheizung kaum noch. Der Hauswart hat Öfen aufgestellt. Und der Kühlschrank hat nichts mehr zu kühlen, auf dem Herd kochen Kartoffeln und Rüben. Von den Hausangestellten sind nur noch Marie Hagen und Alwine Walter übrig geblieben. Die anderen haben sich weniger aus Überzeugung, denn aus Furcht verabschiedet.
Aber am Anfang unterschied sich ihr Leben in der Graf-Spee-Straße noch wenig vom bisher gelebten. Besucher kamen, eine Ausstellung im Jüdischen Museum wurde anlässlich des ersten Todestags von Max zusammengestellt. Sie war ein großer Erfolg. 6.000 Liebermann-Freunde fanden sich ein, unter ihnen auch die treue Käthe Kollwitz. So hatte Martha sich das Witwendasein vorgestellt. Ausstellungen eröffnen, das eine oder andere verkaufen, das eine oder andere verleihen, Ruhm erhalten, mehren, es hätte ihre große Zeit werden sollen, Witwenherrschaft.
Martha setzt die Lesebrille ab. Draußen knattert ein dreirädriger Tempowagen vorbei, beladen mit Baumaterial für die japanische Botschaft am oberen Ende der Straße, die noch immer nicht ganz fertiggestellt ist. Schippen und Spitzhacken klappern auf der Pritsche.
Читать дальше