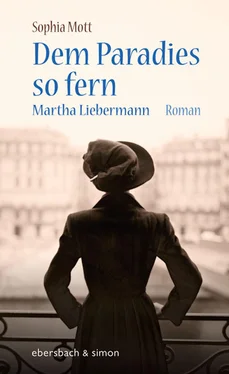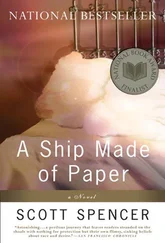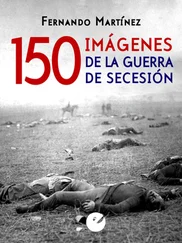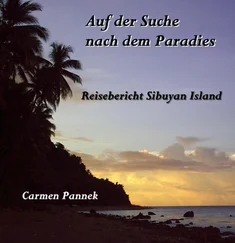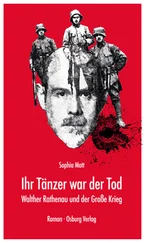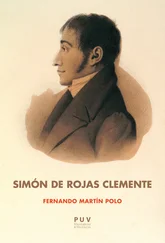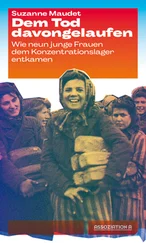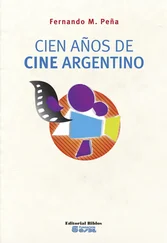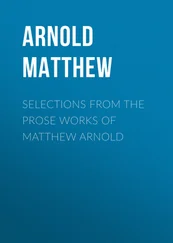Hanna Solf findet, man erkenne Spitzelfahrzeuge und Spitzel doch auf den ersten Blick, vor ihrer Haustür stünden sie auch immer.
»Man muss leider jedem misstrauen«, meint Gräfin Maltzan, »weil die deutsche Neigung zur Unterordnung alle menschlichen Regungen negiert«. Dann lacht sie bitter. »Ich habe solche Vorsicht aus eigener Erfahrung erlernen müssen.« Mit einem kräftigen Schnauben stößt sie den Rauch ihrer Zigarette aus. »In einer kleinen Runde, der ich glaubte, vollkommen vertrauen zu können, habe ich einmal erzählt, wie ich gleich im ersten Kriegsjahr bei der Brief-Zensurstelle zwangsverpflichtet war.« Sie habe da, zuständig für die Buchstaben K–L, auch die Post des Grafen Keyserling kontrollieren müssen. »Wie wir alle wissen, äußert sich der ja gern ohne Rücksicht auf irgendwelche Gefahren abfällig über das Regime. Um ihn zu schützen, ist mir tatsächlich nichts anderes übriggeblieben, als seine Briefe mit auf die Toilette zu nehmen und sie dort aufzuessen. Sie zu zerreißen und sie hinunterzuspülen, habe ich als zu riskant verworfen. Es hätte ja wieder etwas nach oben kommen können. Man stelle sich vor: Eine beinharte Nazianhängerin nach mir auf der Toilette oder eine von diesen furchtsamen Denunziantinnen, die glauben, die Nazis blickten wie Götter allwissend aus der Toilettenschüssel und nähmen sie hops, wenn sie es nicht anzeigte.« Die Gräfin drückt ihre Zigarette im Ascher aus und dreht sie so lange mit dem Daumen platt, bis der Rest zu einem flachen, bräunlichen Knopf reduziert ist. Erst dann lässt sie seufzend die Pointe folgen: »Schließlich habe ich Keyserling angerufen und ihn gebeten, wenigstens kein Büttenpapier mehr zu verwenden, weil das so schwer zu schlucken sei.« Sie wartet, bis die Lacher verklungen sind. »Bald nachdem ich diese Anekdote erzählt hatte, bin ich verhaftet und stundenlang verhört worden.«
So könne es einem ergehen, wenn man nicht auf eine gute Pointe verzichten wolle, seufzt Graf Bernstorff.
Die Gräfin erwidert, manches sei nur in Form einer guten Pointe noch zu ertragen.
Maria von Maltzan hat so gar nichts Damenhaftes an sich, findet Uexküll. Sie ist dicklich, nicht besonders hübsch, hat den rauen Charme eines Berliner Bierkutschers, ist dabei hochintelligent und ziemlich dominant. Nach einer gescheiterten Ehe studiert sie jetzt Tiermedizin. Die Gräfin kann sehr unterhaltsam von Tierseuchen, Sektionen und den Zuständen in Schlachthäusern erzählen. Gelegentlich versorgt sie die Mitglieder der Teegesellschaft mit Fleisch, das sonst in der ganzen Stadt nicht mehr zu haben ist. Nur wer ihre haarsträubenden Geschichten erträgt, isst es mit Vergnügen.
Ob Uexküll schon gehört habe, dass heute eine erste Umsiedlung von Juden in den Osten stattgefunden habe, fragt Bernstorff.
Natürlich hat Uexküll davon gehört. »Es sind Bekannte von mir unter den Evakuierten gewesen.«
»Von der Levetzowstraße in Moabit, wo sich das Sammellager in der Synagoge befindet, mussten die Menschen laufen bis nach Halensee und dann über die Ringbahnbrücke.« Dort hat Bernstorff den Zug selbst gesehen. »Ein Gewährsmann hat mich verständigt, dass es zum Bahnhof Grunewald geht. Aber schon in Halensee waren viele am Ende ihrer Kräfte. Die Leute hatten ja auch Gepäck dabei. Es ist wie ein Gefangenentransport gewesen. Wenn jemand ausruhen wollte, sich auf seinen Koffer setzte, kam sofort ein Polizist und hat ihn weitergetrieben. Es müssen an die 1000 Leute gewesen sein.«
Graf Bernstorff ist sichtlich mitgenommen. Seine Hand mit der Zigarette zwischen den Fingern zittert stark. Glut fällt auf seine Hose. Er bemerkt es nicht. Uexküll möchte ihn aufmerksam machen, aber er ist zu müde. Er sieht zu, wie der kleine, brennende Fetzen noch einmal kurz aufleuchtet, dann in den Stoff sinkt und plötzlich verschwindet, als würde er immer weiter fallen, sich durch die Haut fressen, den Knochen annagen, einen Schwelbrand entzünden und Bernstorff schließlich von innen zu Asche verwandeln, bis er sich vor seinen Augen mit einem Atemhauch plötzlich in staubige Flocken auflöst. Uex schüttelt sich. Die Glut hat nur einen kleinen dunklen Fleck hinterlassen.
Drei Monate ist Bernstorff im Konzentrationslager Dachau inhaftiert gewesen. Er spricht weder über die vermutlichen Gründe noch über das, was er dort erlebt hat. Aber er ist deutlich verändert zurückgekehrt, schmaler geworden, das Gesicht ist grau, voller Flecken und Furchen, als hätte man aus einem prallen Ballon die Luft herausgelassen. Man munkelt, dass seine Schwägerin, die mit Karl Wolff, dem Leiter der Adjutantur des Reichsführers der SS, ein Verhältnis unterhält, seine Verhaftung erwirkt habe. Es ging um eine Erbschaftsangelegenheit. Nach Bernstorffs Freilassung wurde sie tatsächlich zugunsten der Schwägerin geregelt.
Aber natürlich hat Bernstorff der Gestapo auch sonst reichlich Material geliefert. Er macht gerne Witze über die NS-Größen und scheut sich nicht, sie überall und ohne Rücksicht darauf, wer ihm zuhört, zu erzählen. Zehn Jahre ist er an der Botschaft in London tätig gewesen, bis die Nazis ihn 33 rausgeschmissen haben. Das Reden ist seine diplomatische Berufskrankheit. Damit gräbt er sich gerade sein eigenes Grab.
»Ich habe Dr. Lilienthal unter den zu Evakuierenden gesehen. Er ging Hand in Hand mit seiner Frau. Als er mich am Straßenrand entdeckte, ließ er ihre Hand los und zog den Hut, als würden wir uns Unter den Linden beim Sonntagsspaziergang begegnen.«
Auch Gräfin Maltzan weiß zu berichten, dass Bekannte sorgfältig die sogenannten Listen ausgefüllt hätten, die man vor der Deportation zugestellt bekomme und in denen das gesamte persönliche Eigentum dokumentiert werden müsse. »Und dann sind sie am nächsten Morgen ganz brav in die Levetzowstraße gegangen. Viele glauben immer noch, dass sie Gehorsam und Gesetzestreue vor Schlimmerem bewahrt.« Eine Vorstellung, die der Gräfin vollkommen fremd ist.
Frau von Thadden sieht das anders. »Es ist das Letzte, was sie haben, sie sind ihrer deutschen Seele treu.«
»Die wird auf diese Weise auch bald perdu sein«, braust die Gräfin auf.
Elisabeth von Thadden stammt aus einem pommerschen Adelsgeschlecht, ist Anfang 50, ein ältliches Fräulein, Lehrerin, Mitglied der bekennenden Kirche und zu jeglichem Opfer bereit, wie Jesus in Gethsemane am Vorabend der Kreuzigung, während Gräfin Maltzan sich im Ernstfall mit einer Browning, die sie in der Tasche trägt, verteidigen würde bis zur letzten Kugel.
»Frau Liebermann«, sagt Hanna Solf, »wir müssen uns um Frau Professor Liebermann kümmern!«
Bis jetzt habe sich die 84-jährige Witwe des Malers Max Liebermann beharrlich geweigert, Deutschland zu verlassen. Nun müsse sie angesichts der neuesten Entwicklung unbedingt noch einmal gedrängt werden, ihre Entscheidung zu revidieren. »Ich glaube, sie ist sich noch immer nicht bewusst, dass es hier nicht nur um Besitz, Geld oder die Bilder ihres Mannes geht, sondern vielleicht um ihr Leben.« Die alte Dame würde keinesfalls so einen Transport in irgendein Lager im Osten, das Leben unter primitiven Umständen, überstehen. Man müsse sie noch einmal mit allen denkbaren Schrecken konfrontieren, auch wenn das hart sei.
Bernstorff berichtet, dass Kurt Riezler, Martha Liebermanns Schwiegersohn, Kontakt zu ihm hielte und ihn immer wieder darum bäte, der Schwiegermutter gut zuzureden. Es sei in New York, wo Riezlers jetzt lebten, doch für alles gesorgt, ein Affidavit für die Einreise zu besorgen jederzeit möglich.
Sie müsse nur erst hier herauskommen, sagt Uexküll. Das sei wohl das größere Problem.
»Dafür ist es zu spät«, konstatiert Gräfin Maltzan gewohnt direkt. Vielleicht sei es besser, Frau Liebermann zu verstecken.
Diese Idee löst bei den anderen Kopfschütteln aus.
Das sei mit solch einer alten Frau nicht mehr zu machen, man könne sie nicht bei Gefahr im Verzug in einen Schrank stecken, vollkommen undenkbar.
Читать дальше