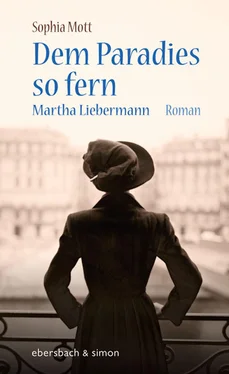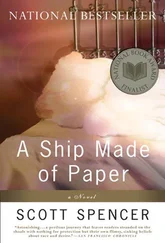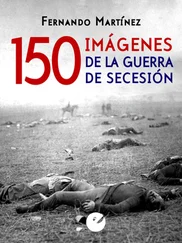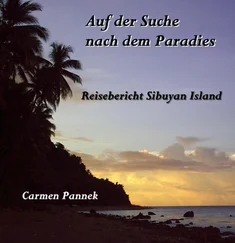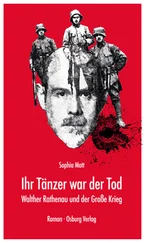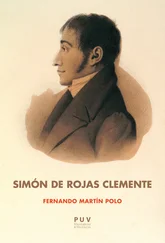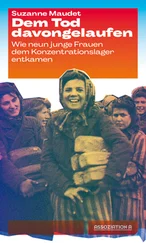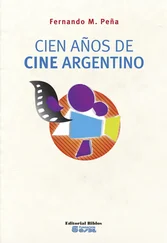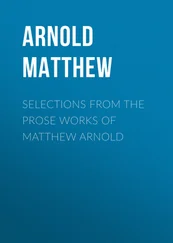Martha und ihre Geschwister wurden sich selbst überlassen. Die Kinder spielten auf den Nebenwegen, die schnurgerade und unheimlich verschattet durch den lichten Wald führten. Dass man so weit blicken konnte und doch nicht sah, was dort am Ende, wo ein wenig Licht einen winzigen Punkt setzte, war, machte das Geheimnis. Es war eine Mutprobe, hineinzulaufen, so weit, wie man sich traute, dorthin, wo es angeblich wilde Tiere gab, die unversehens aus dem Gebüsch hervorspringen konnten, Wildschweine, Hirsche, Füchse.
»Da dieser Schatten, ist da nicht was? Wer traut sich mit mir zu kommen? Es bewegt sich. Ich habe ein tiefes Brummen gehört.« – Jetzt raschelte es im Gebüsch und alle liefen sie schreiend zurück zur Promenade, nur um bald wieder aufzubrechen zu einer nächsten Expedition.
An den Wegen entlang verliefen schmale, verschlammte Rinnsale. Ihr Gefälle war gering, nie wurden sie ausgegraben und gereinigt, Abwässer vom Schifffahrtskanal wurden hineingedrückt, so fing die Brühe an zu stinken. Im Dämmerlicht der Baumschatten sah man aus den Gräben Faulgase in bunten Blasen aufsteigen, die zerplatzten wie ein kleines Feuerwerk.
»Das sind Elfenrülpser«, sagte Marthas Bruder Benno und schickte gleich selbst einen hinterher. Die Kinder sprangen über die übel riechenden Rinnen, Benno sprang zu kurz, rutschte auf der anderen Seite des Grabens ab und fiel in den Dreck. Er stank so fürchterlich, dass er auf dem hastig angetretenen Heimweg ein paar Schritte hinter ihnen laufen musste. Als sie in die Französische Straße einbogen, hefteten sich ein paar Nachbarskinder an ihre Fersen und schrien: »Kieckt ma da, der dreckije Judenbengel!«
Das Kindermädchen wurde vom »Fräulein« abgelöst. Ihm wurde nicht mehr die ganz unkritische und heiße Liebe zuteil, die noch dem Mädchen gegolten hatte. Fräuleins waren Lehrerinnen, Respektspersonen, man sollte ihnen gehorchen, aber sie waren in der Erwachsenenwelt selbst wenig geachtet. Das Empfinden, das man solch einer Existenz entgegenbrachte, hatte einen Beigeschmack von Herablassung, auch wenn das Fräulein an allen familiären Ereignissen teilnahm, als gehörte es tatsächlich dazu. Erinnerungen an diese Frauen waren ins Anekdotenhafte verzerrt, wie jene an das Fräulein Brasig, ein große, grobknochige Person mit tiefer Stimme und einem dunklen Flaum auf der Oberlippe. Marthas Mutter nannte sie heimlich »Herr Brasig«, und der Vater sagte manchmal scherzhaft, wenn sie vom Essen aufstanden: »Brasig, kommen Sie, lassen Sie uns im Herrenzimmer eine gute Zigarre rauchen.« Die Brasig ließ sich alles mit einem sauren Lächeln gefallen. Einmal sprang sie in die Bresche, als Marthas Schwester Else nicht imstande gewesen war, den Belsazar am Mittagstisch lückenlos und fließend aufzusagen, wie es der Vater gewünscht hatte. Beim Vortrag der Ballade fand die Brasig zu plötzlicher Größe und offenbarte schauspielerisches Talent, welches man ihr nie und nimmer zugetraut hätte, indem sie mit unvergesslicher Geste, einem entschlossenen Schnitt der Handkante unter ihrer blassen, bereits leicht faltigen Kehle, das letzte Verspaar vortrug: »Belsazar ward aber in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht.« Noch Jahre später zitierten die Familienmitglieder unter großem Gelächter jene Worte, begleitet von wildem Augenrollen und der Bewegung der flachen Hand an der Kehle.
Vollkommen überrascht war Martha, dass gerade dieses Fräulein sie eines Tages verließ, um zu heiraten. Sie bekam zum Abschied von Marthas Vater eine Art Aussteuer und eine kleine Mitgift. Dass einer die Brasig liebte, unbegreiflich.
Uexküll und Bernstorff treten hinaus auf die Alsenstraße. In einem Hauseingang gegenüber weicht eine schemenhafte Gestalt zurück. Bernstorff packt Uexküll am Arm. »Uexküll, ich muss mit Ihnen reden. Ich liebe Ihre Frau!«, sagt er sehr laut.
Uexküll weiß nicht recht, was er antworten soll. »Was denken Sie denn, was ich jetzt tun werde«, fragt er schließlich. »Soll ich Sie zum Duell fordern?«
»Wir müssen reden. Gehen wir ein paar Schritte.«
Bernstorff schiebt Uex in Richtung Tiergarten. An der Straßenecke sieht er sich noch einmal um und kichert.
»Sehen Sie, es hat funktioniert. Unser Aufpasser fand den Streit zweier Herren um eine Dame nicht wert, die Verfolgung aufzunehmen.«
Es ist schon beinahe dunkel, als Uexküll und Bernstorff durch die Siegesallee gehen. Am Tag gleißend in weißem Marmor, stehen die Hohenzollern und ihre Vorfahren jetzt finster in ihren Heckennischen. Der Erste in der Reihe preußischer Herrscher, die die Prachtstraße säumen, ist Albrecht der Bär, er streckt ihnen das Kreuz entgegen, seine linke Hand am Schwert, die Augen zusammengekniffen.
Bernstorff hält inne und sagt: »Was meinen Sie, Uex, ist das Kreuz Schuld an der menschlichen Katastrophe? Kriecht aus der alten Feindschaft zwischen denen, die den Messias gemordet haben, und denen, die die Nachfahren seiner Anhänger sind, tatsächlich die neue Schuld?«
Es sei Albrecht dem Bären in diesem besonderen Falle kein Vorwurf zu machen, antwortet Uex trocken. Im Übrigen seien die Kriege Albrechts in erster Linie expansionistisch gewesen und weniger idealistisch. Was die aktuelle Lage betreffe, sehe er wieder einmal nicht den Gegensatz zwischen Christen und Juden, sondern den zwischen den Zeitgenossen mit einem Glauben und denen, die einem Kult anhängen, der kein Gewissen kenne.
Sie nehmen ihren Weg schweigend wieder auf. In den Gebüschen hinter den Denkmälern raschelt es, vielleicht Vögel, die sie aufgeschreckt haben, oder Ratten.
»In der Nacht«, sagt Uexküll, »ist hinter den Altvorderen das ideale Versteck für Strauchdiebe.«
Bernstorff lacht und klopft mit seinem Stock in einem raschen Staccato vor sich auf den Kies.
»Bis jetzt ist Frau Liebermann in ihrer Wohnung wohl ziemlich unbehelligt geblieben?«, fragt er.
»Beinahe ein Wunder«, bestätigt Uexküll. Natürlich habe sie, wie alle wohlhabenden Juden, unglaubliche Sühneleistungen zahlen müssen, Konten seien gesperrt, das Haus in Wannsee schon lange zwangsverkauft worden, aber von tätlichen Angriffen, Anpöbeleien, ebenso wie einem Umzug in eine Judenwohnung sei sie bisher verschont geblieben. Zwei Haushälterinnen kümmerten sich nach wie vor rührend um sie. Sie leide keine Not.
Bernstorff sagt, man müsse Frau Liebermann klarmachen, dass sie, auch wenn sie sich ganz in ihrer Wohnung vergrabe, nicht sicher sei vor den Nachstellungen der Nazis. Schonung sei jetzt nicht mehr opportun. »Sie muss wissen, was ihr droht. Dabei sollten wir nicht übertreiben, aber auch nichts auslassen.«
Er glaube nicht, sagt Uex, dass Frau Liebermann so unwissend sei. »Sie ist eine intelligente Frau, geistig noch vollkommen auf der Höhe, unsentimental und stark.« Wenn sie sich bisher geweigert habe, zu emigrieren, hänge das eher mit ihrem Verständnis von Pflichtgefühl und einer Form von Bescheidenheit zusammen. Um sich selbst habe sie nie große Geschichten gemacht. »Alles drehte sich immer nur um ihren Mann.«
Bestimmt aber, meint Bernstorff, überschätze sie ihre Stärke. Alle überschätzten ihre Stärke. Angesichts der nackten Gewalt werde man klein und jämmerlich. Er drückt die Faust, die er um den Knauf des Spazierstocks geschlossen hat, an die Brust, zieht tief Luft ein und fügt nach ein paar Schritten hinzu: »Jeder wird klein und jämmerlich.«
Sie überqueren die Charlottenburger Chaussee. Die grünen Tarnnetze, die über die Chaussee ebenso wie über die Linden gespannt sind, um den feindlichen Bombern die Orientierung zu erschweren, knattern leise im Abendwind. Durch die Löcher des Netzes blitzt ein letztes magentafarbenes Abendrot.
»Tochter und Enkelin sind der Schlüssel. Wir müssen Frau Liebermann klarmachen, wie sehr beide die Sorge um ihre Mutter und Großmutter belastet, und dass ein Wiedersehen nur durch die Ausreise möglich ist. Hoffnungen auf ein baldiges Kriegsende könnten sie in Versuchung führen, abzuwarten. Doch danach sieht es im Moment nicht aus. Wenn Hitler den Russlandfeldzug gewinnt, ist das Regime auf Jahre, vielleicht Jahrzehnte stabilisiert.«
Читать дальше