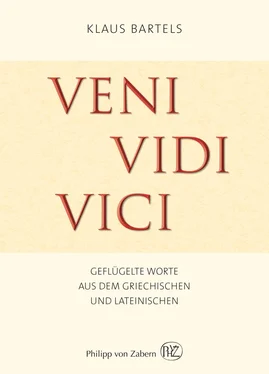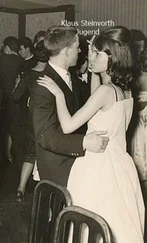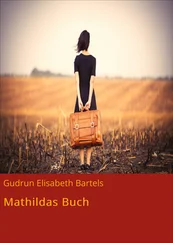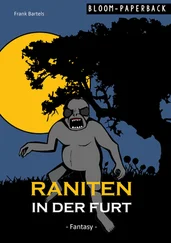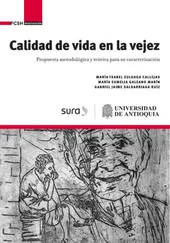Agnosco veteris vestigia flammae.«Ich erkenne die Spuren der alten Flamme.» Vergil, Aeneis 4, 23. Dido, die Königin des neugegründeten Karthago, bekennt gegenüber ihrer Schwester Anna ihre neue Liebe zu dem im Seesturm vor Karthago schiffbrüchig gewordenen Trojaner Aeneas. Die «alte Flamme» hatte ihrem ersten, in ihrer phönizischen Heimat ermordeten Gatten Sychaeus gegolten.
Alea iacta est.«Der Würfel ist geworfen» (ursprünglich in dem Sinne: «Das Wagnis ist eingegangen», nicht: «Die Entscheidung ist gefallen»). Sueton, Caesar 32 (Iacta alea est) . Als Caesar am 10./11. Januar 49 v. Chr. den Grenzfluß Rubico nördlich von Ariminum (heute Rimini), überschritt und damit unwiderruflich den Bürgerkrieg gegen Pompeius eröffnete, rief er, ein verbreitetes griechisches Sprichwort aus Menanders Komödie «Arrhephoros» zitierend, in griechischer Sprache (so bezeugt bei Plutarch, Pompeius 60, 4): Ἀνερρίϕϑω κύβος, «Aufgeworfen sei der Würfel!» (Plutarch, Caesar 32, 8; Pompeius 60, 4). Das Sprichwort bezeichnet den Augenblick des Wagnisses, da der Würfel aus der Hand «aufgeworfen», aber noch nicht zu Boden gefallen ist; die geläufige Übersetzung «Der Würfel ist gefallen» wird weder dem griechischen noch dem lateinischen Wortlaut gerecht. Der Menandervers (bei Athenaios, Deipnosophisten 13, 8. 559 E; Fragment 59, 4 Körte) lautet vollständig: Dedogm°non tÚ prçgmÉ: Δεδογμένον τὸ πρᾶγμ' · ἀνερρίϕϑω κύβος, «Beschlossen ist die Sache; aufgeworfen sei der Würfel!» Caesar erwähnt die Episode in seinem «Bürgerkrieg» nicht. Die dem griechischen Wortlaut nicht vollkommen entsprechende lateinische Fassung Iacta alea est , «… ist geworfen», findet sich zuerst bei Sueton; zur Angleichung der lateinischen Übersetzung an das griechische Original hat Erasmus für die Stelle die Lesung Iacta alea esto , «… sei geworfen», vorgeschlagen. Vgl. die Anspielung bei Petron, Satiricon 122, Vers 174: Iudice Fortuna cadat alea , «Fortuna sei Richterin, wenn der Würfel fällt». Einen anderen Bogen von der Glücksgöttin zum Würfelglück hat Erasmus, Lob der Torheit 61, geschlagen: Amat Fortuna parum cordatos, amat audaciores et quibus illud placet: Πᾶς ἐρρίϕϑω κύβος, «Fortuna liebt die weniger Vernünftigen, liebt die Wagemutigeren und denen dieses Wort gefällt: Jeder Würfel sei geworfen!»
Alter ego.«Ein zweites Ich.» Die Bezeichnung eines Freundes als eines «zweiten Ich» (wie umgekehrt die Bezeichnung des Ich als eines «ersten Freundes») geht auf griechische Gedanken zurück; vgl. zum Beispiel Aristoteles, Nikomachische Ethik 9, 4. 1166 a 31f.: Ἔστι γάρ ὁ ϕίλος ἄλλος αὐτός, «Denn der Freund ist ein zweites Selbst», wiederaufgenommen 9, 9. 1169 b 6f.; auf die Kinder übertragen 8, 14. 1161 b 28f. Cicero, Laelius oder De amicitia 21, 80, hat diese Aristotelische Definition der Freundschaft ins Lateinische übertragen: Verus amicus … est enim is, qui est tamquam alter idem , «Denn ein wahrer Freund … ist der, der gleichsam ein zweites Selbst ist». Das heute eher gebräuchliche Alter ego erscheint zuerst bei Cicero, Briefe an Freunde 7, 5, 1, auf den Adressaten Caesar gemünzt: Vide, quam mihi persuaserim te me esse alterum , «Sieh, wie sehr ich überzeugt bin, daß du mein zweites Ich bist!»
Alterius non sit, qui suus esse potest.«Einem anderen gehöre nicht, wer sich selbst gehören kann.» Aus dem «Äsop» des sogenannten Anonymus Neveleti 21 b, 22, einer im 12. Jahrhundert entstandenen, im Mittelalter weit verbreiteten Fabelsammlung; vgl. Werner, Sprichwörter, A 70. Der Aufruf zur Selbstbestimmung geht zurück auf Cicero, De re publica 3, 25, 37, bei Nonius, De compendiosa doctrina, Seite 109, Zeile 2 Mercier: Est enim genus iniustae servitutis, cum ii sunt alterius, qui sui possunt esse , «Es gibt nämlich eine Art ungerechtfertigter Sklavenschaft, wenn solche Menschen einem anderen gehören, die sich selbst gehören könnten». Im frühen 16. Jahrhundert hat Theophrast von Hohenheim alias Paracelsus die Sentenz zu seinem Wahlspruch erhoben; im frühen 17. Jahrhundert findet sie sich in der Emblemata-Sammlung von Jacob Cats (1627), vgl. HenkelSchöne, Emblemata, Spalte 266f. Vgl. das Horazische Leitwort Nullius addictus iurare in verba magistri , unten S. 89.
Amantes amentes.«Liebende, Rasende.» Titel einer im Jahre 1609 erschienenen, in deutscher Sprache geschriebenen Komödie des lateinisch und deutsch schreibenden Magdeburger Dichters Gabriel Rollenhagen, nach Plautus, Mercator 82: amens amansque , «rasend und liebend», und Terenz, Andria 218, wo die aneinander anklingenden Worte einander entgegengesetzt sind: Nam inceptio est amentium, haud amantium , «Denn ein Beginnen Rasender ist es, nicht Liebender». Weiteres bei Otto, Sprichwörter, Nr. 79.
Amicus certus in re incerta cernitur.«Ein sicherer Freund wird in einer unsicheren Sache erkannt.» Ennius bei Cicero, Laelius oder De amicitia 17, 64 (Fragmente der Scenica 210 Vahlen). Der Vers des Ennius ist vielleicht die lateinische Version von Euripides, Hekabe 1226f.: Ἐν τοῖς κακοῖς γὰρ ἁγαϑοί σαϕέστατοι/ϕίλοι, «Denn im Unglück sind die guten Freunde am deutlichsten zu erkennen». Ähnliche Worte finden sich bei Plautus, Epidicus 113: Is est amicus, qui in re dubia re iuvat, ubi re est opus , «Das ist ein Freund, der in zweifelhafter Lage mit einer Tat beisteht, wo es einer Tat bedarf», bei Publilius Syrus, Sentenzen A 41: Amicum an nomen habeas, aperit calamitas , «Ob du einen Freund oder nur das Wort hast, das offenbart eine Notlage» (in dem Sinne: «… oder nur einen, der so bezeichnet wird …»), und bei Petron, Satiricon 61, 9: In angustiis amici apparent , «In der Bedrängnis zeigen sich die (wahren) Freunde».
Amicus Plato, sed magis amica veritas.«Unser Freund ist Platon, aber mehr noch unser Freund die Wahrheit.» Die lateinische Version eines in der Antike dem Sokrates-«Schüler» Platon zugeschriebenen, in späterer Zeit auf den Platonschüler Aristoteles übertragenen Gedankens, aus einer anonymen spätantiken Aristotelesbiographie, der sogenannten Vita vulgata (in: Ingemar Düring, Aristotle in the ancient biographical tradition, 1957, S. 132), § 9: Φίλος μέν Σωκράτης, ἀλλὰ μᾶλλον ϕιλτάτη ἡ ἀλήϑεια, «Unser Freund ist Sokrates, aber mehr noch (und) unser bester Freund die Wahrheit». Der Aristotelesbiograph rechtfertigt die Aristotelische Kritik an der Platonischen Lehre; er zitiert anschließend noch den sinnverwandten Ausspruch aus Platons «Phaidon», 91 C, wo Sokrates, zu Simmias und Kebes gewendet, sagt: «Nehmt nicht so sehr Rücksicht auf Sokrates, sondern vielmehr auf die Wahrheit.» Entsprechend erklärt Sokrates in Platons «Staat», 10. 595 C, mit Bezug auf die Homerische Dichtung: «Aber höher jedenfalls als die Wahrheit darf ein (noch so nah vertrauter und hoch verehrter) Mensch nicht geschätzt werden.» Aristoteles hat sich auch selbst zu dieser Platonischen Maxime bekannt; vgl. Nikomachische Ethik 1, 4. 1096 a 14ff., wo er die Kritik an den «Freunden, die die Ideen eingeführt haben», folgendermaßen einführt: «Dennoch scheint es vielleicht besser, ja notwendig zu sein, zur Wahrung der Wahrheit auch das nah Vertraute umzustürzen, zumal wir ja Philosophen sind. Beides (gemeint ist: Platons Ideenlehre und die Wahrheit) ist uns lieb; jedoch die Ehrfurcht fordert, der Wahrheit den Vorzug zu geben (ἀμϕοῖν γὰρ ὄντοιν ϕίλοιν ὅσιον προτιμᾶν τὴν ἀλήϑειαν)».
Amor fati.«Liebe zum Schicksal.» Aus Nietzsche, Ecce homo (1908), Warum ich so klug bin, § 10, am Ende des Kapitels: «Meine Formel für die Größe am Menschen ist amor fati; daß man nichts anders haben will, vorwärts nicht, rückwärts nicht, in alle Ewigkeit nicht. Das Notwendige nicht bloß ertragen, noch weniger verhehlen – aller Idealismus ist Verlogenheit vor dem Notwendigen –, sondern es lieben …»
Читать дальше