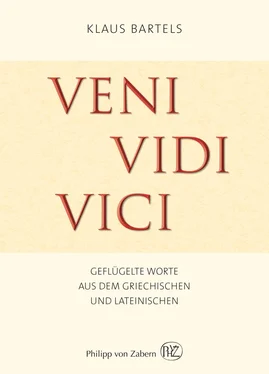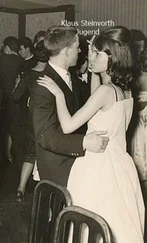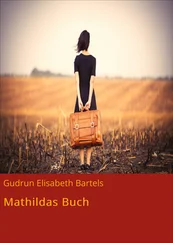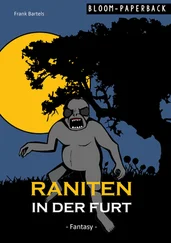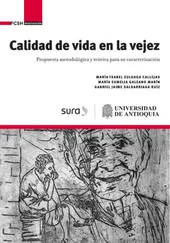Anathema sit!«Verflucht sei er!» Paulus, Brief an die Galater 1, 8f. (anathema sit) und 1. Brief an die Korinther 16, 22 (sit anathema) Vulgata (im griechischen Original: ἀνάϑεμα ἔστω beziehungsweise ἤτω ἀνάϑεμα). Vgl. Paulus, Brief an die Römer 9, 3 und 1. Brief an die Korinther 12, 3. Das Wort anathema bezeichnet eigentlich etwas «Aufgestelltes», in dem einen Sinne etwas dem Gott Geweihtes, ein im heiligen Bezirk «aufgestelltes» Weihgeschenk, in dem anderen Sinne etwas dem Gott Ausgeliefertes. Im Anschluß an die angeführten Stellen ist dieses Paulinische Anathema sit! zur festen Formel für die Exkommunikation aus der katholischen Kirche geworden.
Ancilla theologiae:siehe Philosophia ancilla theologiae , unten S. 127.
Anima naturaliter christiana.«Die natürlicherweise christliche Seele (des Menschen).» Nach Tertullian, Apologeticum 17, 6: O testimonium animae naturaliter christianae! «O welches Zeugnis für die natürlicherweise christliche Seele!» Als solche Zeugnisse für die christliche Natur der menschlichen Seele zitiert Tertullian alltägliche, geläufige Worte wie «der gute und große Gott», «was Gott geben möge», «Gott sieht es», die in aller Menschen Munde seien, und fügt hinzu, bei diesen Worten blicke der Mensch nicht zum Kapitol, sondern zum Himmel empor. Tertullians Schrift «De testimonio animae» führt den Gedanken weiter aus.
Animula vagula blandula …«Seelchen, du schweifendes, schmeichelndes …» Historia Augusta, Hadrian 25, 9; der Anfangsvers eines durch seine unübersetzbaren Verkleinerungsformen (vgl. Vers 3f.: in loca/pallidula rigida nudula) reizvollen Hadrianischen Gedichts, das der Kaiser in Erwartung seines Todes an seine scheidende Seele gerichtet hat (in: Morel, Fragmenta Poetarum Latinorum, Hadrian, Fragment 3).
Annuit coeptis:siehe E pluribus unum , unten S. 63.
Ante portas:siehe Hannibal ante portas , unten S. 80.
Aquila non captat muscas.«Ein Adler fängt keine Fliegen» (in dem Sinne der Rechtsregel Minima non curat praetor , «Um Kleinigkeiten kümmert sich der Prätor nicht», unten S. 97). Die Quelle der Sentenz, die den Adler als den König der Vögel anspricht, ist nicht nachgewiesen.
Arma virumque cano, (Troiae qui primus ab oris …)«Die Waffen und den Mann besinge ich, (der als erster von den Küsten Trojas …)» Vergil, Aeneis 1, 1. Zitate der Anfangsworte der «Aeneis» arma virum(que) finden sich bei Ovid, Tristien 2, 534; Persius, Satiren 1, 96; Martial, Epigramme 8, 55, 19; 14, 185, 2. In der «Aeneis» selbst, 1, 119 und 9, 777, klingt der Eingangsvers in der anderen Verknüpfung arma virum , «Waffen der Männer», unüberhörbar an. Mehrfach erscheint der erste Vers der «Aeneis» auf den Wänden von Pompeji (in: Corpus Inscriptionum Latinarum, Band IV, Nr. 4832 und 8831), einmal auch frech parodiert: Fullones ululamque cano, non arma virumque , «Die Walker und ihr Käuzchen besinge ich, nicht die Waffen und den Mann» (Nr. 9131); in der Eule, dem Wappentier der Athene alias Minerva, verehrten die Walker ihre Schutzgöttin Minerva. Vgl. die Anfangsworte der Homerischen Odyssee Ἄνδρα μοι ἔννεπε …, «Den Mann nenne mir …», oben S. 11.
Ars longa:siehe Vita brevis, ars longa , unten S. 179.
Audacter calumniare, semper aliquid haeret.«Nur drauflos verleumden; etwas bleibt immer hängen.» Die Quelle des Wortes ist nicht nachgewiesen. Francis Bacon, De dignitate et augmentis scientiarum (1605/1623), 8, 2, 34, zitiert es als sprichwörtlich geläufig. Zum Gedanken vgl. Hesiod, Werke und Tage 763f.: «Ein Gerede vergeht niemals gänzlich, das einmal viele Leute geredet haben», und Plutarch, Quomodo adulator ab amico internoscatur 24. 65 D, wo die Verleumdung mit einem Biß verglichen wird: Selbst wenn die Wunde verheile, werde die Narbe doch bleiben.
Audax omnia perpeti/gens humana ruit per vetitum nefas.«Tollkühn, alles (alle noch so schweren Strafen) zu durchleiden, stürzt das Menschengeschlecht dahin durch den verbotenen Frevel.» Horaz, Oden 1, 3, 25f. In einer schaudernden Vergegenwärtigung hybrider Grenzüberschreitungen gegenüber der göttlichen Weltordnung führt Horaz vier mythische Exempel an, die den vier Elementen Wasser, Feuer, Luft und Erde entsprechen: die erste Schiffahrt der Argonauten, den Feuerdiebstahl des Prometheus, den Vogelflug des Dädalus und seines Sohnes Ikarus und den Abstieg des Hercules in die Unterwelt. In der Schlußstrophe gipfelt die Ode in dem gleichfalls «geflügelten» Nil mortalibus ardui est , «Nichts ist den Sterblichen unersteiglich» (unten S. 105), und in der Vision eines himmelstürmerischen Frevels: Caelum ipsum petimus stultitia … , «Den Himmel selbst erstürmen wir in unserer Torheit …»
Audiatur et altera pars.«Auch die andere Partei soll gehört werden.» Die geläufige Fassung der vielzitierten Regel scheint nicht auf die Antike zurückzugehen. Am nächsten kommen ihr in der römischen Literatur Seneca, Medea 199f.: Qui statuit aliquid parte inaudita altera,/aequum licet statuerit, haud aequus fuit , «Wer einen Entscheid gefällt hat, ohne die andere Partei zu hören, mag er auch einen gerechten Entscheid gefällt haben, ist nicht gerecht gewesen», und Augustin, De duabus animabus 14, 22: Audi partem alteram! , «Höre (auch) die andere Partei!» Vgl. auch Corpus iuris civilis, Digesten 48, 17, 1: … neque enim inaudita causa quemquam damnari aequitatis ratio patitur , «… denn daß irgend jemand, ohne daß sein Rechtsgrund gehört worden wäre, verurteilt wird, läßt das Prinzip von Recht und Billigkeit nicht zu». Die Regel ist auch für das griechische Recht bezeugt; in dem bei Demosthenes, Kranzrede (18) 2 und 6, und Isokrates, Antidosisrede (15) 21, zitierten attischen Richtereid heißt es: Ἀκροάσομαι τοῦ τε κατηγόρου καὶ τοῦ ὀπολογουμένου ὁμοίως ἀμϕοῖν, «Ich will den Kläger und den Beklagten beide in gleicher Weise anhören». Vgl. auch das griechische Sprichwort Μηδέ δίκην δικάσῃς, πρὶν ἀμϕοῖν μῦϑον ἀκούσῃς, «Urteile nicht, ehe du beide Seiten gehört hast!» (in: Leutsch-Schneidewin, Paroemiographi Graeci, Band II, S. 759).
Aura popularis.Die «Volksgunst» (eigentlich: der «Volkswind», der – unbeständige – Rückenwind, mit dem das Volk seine Günstlinge in den sicheren Hafen eines Staatsamtes befördert). Zuerst bei Cicero, Rede über das Gutachten der Opferschauer 20, 43 (Sulpicium … longius quam voluit popularis aura provexit); dann bei Horaz, Oden 3, 2, 20 (arbitrio popularis aurae); bei Vergil, Aeneis 6, 816 (nimium gaudens popularibus auris); bei Livius, Ab urbe condita 3, 33, 7 (omnis aurae popularis captator) und öfter.
Aurea mediocritas.«Goldenes Mittelmaß.» Nach Horaz, Oden 2, 10, 5f.: Auream quisquis mediocritatem/diligit … , «Wer das goldene Mittelmaß wertschätzt», ist gleicherweise sicher auf der einen Seite vor erniedrigender Armut, auf der anderen vor neiderregendem Reichtum. Vgl. das Ovidische Medio tutissimus ibis , unten S. 94. Ein Zitat der paradoxen Horazischen Wortverbindung bei Ausonius, Gratiarum actio ad Gratianum imperatorem pro consulatu 6, 28: … temperata et, quae vocatur, aurea … mediocritas , «… ein maßvolles und, wie es genannt wird, goldenes Mittelmaß». Die hohe Wertung des «Mittleren» (μέσον, μεσότης) als des «Angemessenen» (μέτριον) zwischen einem darüber hinausschießenden Zuviel und einem dahinter zurückbleibenden Zuwenig geht zurück auf Aristoteles, besonders Nikomachische Ethik 2, 5. 1106 a 14ff. und Politik 4, 11. 1295 a 35ff. Vgl. den knappen, dem Kleobulos von Lindos zugeschriebenen Spruch Μέτρον ἄριστον, oben S. 21.
Читать дальше