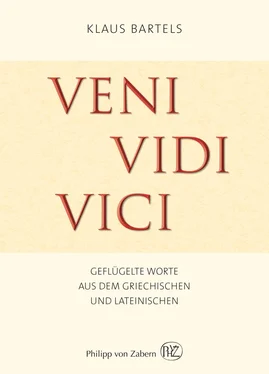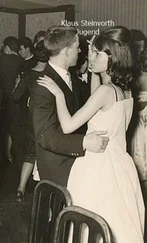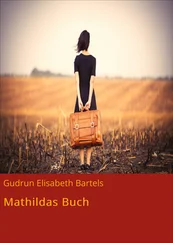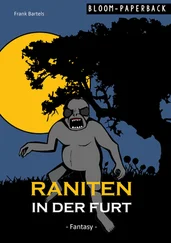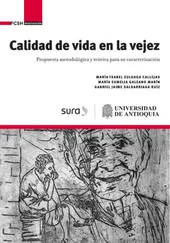Οὐκ ἀγαϑὸν πολυκοιρνίαη · εἷς κοίρανος, ἔστω,/εἷς βασιλεύς (Uk agathon polykoiranie; heis koiranos esto,/heis basileus) . «Nichts Gutes ist Vielherrscherei; einer sei Herrscher, einer König.» Homer, Ilias 2, 204f.; Odysseus zu den Männern aus dem Volk, die, in der Heeresversammlung von König Agamemnon auf die Probe gestellt, «mit wirrem Geschrei» zu den Schiffen davonstürzen. Aristoteles zitiert den Vers zweimal: in der «Politik», 4, 4. 1292 a 13ff., mit der Bemerkung, es sei unklar, welche «Vielherrscherei» Homer hier tadle: eine von Demagogen gelenkte «despotische» Herrschaft der Masse oder eine von gewählten Archonten geführte «demokratische» Herrschaft der Bürger; in der «Metaphysik», 11, 10. 1076 a 3f., zum Abschluß der Abhandlung über den ersten und höchsten Ursprung der Bewegung, den «unbewegten Beweger»: Τὰ δὲ ὄντα οὐ βούλεται πολιτεύεσϑαι κακῶς. Οὐκ ἀγαϑὸν πολυκοιρανίη · εἷς κοίρανος ἔστω, «Das Seiende will keiner schlechten Verfassung gehorchen: Nichts Gutes ist Vielherrscherei; einer sei Herrscher». Plutarch, Antonius 81, 5, überliefert eine Parodie des Verses: Nach der Einnahme von Alexandria im Jahre 30 v. Chr. habe Areios Didymos dem Sieger, dem späteren Kaiser Augustus, mit dem Wortspiel: Οὐκ ἀγαϑὸν πολυκαισαρίη, «Nichts Gutes ist Vielcaesarei», die Beseitigung des jungen Kaisarion, eines Sohnes Gaius Julius Caesars und der Kleopatra, nahegelegt. Wie Sueton, Domitian 12, 3, berichtet, zitierte Kaiser Domitian den Homervers im griechischen Original, um damit seinen Unmut über herrscherliche Allüren eines Verwandten auszudrücken.
Οὔτοι σμνέχϑειν, ἀλλὰ συμϕιλεῖν ἔϕυν (Utoi synechthein, alla symphilein ephyn) . «Nicht doch mitzuhassen, sondern mitzulieben bin ich geboren.» Sophokles, Antigone 523; die als Gefangene vorgeführte Antigone zu Kreon. Antigone rechtfertigt die kultische Bestattung ihres Bruders Polyneikes, den Kreon als Landesfeind geächtet hat; auf dem Höhepunkt des zugespitzten Wortstreits erwidert sie auf Kreons Wort, daß der Feind niemals, auch wenn er gefallen sei, zu einem Freunde werde.
Παϑήματα μαϑήματα (Pathemata mathemata) . «Leiden sind Lehren.» Nach Herodot, Geschichte 1, 207, 1, wo der anfangs sprichwörtlich glückliche, schließlich ins Unglück gestürzte Lyderkönig Kroisos zu dem jungen Perserkönig Kyros spricht: Τὰ δέ μοι παϑήματα ἐόντα ἀχάριτα υαϑήματα γέγονε, «Meine Leiden, so unerfreulich sie waren, sind mir zu Lehren geworden». Kyros hat den alten Lyderkönig vor seinem Feldzug gegen die Massageten, in dem er den Tod finden wird, zu Rate gezogen; Kroisos erinnert, ehe er auf die strategische Frage zu sprechen kommt, an die «Lehren» seiner «Leiden» und illustriert sie mit dem einprägsamen Bild vom «Kreislauf der Menschendinge» (vgl. Κύκλος τῶν ἀνϑρωπηίων πρηγ μάτων, oben S. 19). Das Herodoteische Wortspiel zitiert ein entsprechendes Wortspiel bei Aischylos, Agamemnon 177, wo der tragi sche Chor die beiden Worte πάϑει μάϑος, «durch Leid Lehre», als das tragische Gesetz anführt, unter dem Zeus «die Sterblichen auf den Weg der Einsicht gebracht» habe. Offensichtlich im Anschluß an das Kroisoswort bei Herodot stellt die «Moral» der Äsopischen Fabel vom Hund und dem Koch (Nr. 254 Perry) fest, … ὅτι πολάκις τὰ παϑήματα τοῖς ἀνϑρώποις μαϑήματα γίνονται, «… daß vielfach die Leiden für die Menschen zu Lehren werden». Eine Anspielung auf das Wortspiel findet sich bei Dionysios von Halikarnass, Antiquitates Romanae 8, 33, 3, in einer Rede des Gnaeus Marcius Coriolanus: … καὶ τἀμὰ παϑήματα παιδεύματα γενήσεται τοῖς ἃλλοις;, «… und werden meine Leiden zu Lehren werden für die anderen?» Ein entsprechendes Wortspiel findet sich in dem neutestamentlichen Brief eines namenlosen Autors an die Hebräer 5, 8.
Πάντα ῥεῖ (Panta rhei) . «Alles fließt» (in dem Sinne: «Alles ist im Fluß»). Nach verschiedenen Bezeugungen der Heraklitischen Lehre, so bei Aristoteles, De caelo 3, 1. 298 b 29f.: … τὰ μὲν ἄλλα πάντα πάντα γίνεσϑαί ϕασι καὶ ῥεῖν, «… die anderen Dinge alle seien beständig im Werden, sagen sie, und im Fließen», und Metaphysik 1, 6. 987 a 33f.: … ὡς ἁπάντων τῶν αἰϑητσῶν ἀεὶ ῥεόντων, «… da ja alle wahrnehmbaren Dinge beständig im Fließen seien», und bei Simplicius, Kommentar zu Aristoteles, Physik, in: Commentaria in Aristotelem Graeca, Band 10, S. 1313, Zeile 11: … ὅτι ἀεὶ πάντα ῥεῖ, «… daß beständig alles im Fließen sei». Die prägnante knappe Formel Πάντα ῥεῖ für die Vorstellung eines solchen beständigen Wandels und «Fließens» ist für Heraklit selbst nicht bezeugt; sie ist wohl erst in der Neuzeit aufgekommen. Platon, Kratylos 402 A, zitiert He raklit mit dem schlichten Wort Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει, «Alles weicht, und nichts bleibt», und mit dem einprägsamen Bild «Zweimal kannst du wohl nicht in denselben Fluß steigen» (vgl. Diels-Kranz, Fragmente der Vorsokratiker, Fragment B 12, B 49 a und B 91). Lateinische Versionen finden sich bei Ovid, Metamorphosen 15, 177f.: Nihil est toto, quod perstet, in orbe;/cuncta fluunt … , «Nichts ist auf der ganzen Welt, das Bestand hat; alles ist im Fluß …», und vorher, Vers 165: Omnia mutantur, nihil interit , «Alles verwandelt sich, nichts geht zugrunde» (vgl. Tempora mutantur, et nos mutamur in illis , unten S. 163).
(Νήπιοι, οὐδὲ ἴσασιν ὅσῳ) πλέον ἥμισυ παντος (Nepioi, ude isasin, hoso pleon hemisy pantos) . «(Die Toren! Und sie wissen nicht, um wieviel) die Hälfte mehr ist als das Ganze …» (in dem Sinne: «Weniger wäre mehr»). Hesiod, Werke und Tage 40. Hesiod richtet das Wort an seinen Bruder Perses, mit dem er in einem Rechtsstreit um das Erbe liegt; der Vorwurf der «Torheit» gilt den von Perses bestochenen willfährigen Richtern. Zitate des Wortes finden sich bei Platon, Staat 5. 466 C und Gesetze 3. 690 E.
Ποῖόν σε ἔπος ϕύγεν ἕρκος ὀδόντων (Poion se epos phygen herkos odonton?) «Was für ein Wort entfloh dem Gehege deiner Zähne?» Ein mehrfach wiederholter Homerischer Formelvers; Ilias 4, 350 und öfter.
Πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι, πάντων δὲ βασιλεύς (Polemos panton men pater esti, panton de basileus) . «Krieg ist Vater von allem, König über alles, (und die einen hat er zu Göttern bestimmt, die anderen zu Menschen; die einen hat er zu Sklaven gemacht, die anderen zu Freien).» Heraklit bei Hippolytos, Refutatio omnium haeresium 9, 9 (in: Diels-Kranz, Fragmente der Vorsokratiker, Fragment B 53). Der «Krieg» und die Gegenüberstellung der Götter und der Menschen, der Freigeborenen und der Sklaven stehen hier bildhaft für die spannungsvolle «widersprüchliche Harmonie» (Fragment B 51), in der Heraklit das paradoxe, so offenbare wie verborgene Wesen der Welt gesehen hat. Vgl. Πάντα ῥεῖ, «Alles fließt», oben S. 25.
Πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀνϑρώπου δεινότερον πέλει (Polla ta deina k’ uden anthropu deinoteron pelei) . «Viel Ungeheures ist, doch nichts so Ungeheures wie der Mensch». Sophokles, Antigone 332f., am Anfang eines Chorliedes, das die «ungeheuren» Kulturleistungen des Menschen von der Schifffahrt bis zur Heilkunst staunend aufführt, um schließlich vor «Ungeheuerlichkeit» dieses nicht nur zu vielem, sondern auch, wie man sagt, zu allem fähigen Menschen zu schaudern: «In dem Erfinderischen der Kunst eine nie erhoffte Gewalt besitzend, schreitet er bald zum Bösen, bald zum Guten …» (Übersetzung: Wolfgang Schadewaldt.) Das hier mit «ungeheuer» wiedergegebene Adjektiv δεινός (deinos) deutet mit seiner Doppelbedeutung «äußerst befähigt» und «äußerst gefährlich» auf die tragische Verblendung, die den Menschen immer wieder seine Grenzen überschreiten und in dieser Grenzüberschreitung scheitern läßt.
Читать дальше