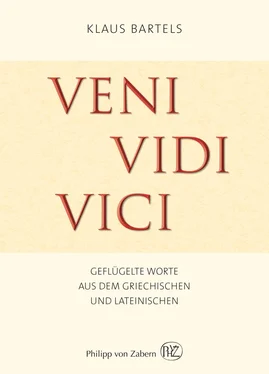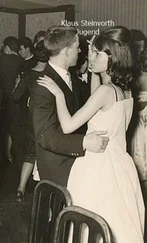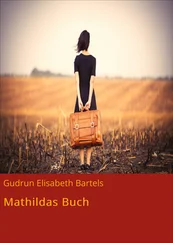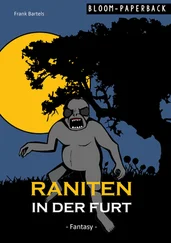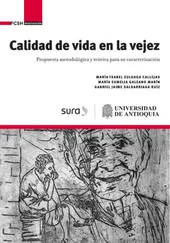Πολλὰ ψεύδονται ἀοιδοί (Polla pseudontai aoidoi) . «Vieles lügen die Dichter.» Der zumal gegen die Homerische Epik und die klassische Tragödie gerichtete Satz ist in dem unter Platons Namen überlieferten Dialog «De iusto», 374 A, und bei Aristoteles, Metaphysik 1, 2. 983 a 3, als ein «altes Sprichwort» angeführt; Plutarch, Quomodo adulescens poetas audire debeat 2. 16 A, zitiert ihn als ein Schlüsselwort für den Umgang mit der Dichtung. Ein Scholion zu der erstgenannten Stelle weist das Wort Solons Elegien zu (daher auch in: Diehl, Anthologia Lyrica Graeca, Solon, Fragment 21). Jedenfalls gehört der Satz in die im 6. Jahrhundert v. Chr. von Xenophanes eröffnete, im 4. Jahrhundert v. Chr. von Platon fortgeführte philosophische Kritik am Götter- und Menschenbild des alten Mythos und der frühen Dichtung, wie es der archaischen und der klassischen griechischen Zeit zumal durch die beiden Homerischen Epen und die Hesiodeische «Theogonie» vermittelt wurde. Vgl. Poetica licentia , unten S. 129.
Πολυμαϑίη νόον (ἔχειν) οὐ διδάσκει (Polymathie noon echein u didaskei) . «Vielwisserei lehrt nicht Vernunft (haben), (denn sonst hätte sie Hesiod Vernunft gelehrt und Pythagoras und wiederum Xenophanes und Hekataios).» Heraklit bei Diogenes Laërtios, Leben und Lehre der Philosophen 9, 1, und bei Athenaios, Deipnosophisten 13, 91. 610 B (in: Diels-Kranz, Fragmente der Vorsokratiker, Fragment B 40). Demokrit hat die Kritik übernommen – Πολλοί πολυμαϑέες νοῦν οὐκ ἔχουσιν, «Viele Vielwisser haben keine Einsicht» – und der Heraklitischen «Vielwisserei» eine danach neugeprägte πολυνοίη (polynoïe) , «Vieldenkerei», gegenübergestellt: Πολυνοίην, οὐ πολυμαϑίην ἀσκέειν χρή, «Viel zu denken, nicht viel zu wissen sollte einer sich bemühen» (in: Diels-Kranz, Fragmente der Vorsokratiker, Fragment B 64 und 65).
Πρῶτον ψεῦδος (Proton pseudos) . «Erster Irrtum» (in dem Sinne: «grundlegender Irrtum»). Aristoteles, Erste Analytik 2, 18. 66 a 16: Ὁ δε ψευδὴς λόγος γίνεται παρὰ τὸ πρῶτον ψεῦδος, «Die irrige Schlußfolgerung ergibt sich entsprechend einem ersten Irrtum» (in dem Sinne: «… infolge eines Irrtums in einer der beiden Voraussetzungen»). Der «erste Irr tum» geht in alle unmittelbar oder mittelbar von ihm abgeleiteten Schlußfolgerungen ein; er kann damit – selbst bei einem völlig einwandfreien Schlußverfahren – zu zahlreichen weiteren Irrtümern führen.
(Ἐπάμεροι · τί δέ τις; τί δ’ οὔ τις) σκιᾶς ὄναρ/ἄνϑρωπος (Epameroi; ti de tis? ti d’ u tis? Skias onar/anthropos) . «(Von Tag zu Tag Lebende: Was ist einer? Was ist einer nicht?) Eines Schattens Traum ist der Mensch» (in dem Sinne: «Ein Schatten im Traum ist der Mensch»). Pindar, Pythische Oden 8, 135f. Das griechische Adjektiv ἐπάμερος, attisch ἐϕήμερος, eigentlich: «auf den Tag gestellt», bezieht sich hier nicht wie das davon abgeleitete «ephemer» auf die Kürze des Lebens, sondern auf den Wechsel des Glücks von einem Tag zum anderen.
Τέτλαϑι δή, κραδίη · καὶ κύντερον ἄλλο ποτ’ ἔτλης … (Tetlathi de, kradie, kai kynteron allo pot’ etles …) «Halte denn aus, Herz! Noch Hündischeres anderes hast du schon ausgehalten, (an dem Tage, als mir der Kyklop … die trefflichen Gefährten verzehrte).» Homer, Odyssee 20, 18f.; der in Bettlergestalt heimgekehrte Odysseus zu sich selbst, angesichts der unverschämten Dienerinnen, die lachend an ihm vorübergehen, um mit den Freiern zu schlafen. Der Gedanke – die Erinnerung an überstandenes Ungemach zur Wappnung gegen gegenwärtiges – begegnet mehrfach wieder; so bei Horaz, Satiren 2, 5, 20f. (Fortem hoc animum tolerare iubebo;/et quondam maiora tuli); Oden 1, 7, 30f. (O fortes peioraque passi/mecum saepe viri); Vergil, Aeneis 1, 198f. (O socii …/o passi graviora); Ovid, Tristien 5, 11, 7 (perfer et obdura; multo graviora tulisti …) Vgl. das Vergilische Forsan et haec olim meminisse iuvabit , unten S. 73.
Τῆς δ’ ἀρετῆς ἱδρῶτα ϑεοὶ προπάροιϑεν ἔϑηκαν/ἀϑάνατοι … (Tes d’ aretes hidrota theoi proparoithen ethekan/athanatoi …) , «Vor die Tüchtigkeit haben die Götter den Schweiß gesetzt, die unsterblichen …» Hesiod, Werke und Tage 289f. Hesiod stellt seinen Bruder Perses vor die Wahl zwischen Schlechtigkeit und Tüchtigkeit: «Ja, die Schlechtigkeit, die kann jeder glei ch haufenweise sich nehmen, ganz leicht: eben und glatt ist der Weg, ganz nahe bei wohnt sie; doch vor die Tüchtigkeit haben die Götter den Schweiß gesetzt, die unsterblichen; lang und steil ist der Weg zu ihr und rauh zu Anfang; doch wenn er die Höhe erreicht hat, fällt die Tüchtigkeit von da an leicht, so schwer sie sonst auch ist.» Der Sophist Prodikos von Keos hat Hesiods Bilder von dem ebenen, glatten Weg zur Schlechtigkeit und dem steilen, rauhen zur Tüchtigkeit zu der bekannten Erzählung von Herakles am Scheidewege ausgestaltet, die Xenophon, Memorabilien 2, 1, 20ff., im Anschluß an ein Zitat der sechs Hesiodverse in seinen eigenen Worten nacherzählt. Platon, Gesetze 4. 718 E, zitiert die sechs Verse, von dem «geflügelten» Vers 289 an wörtlich, als Zeugnis für die Weisheit des alten Dichters. – Vgl. Per aspera ad astra , unten S. 126.
Τίς πόϑεν εἶς ἀνδρῶν; πόϑι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες; (Tis pothen eis andron? Pothi toi polis ede tokees?) «Wer, woher bist du von den Menschen? Wo hast du Heimat und Eltern?» Ein Homerischer, in der «Odyssee» mehrfach wiederholter Formelvers; Odyssee 1, 170; 10, 325 und öfter. Der erste Teil der Frage erscheint auch schon in der «Ilias», 21, 150.
Χρύσεα χαλκείων, ἑκατόβοι’ ἐννεαβοίων (Chrysea chalkeion, hekatomboi’ enneaboion) . «Goldene gegen bronzene, hundert-Rinder-werte gegen neun-Rinder-werte.» Homer, Ilias 6, 236. Auf dem Schlachtfeld vor Troja entdecken der lykische Heerführer Glaukos und der griechische Vorkämpfer Diomedes ihre einst von den Großvätern geschlossene, für die Enkel fortgeltende Gastfreundschaft und erneuern die Verbindung durch den Tausch von «Gastgeschenken»: Glaukos tauscht seine goldenen Waffen gegen die bronzenen des Diomedes. Das Wort gilt einem ungleichen Tausch: «Gold gegen Bronze» – so etwa bei Cicero, Briefe an Atticus 6, 1, 22, mit Bezug auf die gewechselten Briefe – oder auch umgekehrt: Χάλκεα χρυσείων, «Bronze gegen Gold».
Ψυχῆς ἰατρεῖον (Psyches iatreion) . «Heilstätte für die Seele.» Diodor, Bibliothek 1, 49, 3. Diodor zitiert das Wort – in einer von ägyptischen Priestern übernommenen Beschreibung alter Königsgräber – als Inschrift an der «heiligen Bibliothek» eines legendären ägyptischen Königs Osymandyas. Die Inschrift ΨΥΧΗΣ IATPEION erscheint wieder über dem von Franz Anton Dirr gestalteten barocken Eingangsportal der Stiftsbibliothek St. Gallen aus dem Jahr 1781.
Ὦ ξεῖν’, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις, ὅτι τῇδε/κείμεϑα τοῖς κείνων ῥήμασι πειϑόμενοι (O xein’, angellein Lakedaimoniois, hoti tede/keimetha, tois keinon rhemasi peithomenoi) . «Fremder, melde den Lakedämoniern, daß wir hier liegen, ihren Befehlen gehorsam.» Die von den Amphiktyonen an den Thermopylen angebrachte, bei Herodot, Geschichte 7, 228, 2, ohne Nennung eines Autors angeführte, später dem Simonides zugeschriebene Inschrift zu Ehren der spartanischen Gefallenen. Das Epigramm ehrt den Opfermut der dreihundert Spartaner, die unter ihrem König Leonidas im Jahre 480 v. Chr. die Landenge der Thermopylen in Mittelgriechenland mehrere Tage lang gegen die persische Übermacht verteidigten und schließlich, nachdem eine persische Abteilung durch Verrat in ihren Rücken gelangt war, auf verlorenem Posten zuletzt «mit Händen und Zähnen kämpfend» bis auf den letzten Mann fielen. Das lakonisch knappe Epigramm fordert den Vorüberkommenden auf, den Ephoren in Sparta die Ausführung ihres Befehls zu melden. Weitere Zitate des griechischen Wortlauts finden sich bei Lykurgos, Rede gegen Leokrates 28, 109, bei Diodor, Bibliothek 11, 33, 2, und bei Strabon, Geographika 9, 4, 16 (jeweils mit dem Imperativ anstelle des militärischen Infinitivs und dem Schluß peiyÒmenoi nom€moiw, «ihren Gesetzen gehorsam»). Die Zuschreibung an Simonides erscheint zuerst bei Cicero, Tuskulanische Gespräche 1, 42, 101: In quos Simonides: Dic, hospes, Spartae nos te hic vidisse iacentes,/dum sanctis patriae legibus obsequimur , «Auf sie hat Simonides gedichtet: Sage, Fremder, in Sparta, du habest uns hier liegen gesehen, indem wir den heiligen Gesetzen des Vaterlandes Folge leisten». In der Anthologia Palatina, 7, 249, erscheint das Epigramm im Wortlaut Herodots und unter dem Namen des Simonides. Durch Friedrich Schillers Übersetzung in dem Gedicht «Der Spaziergang», Vers 97f., ist das klassi sche Epigramm auch im Deutschen zum Geflügelten Wort geworden: «Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dorten, du habest/uns hier liegen gesehen, wie das Gesetz es befahl.»
Читать дальше