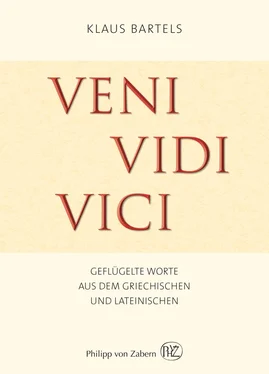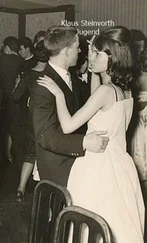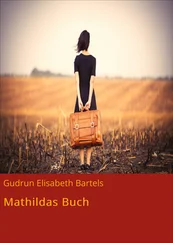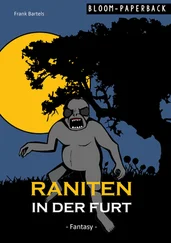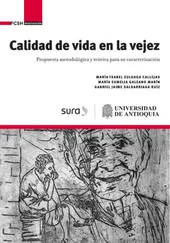Λάϑε βιώσας (Lathe biosas) . «Lebe zurückgezogen!» Epikur, Fragment 551 Usener. Ein Leitsatz der Epikureischen Ethik; im Unterschied zur Lehre der Stoa rät Epikur von jeglichem öffentlichen und zumal jeglichem politischen Engagement ab. Plutarch hat dem Leitsatz ein Essay gewidmet: «Ist die Maxime: Lebe zurückgezogen! richtig?» Vgl. die entsprechende lateinische Maxime Bene vixit, qui bene latuit , unten S. 44.
Λέγειν τὰ λεγόμενα (Legein ta legomena) . «Berichten, was berichtet wird.» Herodot, Geschichte 7, 152, 3. Eine für die Zeitgenossen der Perserkriegszeit heikle Kontroverse – es geht um das Verhalten von Argos gegenüber den Feinden – veranlaßt den «Vater der Geschichtsschreibung» (vgl. Pater historiae , unten S. 123 ), sich grundsätzlich zur Verantwortung des Historikers gegenüber der Überlieferung zu äußern: Ἐγὼ δὲ ὀϕείλω λέγειν τὰ λεγόμενα, πείϑεσϑαί γε μὲν οὐ παντάπασιν ὀϕείλω, «Ich fühle mich verpflichtet zu berichten, was berichtet wird; alles und jedes zu glauben jedoch fühle ich mich nicht verpflichtet; (und diese Erklärung hier zu soll Geltung haben für meine ganze Darstellung)». – Vgl. die lateinischen Versionen Prodenda, quia prodita (unten S. 132 )und Relata refero (unten S. 144).
Μέγα βιβλίον μέγα κακόν (Mega biblion mega kakon) . «Ein großes Buch ist ein großes Übel.» Kallimachos bei Athenaios, Deipnosophisten, Auszug aus dem 3. Buch, 72 A (Fragment 465 Pfeiffer): … ὅτι Καλλίμαχος … τὸ μέγα βιβλίον ἔλεγεν εἶναι τῷ μεγάλῳκακῷ, «… daß Kallimachos … gesagt habe, das große Buch sei gleich dem großen Übel». Die alexandrinischen Dichter lehnten das Homerische Epos und überhaupt jedes voluminöse literarische Kunstwerk ab und bevorzugten stattdessen die weniger umfangreichen, dafür brillant geschliffenen kleinen Formen wie etwa die des Epigramms.
Μέτρον ἄριστον (Metron ariston) . «Das Maß ist das Beste.» Bei Stobaios, Anthologie 3, 1, 172 (in: Diels-Kranz, Fragmente der Vorsokratiker, Band I, S. 63, Zeile 2), eröffnet das Wort die Reihe der Weisheitssprüche des Kleobulos von Lindos. Vgl. den entsprechenden Weisheitsspruch Μηδὲν ἄγαν, «Nichts im Übermaß!», unten S. 21, und die Horazische Aurea mediocritas , unten S. 41.
Μὴ κινεῖν κακὸν εὖ κείμενον (Me kinein kakon eu keimenon) . «Ein Übel, das gut liegt, nicht bewegen» (in dem Sinne: «… nicht aufrühren»). Eine sprichwörtliche Mahnung, in dieser Fassung bezeugt bei Hypereides, Fragment 30 Jensen, zitiert in den Scholien zu Platon, Philebos 15 C. Neben der Anspielung in Platons «Philebos» vgl. die früheren Zitate bei Theognis, Elegische Verse 1, 423, und bei Sophokles, Ödipus auf Kolonos 510f., sowie die Abwandlung Μὴ κινεῖν τὰ ἀκίνητα, «Das Unbewegliche nicht bewegen», bei Platon, Gesetze 11. 913 B. Vgl. die lateinische Version Quieta non movere , unten S. 138.
Μηδὲν ἄγαν (Meden agan) . «Nichts im Übermaß!» Platon, Protagoras 343 Af., zitiert die knappgefaßte Mahnung neben Γνῶϑι σεαυτόν, «Erkenne dich selbst!» (oben S. 13), als Inschrift am Apollontempel in Delphi und schreibt sie den Sieben Weisen zu, als eine «gemeinsame Erstlingsgabe ihrer Weisheit» und Weihegabe an Apollon. Weitere Zitate bei Platon, Charmides 165 A; Menexenos 247 Ef.; Philebos 45 D. Aristoteles, Rhetorik 2, 21. 1395 a 21f., zitiert den Spruch als ein Beispiel für «im Volk geläufige Worte» (δεδημοσιευμένα. Bei Stobaios, Anthologie 3, 1, 172 (in: Diels-Kranz, Fragmente der Vorsokratiker, Band I, S. 63, Zeile 14) eröffnet das Wort die Reihe der Weisheitssprüche des Solon von Athen. Vgl. die lateinische Version Ne quid nimis , unten S. 102, den entsprechenden Weisheitsspruch Μέτρον ἄριστον, «Das Maß ist das Beste», oben S. 21, und die Horazische Aurea mediocritas , unten S. 41.
Μῆνιν ἄειδε, ϑεά, Πηληιάδεω Ἀχιλῆος/οὐλομένην … (Menin aeide, thea, Peleïadeo Achileos/ulomenen …) «Den Zorn singe, Göttin, des Peleussohnes Achilleus, den verderblichen …» Homer, Ilias 1, 1f.; der Anfangsvers des ältesten Werkes der europäischen Literatur. Sogleich das erste Wort bezeichnet den Gegenstand des Epos, den Zorn des griechischen Vorkämpfers Achilleus, der im 1. Gesang im Streit mit dem Heerführer Agamemnon ausgelöst und im 24. Gesang in der Begegnung mit dem trojanischen König Priamos beigelegt wird. Die Anrede «Göttin» gilt der Muse; die Dreizahl und schließlich die Neunzahl der Musen ist erst später aufgekommen.
Νόμος ὁ πάντων βασιλεὺς ϑνατῶν τε καὶ ἀϑανάτων/ἄγει δικαιῶν τὸ βιαιότατον/ὑπερτάτᾳ χειρί (Nomos ho panton basileus thnaton te kai athanaton/agei dikaion to biaiotaton/hypertata cheiri) . «Der (geltende, ordnende) Nomos, der König über alle, Sterbliche und Unsterbliche, führt mit sich, es rechtfertigend, das Gewalttätigste, in übermächtiger Hand.» Pindar, Fragment 169, 1ff. Snell, wörtlich zitiert bei Platon, Gorgias 484 B, bei Aelius Aristeides, Rede über die Rhetorik (2), 226, und in den Scholien zu Pindar, Nemeische Oden 9, 35 a. Der unübersetzbare griechische Grundbegriff «Nomos» bezeichnet alles, was allgemein in Geltung steht: Brauch und Sitte, Norm und Regel, Recht und Gesetz; vgl. auch Ἄγραϕος νόμος, «Ungeschriebenes Gesetz», oben S. 9. Im Anschluß an eine Gegenüberstellung griechischer und indischer Bestattungsbräuche erklärt Herodot, Geschichte 3, 38, 4: «… und Pindar scheint mir richtig zu dichten, wenn er sagt, daß der Nomos König über alle sei». In Platons «Gorgias», 484 Bff., sucht Kallikles, ein hitzköpfiger Anhänger des ruhigeren Gorgias, das Pindarwort in den Dienst seiner These vom unein geschränkten Faustrecht des Stärkeren als dem ursprünglichen, eigent lichen «Gesetz der Natur» zu stellen.
Ὁ ἄνϑρωπος ϕύσει πολιτικὸν ζῷον (ἐστίν) (Ho anthropos physei politikon zoon estin) . «Der Mensch ist von Natur ein staatenbildendes Lebewesen.» Aristoteles, Politik 1, 2. 1253 a 1ff.: «Daraus ergibt sich nun deutlich, daß die Staatsgemeinschaft zu den naturgegebenen Dingen gehört und daß der Mensch von Natur ein staatenbildendes Lebewesen ist; wer aufgrund seiner inneren Anlage und nicht aufgrund äußerer Umstände außerhalb der Staatsgemeinschaft steht, der ist entweder mißraten oder aber ein Übermensch.» Vgl. Aristoteles, Politik 3, 6. 1278 b 19; Nikomachische Ethik 1, 5. 1097 b 11; 9, 9. 1169 b 18f.
Ὁ μὴ δαρεὶς ἄνϑρωπος οὐ παιδεύεται (Ho me dareis anthropos u paideuetai) . «Der Mensch, der nicht geschunden wird, wird nicht erzogen.» Menander, Sentenzen 573 Jäkel.
Οἶδα οὐκ εἰδώς (Oida uk eidos) . «Ich weiß, daß ich nicht(s) weiß.» Nach Platon, Apologie des Sokrates 21 B: Ἐγὼ γὰρ δὴ οὔτε μέγα οὔτε σμικρὸν σύνοιδα ἐμαυτῷ σοϕὸς ὤν, «Denn ich bin mir doch nicht bewußt, irgend etwas Großes oder Kleines zu wissen» (vgl. auch 21 D und 23 B). Sokrates stellt seine Einsicht in die Nichtigkeit alles menschlichen Wissens, diese spezifisch «menschliche Weisheit» (20 D; vgl. Γνῶϑι σεαυτόν, «Erkenne dich selbst!», oben S. 13), dem vermeintlichen, nicht stichhaltigen Wissen seiner Gesprächspartner gegenüber (21 D): «Im Vergleich zu diesem Menschen bin ich der Weisere. Denn es scheint ja keiner von uns beiden irgend etwas Schönes und Gutes zu wissen; dieser aber bildet sich ein, etwas zu wissen, obwohl er doch nichts weiß; ich dagegen, wie ich nun einmal nichts weiß, bilde mir auch nicht ein, etwas zu wissen. Offenkundig bin ich, verglichen mit diesem, um eben dieses kleine Bißchen weiser: daß ich, was ich nicht weiß, mir auch nicht einbilde zu wissen.»
Читать дальше