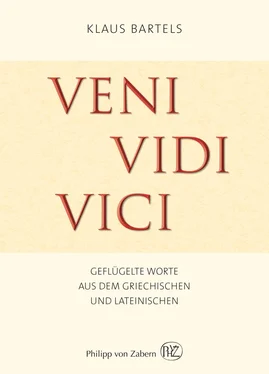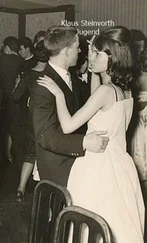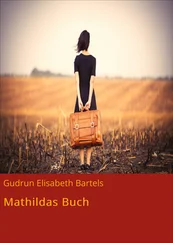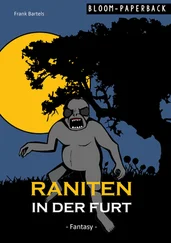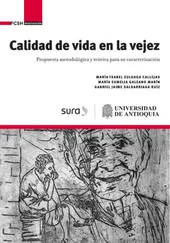Ἐργον δ’ οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργίη δὲ τ’ ὄνειδος (Ergon d’ uden oneidos, aërgië de t’ oneidos) . «Die Arbeit, die ist keine Schande; doch das Faulenzen, das ist Schande!» Hesiod, Werke und Tage 311. Plutarch, Solon 2, 6, zitiert den ersten Teil des Wortes.
Ἔσσεται ἦμαρ, ὅτ’ ἄν ποτ’ ὀλώλῃ Ἴλιος ἵρη … (Essetai emar, hot’ an pot’ olole Ilios hire …) . «Sein wird der Tag, da einst zugrunde geht die heilige Ilios (und Priamos und das Volk des lanzenguten Priamos).» Homer, Ilias 6, 448f.; der trojanische Vorkämpfer Hektor, ein Sohn des Königs Priamos, zu seiner Gattin Andromache, in der Abschiedsszene am Skäischen Tor. Vgl. Ilias 4, 164f., wo der griechische Heerführer Agamemnon diese gleichen Verse im entgegengesetzten Sinne der Siegeszuversicht an den verwundeten Menelaos richtet. Wie Polybios in seinem Geschichtswerk (38, 22) «als Ohrenzeuge» berichtet, hat Publius Cornelius Scipio Aemilianus, vom Untergang Karthagos im Jahre 146 v. Chr. tief erschüttert, angesichts des brennenden Karthago Hektors Worte zitiert und sie «ohne Rückhalt» auf seine eigene Vaterstadt Rom bezogen, «für die er demnach, auf das wechselnde Menschenlos hinblickend, fürchtete». Die Schilderung des Polybios ist bei Appian, Libyke 132, 628ff., überliefert; vgl. Diodor, Bibliothek 32, 24.
Εὕρηκα, εὕρηκα (Heureka, heureka) . «Ich hab’s gefunden! Ich hab’s gefunden!» Der Entdeckerruf des Archimedes, bei Vitruv, Lehrbuch der Architektur 9, Einleitung 10: Auf eine Anzeige gegen den Lieferanten eines Weihekranzes hin habe König Hieron II. von Syrakus Archimedes aufgefordert, den Goldgehalt des bereits geweihten Kranzes zu überprüfen, ohne das Weihgeschenk selbst dabei im geringsten anzutasten. Archimedes habe die Lösung des Problems schließlich in einem öffentlichen Bad beim Einsteigen in eine bis zum Rand gefüllte Wanne gefunden: daß er durch Eintauchen des Kranzes in Wasser zunächst dessen Volumen und daraus das Verhältnis des Gewichts zum Volumen bestimmen könne. Glücklich über seine Entdeckung sei der Gelehrte darauf unverzüglich, nackt wie er war, mit dem wiederholten Freudenruf «Heureka! Heureka!» nach Hause gelaufen, um das so entdeckte spezifische Gewicht des zu dem Kranz verwendeten Edelmetalls zu bestimmen und mit dem spezifischen Gewicht reinen Goldes zu vergleichen. Plutarch, Non posse suaviter vivi secundum Epicurum 11, 1094 C, zitiert den Ruf, um die Entdeckerfreude des Gelehrten gegen die Gaumen- und Liebesfreuden der Genießer abzusetzen: Kein Feinschmecker, kein Liebhaber werde doch je wie toll mit dem Ruf «Ich hab es geschlürft!» oder «Ich hab sie geküsst!» durch die Stadt laufen.
Ζῷον πολιτικόν (Zoon politikon): siehe Ὁ ἄνϑρωπος ϕύσει πολιτικὸν ζῷον, unten S. 22.
Θάλαττα, ϑάλαττα (Thalatta, thalatta) . «Das Meer, das Meer!» Xenophon, Anabasis 4, 7, 24. Der Freudenruf der griechischen Söldner, die sich nach der Schlacht bei Kunaxa nördlich von Babylon im Jahre 401 v. Chr. an die Südostküste des Schwarzen Meeres durchgeschlagen hatten.
Καιρὸν γνῶϑι (Kairon gnothi) . «Den (richtigen) Augenblick erkenne!» Bei Stobaios, Anthologie 3, 1, 172 (in: Diels-Kranz, Fragmente der Vorsokratiker, Band I, S. 64, Zeile 12), eröffnet das Wort die Reihe der Weisheitssprüche des Pittakos von Mytilene. Der «Kairos» bezeichnet den flüchtigen richtigen Augenblick des Sprechens und Handelns, in dem für kurze Zeit möglich wird, was vorher noch nicht und nachher nicht mehr möglich ist. In Olympia war dem vergöttlichten Kairos ein Altar geweiht, wohl nicht zuletzt im Gedanken an die Olympischen Wettkämpfe. Die berühmte Statue des Lysipp stellte den Gott im Laufen dar, wie er mit Flügeln an den Füßen auf Zehenspitzen dahinfliegt, mit einem Haarschopf über der Stirn und einem kahlgeschorenen Hinterkopf (vgl. das Epigramm des Poseidippos, Anthologia Graeca 16, 275). Daher die Redensart «die Gelegenheit beim Schopfe packen»: Wer den Kairos einmal vorübergelassen hat, bekommt ihn von hinten nicht mehr zu fassen.
Κοινὰ τὰ (τῶν) ϕίλων (Koina ta ton philon) . «Gemeinsames (Gut) ist das (Gut) von Freunden» oder «… der Freunde». Ein griechisches, in der Spätantike mehrfach den Pythagoreern zugeschriebenes Sprichwort, zuerst zitiert bei Platon, Phaidros 279 C (als das Schlußwort des Dialogs) und Gesetze 5. 739 C, dort herausgehoben als «altes Sprichwort» und maßgebendes, verpflichtendes Leitwort des besten Staates und der besten Verfassung. Weitere griechische Zitate finden sich bei Aristoteles, Nikomachische Ethik 8, 11. 1159 b 31; 9, 8. 1168 b 7f.; Menander, Adelphoi, Fragment 10 Körte. Über die lateinische Version der Menandrischen Komödie ist das griechische Sprichwort auch in Rom geläufig geworden; bei Terenz, Adelphoe 804, führt Micio gegen Demea das «alte Wort» ins Feld: … communia esse amicorum inter se omnia , «… daß alles (Gut) von Freun den unter ihnen gemeinsames (Gut) ist». Weitere lateinische Zitate finden sich bei Cicero, De officiis 1, 16, 51; 2. Rede gegen Verres 2, 36, 89, bei Seneca, De beneficiis 7, 4, 1; 7, 12, 1; Briefe an Lucilius 6, 3; 48, 2f., bei Symmachus, Briefe 9, 106, bei Ambrosius, De viduis 1, 4, und bei Hier onymus, Apologia adversus libros Rufini 3, 39. 485 B. Aristoteles, Politik 2, 5. 1263 a 30ff., bezieht das «Sprichwort» auf eine sinnvolle Verbindung von Gemeineigentum und Privateigentum.
Κτῆμά τε ἐς αἰεὶ μᾶλλον ἢ ἀγώνισμα ἐς τὸ παραχρῆμα ἀκούειν ξύγκειται (Ktema te es aiei mallon e agonisma es to parachrema akuein xynkeitai) . «Als ein Besitz für jegliche künftige Zeit eher denn als ein Wettkampf-Glanzstück für den Ohrengenuß im Vorübergehen ist es geschrieben.» Thukydides, Peloponnesischer Krieg 1, 22, 4. Mit einem deutlichen Seitenhieb auf die Effekthascherei in den Redewettkämpfen seiner Zeit erklärt Thukydides am Schluß der Einleitung zu seinem Geschichtswerk: «Zum Zuhören wird vielleicht diese undichterische Darstellung minder ergötzlich scheinen; wer aber das Gewesene klar erkennen will und damit auch das Künftige, das wieder einmal, nach der menschlichen Natur, gleich oder ähnlich sein wird, der mag es so für nützlich halten, und das soll mir genug sein: Zum dauernden Besitz, nicht als Prunkstück fürs einmalige Hören ist es aufgeschrieben.» (Übersetzung: Georg Peter Landmann.) Plinius der Jüngere, Briefe 5, 8, 11, nimmt die Gegenüberstellung auf: Nam plurimum refert, ut Thukydides ait, κτῆμα sit an ἀγώνισμα, quorum alterum oratio, alterum historia est , «Denn es kommt sehr darauf an, wie Thukydides sagt, ob etwas ein Besitz oder ein Wettkampf-Glanzstück ist, wovon das zweite die Rede, das erste das Geschichtswerk ist».
Κύκλος τῶν ἀνϑρωπηων πρηγμάτων (Kyklos ton anthropeïon pregmaton) . «Der Kreislauf der Menschendinge» (in dem Sinne: «Der ständige Wechsel von Aufstieg und Niedergang»). Nach Herodot, Geschichte 1, 207, 2, wo der anfangs sprichwörtlich glückliche, schließlich ins Unglück gestürzte Lyderkönig Kroisos zu dem jungen Perserkönig Kyros spricht: … ἐκεῖνο πρῶτον μάϑε, ὡς κύκλος τῶν ἀνϑρωπηίων ἐστὶ πρηγμάτων, περιϕερόμενος δὲ οὐκ ἐᾷ αἰεὶ τοὺς αὐτοὺς εὐτυχέειν, «… mache dir dieses als erstes klar: Es gibt einen Kreislauf der Menschendinge, der läßt mit seinem Umlauf nicht zu, daß immer dieselben im Glück sind». Der nach seinem Sturz am Perserhof verbliebene Kroisos äußert sich zu dem bevorstehenden Feldzug der Perser gegen die Massageten, in dem Kyros den Tod finden wird. Dem strategischen Rat stellt er eine menschliche Lehre voran: «Mein Leid, so unerfreulich es war, ist mir zur Lehre geworden (vgl. Παϑήματα μαϑήατα, unten S. 24 ). Wenn du meinst, unsterblich zu sein und über ein ebensolches Heer zu gebieten, so wäre es sinnlos, daß ich dir riete. Wenn du dir aber bewußt bist, selbst ein Mensch zu sein und über andere ebensolche Menschen zu gebieten, so mache dir dieses als erstes klar: Es gibt einen Kreislauf der Menschendinge, der läßt mit seinem Umlauf nicht zu, daß immer dieselben im Glück sind». Im lateinischen Mittelalter nimmt dieser Herodoteische «Kreislauf der Menschendinge» die Gestalt der Rota Fortunae , des «Rades der Glücksgöttin», an, so in den Carmina Burana, Nr. 16 und 17. Vgl. die Solonische, gleichfalls an Kroisos gerichtete Mahnung Nemo ante mortem beatus est , unten S. 103.
Читать дальше