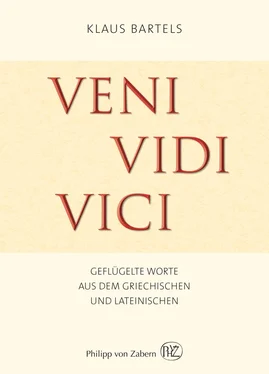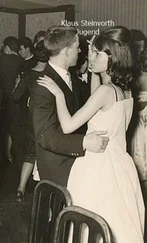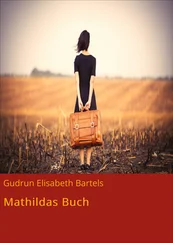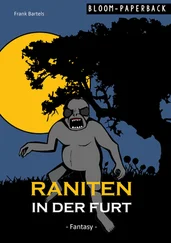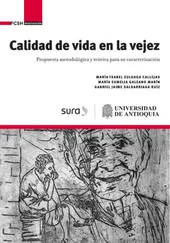Ἄγνωστος ϑεός (Agnostos theos) . «Unbekannter Gott.» Lukas, Apostelgeschichte 17, 23, aus dem Anfang der Rede des Apostels Paulus auf dem athenischen Areopag: «Denn als ich durch eure Stadt ging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, auf dem die Inschrift stand: Dem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch.»
Ἄγραφος νόμος (Agraphos nomos) . «Ungeschriebenes Gesetz.» Der Begriff des «ungeschriebenen Gesetzes» begegnet zuerst in einem bei Andokides, Rede über die Mysterien 85ff., angeführten Solonischen Gesetz, das die Anwendung nicht schriftlich aufgezeichneter und öffentlich bekanntgemachter Gesetze ausschloß. In der Folge deutet der Begriff insbesondere auf das in der Natur begründete, besonderer Bestätigung nicht bedürftige «Naturrecht»; so bei Sophokles, Antigone 454f., wo Antigone sich gegenüber Kreons Gebot, den Leichnam des toten Polyneikes nicht zu bestatten, sondern den Vögeln und Hunden zu überlassen, auf die «ungeschriebenen, niemals wankenden Satzungen der Götter» (ἄγραπτα κἀσφαλῆ ϑεῶν/νόμιμα) beruft, und bei Thukydides, Peloponnesischer Krieg 2, 37, 3, wo Perikles in seiner Rede auf die Gefallenen den von den Archonten erlassenen Gesetzen die «ungeschriebenen» zur Seite stellt, die, wenn sie übertreten werden, «nach allgemeinem Urteil Schande bringen» (… ὅσοι ἄγραφοι ὅντες αἰσχύνην ὁμολουένην φέρουσιν).
Ἀεὶ γὰρ εὖ πίπτουσιν οἱ Διὸς κύβοι (Aei gar eu piptusin hoi Dios kyboi) .«Denn allemal gut fallen die Würfel des Zeus.» Sophokles, in: Nauck, Tragicorum Graecorum Fragmenta, Fragment 809. Der in einem Scholion zu Euripides, Orest 603, dem Sophokles zugeschriebene, vielfach auch sonst – ohne Nennung eines Autors – angeführte Vers war nach dem Zeugnis des Eustathios, Kommentar zu Homers Ilias, S. 1084, Zeile 2f., und zur Odyssee, S. 1397, Zeile 18, «sprichwörtlich» geläufig.
(Κἀν βροτοῖς)/αἱ δεύτεραί πως φροντίδες σοφώτεραι (Kan brotois/hai deuterai pos phrontides sophoterai) . «(Und bei uns Menschen sind) die zweiten Gedanken irgendwie die klügeren.» Euripides, Hippolytos 435f.; die Amme zu Phädra. Cicero, 12. Philippische Rede 2, 5, zitiert den offenbar geläufigen Vers in lateinischer Version: Posteriores enim cogitationes, ut aiunt, sapientiores solent esse , «Die späteren Gedanken sind ja, wie man sagt, gewöhnlich die klügeren»; in einem Brief an seinen Bruder Quintus, 3, 1, 18, spielt er mit den zwei griechischen Worten δευτέρας φροντίδας locker auf den Euripidesvers an. Vgl. Errare humanum est , unten S. 65.
Αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων/μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυέμεν (Aien aristeuein kai hypeirochon emmenai allon/mede genos pateron aischynemen) . «Immer der Beste zu sein und überlegen zu sein den anderen und dem Geschlecht der Väter nicht Schande zu machen.» Homer, Ilias 6, 208f.; der lykische Heerführer Glaukos zitiert die Mahnung, mit der sein Vater Hippolochos, der Sohn des Bellerophontes, ihn in den Trojanischen Krieg ausgesandt hatte. Der erste der beiden Verse erscheint Ilias 11, 784 noch einmal; dort erinnert Nestor den Patroklos an die Mahnung, mit der Peleus seinen Sohn Achilleus in den Krieg ausgesandt hatte. Cicero führt das Mahnwort in einem Brief an seinen Bruder Quintus, 3, 5, 4, leicht variiert in griechischer Sprache an.
Ἀλλ ’ἦ τοι μὲν ταῦτα ϑεῶν ἐv γούνασι κεῖται (All’ etoi men tauta theon en gunasi keitai) . «Aber wahrhaftig! Das liegt nun im Schoße der Götter.» Ein Homerischer Formelvers; Ilias 17, 514; Odyssee 1, 267 und öfter.
Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον … (Andra moi ennepe, Musa, polytropon …) «Den Mann nenne mir, Muse, den vielgewandten …» Homer, Odyssee 1, 1; der Anfang der Homerischen «Odyssee», des – nach der «Ilias» – zweitältesten Werks der europäischen Literatur: «Den Mann nenne mir, Muse, den vielgewandten, der gar viel umgetrieben wurde, nachdem er Trojas heilige Stadt zerstörte …» Homer kannte erst eine einzige Muse; zum Abschluß des Musenanrufs in Vers 10 wird sie noch einmal angesprochen: «Davon …, Göttin, Tochter des Zeus, sage auch uns!» Der Name des «vielgewandten», listenreichen Odysseus wird erst in der folgenden Götterszene genannt.
Ἀνέγνων, ἔγνων, κατέγνων (Anegnon, egnon, kategnon) . «Ich habe gelesen, ich habe verstanden, ich habe verworfen.» Kaiser Julianus Apostata, der vom Christentum «Abtrünnige», in einem (nicht datierbaren) Brief an die führenden christlichen Bischöfe, bei Sozomenos, Kirchengeschichte 5, 18, 7. Wie Sozomenos weiter berichtet, erwiderten die Bischöfe: «Du hast wohl gelesen, aber nicht verstanden; denn wenn du verstanden hättest, hättest du nicht verworfen.» Das kaiserliche Verdikt ist der prägnanten Kürze des Caesarischen Veni vidi vici (unten S. 176) nachgebildet.
Ἄνϑρωπος μέτρον ἁπάντων (Anthropos metron hapanton) . «Der Mensch ist das Maß aller Dinge.» Der sogenannte «Homo-mensura-Satz» des Protagoras, des Archegeten der griechischen Sophistik (in: Diels-Kranz, Fragmente der Vorsokratiker, Fragment B 1). Der Eingangssatz der – verlorenen – Schrift «Wahrheit» ist im Wortlaut und vollständig zitiert bei Sextus Empiricus, Adversus mathematicos 7, 60, und bei Diogenes Laërtios, Leben und Lehre der Philosophen 9, 51: Πάντων χρημάτων μέτρον (ἐστὶν) ἄνϑρωπος, τῶν μὲν ὄντων, ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων, ὡς οὐκ ἔστιν, «Aller Dinge Maß ist der Mensch, sowohl der seienden, daß (wie) sie sind, als auch der nicht seienden, daß (wie) sie nicht sind». Zitate in abhängiger Rede finden sich bereits bei Platon, Kratylos 385 Ef. (nur der erste Teil) und Theaitetos 152 A. An der zweiten Stelle erklärt Platon dazu: «Er meint es doch ungefähr so: Wie die einzelnen Dinge mir erscheinen, so sind sie für mich, und wie sie dir erscheinen, so sind sie wiederum für dich: Ein Mensch bist du doch so gut wie ich?» Vgl. noch die sarkastischen Bemerkungen im «Theaitetos» 161 Cff. und die Platonische Gegenthese in den «Gesetzen», 4. 716 C: Ὁ δὴ ϑεὸς ἡμῖν πάντων χρημάτων μέτρον ἂν εἴη μάλιστα, καὶ πολὺ μᾶλλον ἤ πού τις, ὥς φασιν, ἄνϑρωπος, «Der Gott also wäre uns wohl am ehesten das Maß aller Dinge, und er viel eher als etwa, wie sie sagen, irgendein Mensch».
Ἄριστον μὲν ὕδωρ, ὁ δὲ χρυσός … (Ariston men hydor, ho de chrysos …) «Das Beste ist das Wasser, und das Gold …» Pindar, Olympische Oden 1, 1. Die Eingangsworte des Siegesliedes für Hieron von Syrakus, Sieger mit dem Rennpferd im Jahre 476 v. Chr.
Ἀρχὴ ἥμισυ παντός (Arche hemisy pantos) . «Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen.» Bei Platon, Gesetze 6. 753 E, und Aristoteles, Politik 5, 4. 1303 b 29, ist der Satz als «sprichwörtlich» geläufig angeführt. Platon steigert das Wort an der Stelle noch über die «Hälfte» hinaus: Τὸ δ’ ἔστιν τε, ὡς ἐμοὶ φαίνεται, πλέον ἢ τὸ ἥμισυ, «(Ein guter Anfang) ist aber sogar, wie mir scheint, noch mehr als die Hälfte». Aristoteles, Nikomachische Ethik 1, 7. 1098 b 7, zitiert das Wort in der gleichen zugespitzten Fassung: Δοκεῖ γὰρ πλεῖον ἢ ἥμισυ τοῦ παντὸς εἶναι ἡ ἀρχή, «Denn der Anfang scheint noch mehr als die Hälfte des Ganzen zu sein». Vgl. Aristoteles, Sophistici elenchi 33. 183 b 22f.: «Das Wichtigste ist vielleicht der Anfang von jeder Sache.» Durch Horaz ist das Wort auch im Lateinischen zum Geflügelten Wort geworden; vgl. Dimidium facti, qui coepit, habet , unten S. 56.
Читать дальше