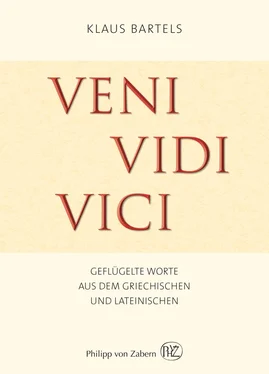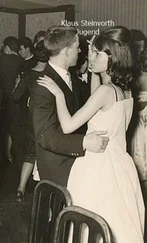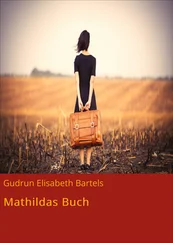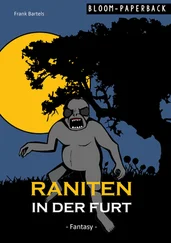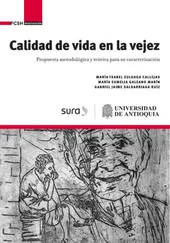Ab imo pectore.«Aus tiefster Brust.» Die Wendung begegnet mehrfach in epischer Sprache; vgl. zum Beispiel Catull, Gedichte 64, 198 (pectore ab imo); Lukrez, De rerum natura 3, 57 (pectore ab imo); Vergil, Aeneis 1, 371 (imo … a pectore); 1, 485 (pectore ab imo) .
Ab love principium, Musae.«Von Jupiter her (nehmt) den Anfang, Musen». Vielleicht ist Musae auch als Genitiv zu verstehen: «Von Jupiter her (rührt) der Anfang (meiner) Muse.» Vergil, Bucolica 3, 60; vgl. den entsprechenden Versanfang Aeneis 7, 219: Ab Iove principium generis , «Von Jupiter her (rührt) der Anfang unseres Geschlechts». Der Vergilische Musenanruf nimmt den Eingangsvers der Aratischen «Phainomena» auf: Ἐκ Διὸς ἀρχώμεσϑα, «Von Zeus aus wollen wir beginnen», vgl. den gleichlautenden Musenanruf bei Theokrit, Idyllen 17, 1. Cicero, De legibus 2, 3, 7, zitiert den Aratvers in seiner eigenen Übersetzung: Ab Iove Musarum primordia , «Von Jupiter her (rühren) die Uranfänge der Musen»; Iulius Caesar Germanicus ist in seiner Übersetzung Vergil gefolgt: Ab Iove principium magno deduxit Aratus , «Von dem großen Jupiter hat Arat den Anfang hergeleitet». Vgl. weiterhin Cicero, De re publica 1, 36, 56 (Imitemur ergo Aratum, qui magnis de rebus dicere exordiens ab Iove incipiendum putat); Ovid, Metamorphosen 10, 148f. (Ab Iove, Musa parens, …/carmina nostra move!) , und Festkalender 5, 111 (Ab Iove surgat opus); Calpurnius Siculus, Eklogen 4, 82 (Ab Iove principium, si quis canat aethera, sumat); Statius, Silvae 1, Einleitung (Sumendum enim erat ab Iove principium); Quintilian, Lehrbuch der Rhetorik 10, 1, 46 (ut Aratus ab Iove incipiendum putat) . Die Aratstelle geht ihrerseits wohl auf Alkman, Fragment 29 Page, zurück: Ἐγὼν δ' ἀείσομαι ἐκ Διὸς ἀρχομένα, «Ich will singen, von Zeus aus anfangend».
Ab ovo.«Vom Ei (der Leda) an» (in dem Sinne: «vom ersten Anfang an», «von Adam und Eva an» etwas erzählen). Horaz, Ars poetica 147. Horaz illustriert die Kunst, ein episches Gedicht richtig anzufangen, am Beispiel Homers, der den Trojanischen Krieg nicht gemino … ab ovo , «vom Zwillings-Ei (der Leda) an», zu erzählen beginne, sondern den Hörer sogleich in medias res , «mitten in die Dinge hinein» (unten S. 86), mit sich fortreiße. Nach ihrer Vereinigung mit Zeus in der Gestalt eines Schwans hatte Leda, die Gattin des spartanischen Königs Tyndareos, in einem einzigen Ei – oder auch in zweien – neben den Dioskuren Kastor und Polydeukes als dritte die schöne Helena geboren; um ihretwillen war es in der Folge, nach vielerlei Verwicklungen, zum Trojanischen Krieg gekommen. Die Horazische Prägung wurde sprichwörtlich; vgl. Atilius Fortunatianus, Ars metrica, in: Keil, Grammatici Latini, Band VI, S. 278, Zeile 13f.: Altius et ab ovo mihi, quod aiunt, repetenda res est , «Ich muß tiefer zurückgreifen und die Sache vom Ei an, wie man sagt, darlegen». Vgl. das hier folgende ebenfalls ursprünglich Horazische Ab ovo/usque ad mala .
Ab ovo/usque ad mala.«Vom Ei bis zu den Äpfeln» (in dem Sinne: «Von der Vorspeise bis zum Dessert», vom Anfang der Mahlzeit bis zu ihrem Ende). Horaz, Satiren 1, 3, 6f. Vgl. das voraufgehende ebenfalls ursprünglich Horazische Ab ovo .
Ab urbe condita (a. u. c.)«Seit Gründung der Stadt.» Die gelehrte römische Jahreszählung ging aus von dem Epochenjahr der Gründung der Stadt: 753 v. Chr. nach der «Varronischen» Zählung, die seit ihrer Einführung durch Marcus Terentius Varro im 1. Jahrhundert v. Chr. gebräuchlich geblieben ist, 752 v. Chr. nach der älteren «Kapitolinischen» Zählung der Fasti Capitolini . Livius gab seinem klassischen Geschichtswerk, das in 142 «Büchern» die römische Geschichte von der Gründung der Stadt bis zur Zeit des Augustus darstellte, den Titel «Ab urbe condita» . Im alltäglichen Sprachgebrauch und selbst in der historischen Literatur wurden die Jahre allerdings nicht mit einer Jahreszahl «seit Gründung der Stadt», sondern jeweils einfach mit den Namen der Konsuln bezeichnet.
Abusus non tollit usum.«Der Mißbrauch (eines Rechtes) hebt den Gebrauch (dieses Rechtes) nicht auf.» Der Ursprung des Wortes ist nicht nachgewiesen.
Abusus optimi pessimus.«Der Mißbrauch des Besten ist der schlimmste.» Der Ursprung des Wortes ist nicht nachgewiesen. Das Muster des Gedankens findet sich bereits bei Aristoteles, Politik 1, 2. 1253 a 31ff.: «Wie der Mensch, zu seiner Vollendung gebracht, das höchste von allen Lebewesen ist, so ist er zugleich, geschieden von Gesetz und Recht, das niederste von allen.»
Ad Kalendas Graecas.«An den griechischen Kalenden» (in dem Sinne: «Am St.-Nimmerleins-Tag»). Sueton, Augustus 87, 1. Sueton führt an der Stelle einige in den eigenhändigen Briefen des Augustus öfter begegnende Redensarten an. Um auszudrücken, daß manche Schuldner niemals mehr zahlen würden, habe Augustus wiederholt gesagt: ad Kalendas Graecas soluturos , «daß sie an den griechischen Kalenden zahlen würden». Die Kalendae , der Monatserste im römischen Kalender, waren der übliche Zahlungstermin; daher hießen sie bei den Schuldnern auch celeres Kalendae , die «rasenden Kalenden». Im griechischen Kalender figurierten solche römischen «Kalenden» natürlich nicht.
Ad maiorem Dei gloriam (vicit pietas).«Zum größeren Ruhme Gottes (siegte die Frömmigkeit).» Papst Gregor I., der Große (590–604), Dialoge 1, 2 (in: Migne, Patrologia Latina, Band 77, Spalte 160 C). Die Formel Ad maiorem Dei gloriam erscheint später mehrfach in den Beschlüssen des Tridentinischen Konzils (1545–1563); durch Ignatius von Loyola wurde sie zum Wahlspruch des im Jahre 1534 gegründeten Jesuitenordens.
Ad usum Delphini.«Für den Gebrauch des Dauphin», «Für die Hände des Dauphin». Die heute nur noch ironisch gebrauchte Wendung bezeichnet gekürzte oder bearbeitete Textausgaben, vornehmlich Schulausgaben, in denen sittlich oder sonstwie anstößige Stellen gestrichen oder geändert sind. Die Bezeichnung geht auf die Klassikerausgaben zurück, die Jacques Bénigne Bossuet (1627–1704) und Pierre Daniel Huet (1630–1721) im Auftrag Ludwigs XIV. für den französischen Thronfolger, den nach dem Fürstentum Dauphiné so benannten «Dauphin», besorgt haben.
(Grammatici certant, et) adhuc sub iudice lis est.«(Die Philologen tragen ihre Kämpfe aus, und) noch ist der Streit nicht entschieden.» Horaz, Ars poetica 78; dort geht es um die Frage, wer das elegische Versmaß, das «Distichon», den «Zweizeiler» aus einem Hexameter und einem Pentameter, als erster eingeführt habe.
Advocatus diaboli.«Anwalt des Teufels.» Im Prozeß einer Selig- oder einer Heiligsprechung steht dem Postulator , dem «Forderer» der Kanonisation, ein Promotor fidei , ein «Förderer des Glaubens», gegenüber. Der erste, volkstümlich auch als Advocatus Dei , «Anwalt Gottes», bezeichnet, vertritt die Sache der Selig- oder Heiligsprechung; der zweite, volkstümlich auch als Advocatus diaboli , «Anwalt des Teufels», bezeichnet, hat die Aufgabe, alle der Kanonisation etwa entgegenstehenden Umstände zu untersuchen und geltend zu machen.
Aequam memento rebus in arduis/servare mentem, (non secus in bonis/ab insolenti temperatam/laetitia, moriture Delli).«Einen gleichmütigen Sinn gedenke allzeit zu bewahren in schweren Zeiten, (nicht anders in guten einen von überschwänglicher Freude gemäßigten, sterblicher Dellius)» (die Anrede in dem Sinne: «… da du ja in jedem Falle einmal sterben wirst»). Horaz, Oden 2, 3, 1ff. Aus der Schlußstrophe der Ode stammt das gleich falls «geflügelte» Omnes eodem cogimur , unten S. 117.
Читать дальше