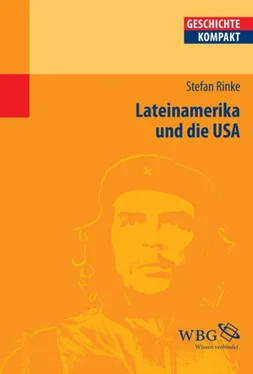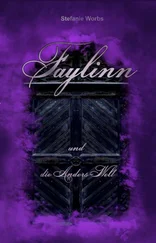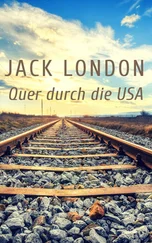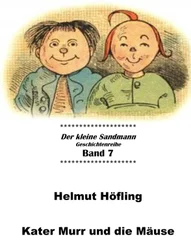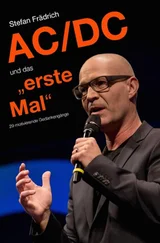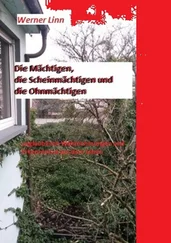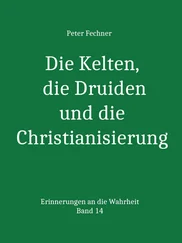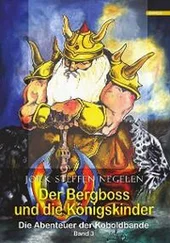Erfindung Amerikas
Das Wissen, dass es sich bei den Entdeckungen der iberischen Mächte um einen neuen Kontinent, eine Neue Welt, handelte, sollte sich aber zu Beginn des 16. Jahrhunderts schnell durchsetzen. 1507 bereits erfanden humanistische Gelehrte in Lothringen den Namen Amerika. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts waren die Eroberungen der Räume, in denen sich die spanische Siedlungskolonisation vollzog, im Wesentlichen abgeschlossen. Im Hinterland dagegen wie zum Beispiel in den riesigen Territorien des heutigen Südwestens der USA oder in Florida unterhielt man bestenfalls Missionen oder Militärstützpunkte, ohne jedoch eine wirksame Durchdringung zu erzielen. Die Portugiesen intensivierten zu diesem Zeitpunkt ihre Kolonisierungsbemühungen entlang der brasilianischen Küste. Sowohl für die spanische als auch für die portugiesische Krone blieben die eroberten Gebiete in erster Linie Quellen des Reichtums, vor allem von Edelmetallen, die es zu nutzen galt, um den eigenen Staatshaushalt und die Politik in Europa zu finanzieren. Insgesamt klafften die Idealvorstellungen der iberischen Mutterländer und die Realitäten in Amerika weit auseinander.
Die Monopolansprüche bestanden schon bald nach der Entdeckung nur noch theoretisch, da sich europäische Rivalen in den Amerikas breit machten. Neben den Franzosen waren es im 16. Jahrhundert vor allem die Engländer, die die Ansprüche der iberischen Mächte anfochten, indem sie auf eigene Entdeckungsfahrten gingen. Zwar bezeichnete der Begriff „ America “ im englischen Sprachgebrauch noch bis weit ins 17. Jahrhundert hinein die iberischen Besitzungen mit ihren ungeahnten Reichtümern. Doch schon 1497 erfolgte die symbolische Inbesitznahme neu entdeckter Länder in Nordamerika durch den Genuesen in englischen Diensten, John Cabot (ca. 1450 – 1499), der ebenfalls glaubte, Asien entdeckt zu haben. Cabots Entdeckung sollte später eine Grundlage der englischen Ansprüche in den Amerikas bilden. Unter der Herrschaft Heinrichs VIII. (1509 – 1547) gab es keine weiteren Entdeckungsreisen, denn angesichts der innenpolitischen Probleme waren dem König gute Beziehungen zu Spanien wichtiger als Abenteuer in Übersee.
Diese Zurückhaltung gab seine Nachfolgerin Elisabeth I. (1558 – 1603) auf, was sich an den Kolonialprojekten von Gelehrten und Abenteurern wie Humphrey Gilbert (1537 – 1583) und Richard Hakluyt (1552 – 1616) ablesen lässt. Das bis dahin gute Verhältnis zwischen Spanien und England verschlechterte sich in kurzer Zeit. Ziel der englischen Politik war es von nun an, die Monopolstellung Spaniens in Amerika zu brechen, um am Reichtum der Neuen Welt teilzuhaben, Handelsvorteile zu erlangen und eigene Siedlungsprojekte durchzusetzen. England sollte außerdem als Schutzmacht der Protestanten dem katholischen Universalanspruch in Amerika entgegentreten und sich den Indigenen als neuer Verbündeter gegen die spanische Herrschaft anbieten.
Q
Richard Hakluyt fordert eine englische Kolonisation in Nordamerika (1582)
Aus: Eberhard Schmitt et al., Bd. 3, S. 81.
Wenn ich … bedenke, dass für jeden seine Zeit kommt, und sehe, dass die Zeit der Portugiesen vorbei ist und dass die Nacktheit der Spanier und ihre langgehüteten Geheimnisse, mit denen sie sich daran machten, die Welt zu täuschen, nun endlich offengelegt werden, so fasse ich große Hoffnung, dass die Zeit sich nähert und bereits da ist, in der wir Engländer – so wir nur den Willen aufbringen – mit dem Spanier und dem Portugiesen den Gewinn in den Gebieten Amerikas und in anderen Gegenden, die bis jetzt unentdeckt sind, teilen.
Und wenn wir in uns den Wunsch verspüren, die Ehre unseres Landes zu befördern, ein Wunsch, der in jedem aufrechten Mann sein sollte, so hätten wir sicherlich nicht die ganze Zeit über die Inbesitznahme der Länder verzögert, die nach Recht und Billigkeit uns gehören …
Neben dem Norden Amerikas, wo man nach der Nordwestpassage suchte, rückte in den 1560er-Jahren der karibische Raum in den Mittelpunkt des englischen Interesses. Dort betrieb John Hawkins (1543 – 1595), finanziell unterstützt von Kaufleuten und später auch von der Krone, ab 1562 illegalen Handel mit Sklaven. Aufgrund des Erfolgs kam man in England zu der Auffassung, dass sich weitere Unternehmungen lohnen müssten. Hawkins’ dritte Reise zeigte jedoch, dass diese Annahme unberechtigt war. Nach Raubzügen entlang der Küste musste er sich im September 1568 den Spaniern geschlagen geben. Allerdings konnten Hawkins und sein Vetter Francis Drake (ca. 1540 – 1596) entkommen. In der Folgezeit sollte Drake mit seinen Husarenstücken wie u.a. der Einnahme der Städte Nombre de Dios auf der Landenge von Panama 1572 oder der Plünderung Valparaísos auf seiner Weltfahrt 1578 zum bekanntesten Freibeuter seiner Zeit werden. Ab 1584 befand sich Spanien auch offiziell im Krieg gegen England, das die Bestrafung Drakes abgelehnt hatte. In diesem Krieg plünderten und brandschatzten die Engländer selbst das stark befestigte Cartagena de Indias, den Stolz der Spanier. Der spanische Gegenschlag, die Invasion Englands mit der Armada, scheiterte 1588. Doch auch die größte und vorerst letzte Operation der Engländer, die 1595 mit einer Flotte unter Hawkins und Drake das spanische Imperium angriffen, wurde zu einem Fehlschlag, da die Spanier ihr Verteidigungssystem verstärkt hatten.
Ungefähr zur selben Zeit bereitete man in England eine Siedlungskolonisation in Amerika vor. Der wichtigste Akteur war Walter Raleigh (ca. 1552 – 1618), der auf Gewinne mit tropischen Erzeugnissen spekulierte. Raleighs erste Versuche im heutigen Virginia und North Carolina scheiterten schon nach wenigen Jahren. Später suchte er in der Karibik und im nördlichen Südamerika nach dem sagenhaften Goldland. Als sich nach dem Tod von Königin Elisabeth die englische Spanienpolitik wandelte, wurde Raleigh des Hochverrats angeklagt und nach einer erneuten Raubfahrt 1618 hingerichtet. Zuvor war es jedoch im abgelegenen Norden Amerikas ab 1607 in Jamestown, Virginia, zu einer ersten erfolgreichen englischen Ansiedlung gekommen. Dort folgten die Engländer lange dem spanischen Vorbild und versuchten die Region zu einem protestantischen Mexiko zu machen. 1620 landeten die „Pilgerväter“ in Neu England.
2. „Kein Frieden jenseits der Linie“
Amerika als res nullius
Um die Wende vom 16. und 17. Jahrhundert hatte sich damit ein Gegensatz zwischen Spanien und England verfestigt, der in der Folgezeit prägend bleiben sollte. Dieser Gegensatz basierte letztlich auf der Nichtanerkennung des iberischen Alleinherrschaftsanspruchs durch die englische Krone. Auch in diesem Zusammenhang blieb die Verflechtung mit dem spanischen Vorbild, wenn auch als Antithese, offensichtlich, denn britische und kreolische Autoren betonten, dass es sich in Amerika um eine res nullius handelte, die im Besitz der gesamten Menschheit gewesen sei. Die Legitimität von Herrschaft basierte demnach auf der effektiven Inbesitznahme und Inwertsetzung durch Siedler. Natürlich wollte man damit den spanischen, vom Papst bestätigten Anspruch unterlaufen. Das gelang jedoch bis ins 18. Jahrhundert hinein nur ansatzweise, wie etwa die Auseinandersetzungen in umstrittenen Grenzgebieten wie etwa Britisch-Honduras oder Carolina zeigen sollten. Die Einwohner dieser Gebiete waren eben nicht eindeutig der einen oder dem andern Herrschaft zuzurechnen. Sie blieben in einem Zwischenraum der Staatenlosigkeit. Letztlich blieb die englische Rechtsposition umstritten und musste sich in diskursiver Auseinandersetzung mit den Spaniern immer wieder neu beweisen.
Die Engländer folgten mit ihrem Vorgehen dem Beispiel der Franzosen, deren Aktivitäten schon früh zu heftigen Auseinandersetzungen mit Portugal und Spanien geführt hatten. Im spanisch-französischen Friedensschluss von Cateau-Cambrésis (1559) soll daher in einer mündlichen Übereinkunft festgelegt worden sein, dass der Friede jenseits des ersten Meridians im Westen keine Gültigkeit habe. Die Engländer folgten diesem Prinzip, das angeblich Francis Drake auf die griffige Formel „ no peace beyond the line“ , „kein Frieden jenseits der Linie“, brachte, einer Linie, die später als Freundschaftsliniebekannt werden sollte. Wenn auch nicht de iure, so stellte die Neue Welt damit doch de facto einen eigenen rechtlosen Raum dar, in dem weitergekämpft, geplündert und gekapert wurde, auch wenn in Europa noch oder längst wieder Frieden herrschte.
Читать дальше