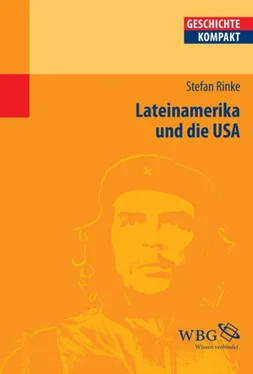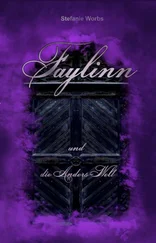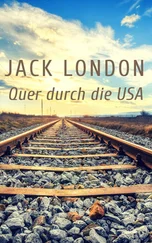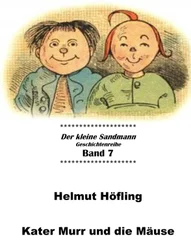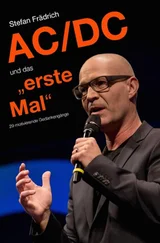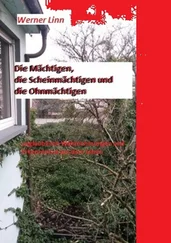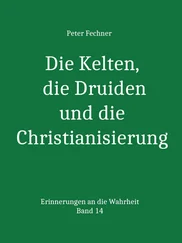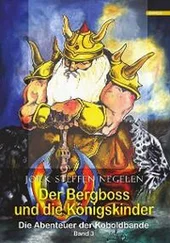Was sich in den drastischen Worten von Chávez Bahn brach, war eine Mischung aus Wut und Frustration, die für die Haltung vieler Lateinamerikaner gegenüber dem großen Nachbarn im Norden spätestens seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts lange Zeit bezeichnend war. Sie spiegelt die sich stetig vertiefende ungleiche Machtverteilung und die Erfahrungen der Unterlegenheit gegenüber dem „Koloss des Nordens“ wider. Allerdings ist dies nur eine Seite der Medaille, denn die Wahrnehmung der anderen Amerikaner im Norden war stets mit Bewunderung und Hochachtung gepaart. Wenn auch oft nur zähneknirschend, so wurden die USA doch als Vorbild angesehen.
Außerdem war Lateinamerika nie nur passives Objekt in den interamerikanischen Nord-Süd-Beziehungen, sondern gestaltete diese aktiv mit. Dies ist bislang noch zu wenig bekannt, denn lange Zeit dominierte eine Wissenschaftstradition, die sich mit dem Thema aus Sicht der Vereinigten Staaten beschäftigte – zunächst affirmativ, später kritisch. In der Tat war die Lateinamerikapolitik der USA schon in der Entstehungszeit der Lateinamerikastudien als neuer Forschungsrichtung um den Ersten Weltkrieg ein sehr wichtiges Thema der Geschichtsschreibung. Ihr kam seitdem erhebliche tagespolitische Relevanz zu als Argument im Kampf um die öffentliche Meinung. Erstaunlich ist, dass es bisher noch kaum Überblicksdarstellungen zu diesem Gegenstand aus der lateinamerikanischen Perspektive gibt. Wenn aus dieser Sicht wissenschaftlich dazu gearbeitet wurde, dann mit Blick auf bilaterale Beziehungen. In diesem Buch wird daher die Perspektive der Region Lateinamerika im Mittelpunkt stehen, ohne die US-amerikanischen Motive zu vernachlässigen, denn das Gesamtbild lässt sich nur erkennen, wenn man die Wechselbeziehung im Blick behält. Dabei ist zu bedenken, dass der Begriff „Lateinamerika“ eine Einheit impliziert, die der Realität nur sehr eingeschränkt entspricht. Die seit Mitte des 19. Jahrhunderts so bezeichnete Region zeichnet sich ja gerade durch ihre Vielfalt und ihre enormen internen Unterschiede aus.
Eine zentrale Frage, die vor dem Hintergrund der Diskussionen um den Begriff des Empire seit einigen Jahren wieder an Relevanz gewonnen hat, ist die nach dem Charakter der Beziehungen zwischen den USA und Lateinamerika, oder kurz: Gab und gibt es noch immer einen US-amerikanischen Imperialismus in Lateinamerika? Die Antwort auf diese Frage hängt von der Definition ab. In der klassischen US-amerikanischen Historiographie bis in die 1950er-Jahre wurde sie verneint, wenngleich die so genannten Realisten einräumten, dass um 1898 ein kurzes imperialistisches Zwischenspiel zu verzeichnen gewesen sei. Die Vereinigten Staaten hätten dann ihre Besitzungen wieder abgeben und der Imperialismus sei daher kein Charakteristikum der nationalen Geschichte. Der zu dieser Zeit sehr bekannte Historiker Samuel Flagg Bemis nutzte zwar den Begriff, schränkte dessen Gültigkeit aber ein und sprach in Hinblick auf die Beziehungen zu Lateinamerika von einem „beschützendem“ Imperialismus ( protective imperialism ). Indem er die US-amerikanische Variante vom aus seiner Sicht „selbstsüchtigen“ europäischen Imperialismus unterschied, versuchte er, diese zu rechtfertigen. Dahinter stand die Überzeugung, dass sich die Interventionen der USA in Lateinamerika letztlich positiv auswirkten, weil sie die Modernisierung vorantrieben.
Unter dem Eindruck des Vietnamkriegs und der Kubanischen Revolution änderten sich die Interpretationen der Lateinamerikapolitik Washingtons seit den 1960er-Jahren grundlegend. In den einflussreichen Werken von Historikern wie William A. Williams, die auch in Deutschland – etwa von Hans-Ulrich Wehler – stark rezipiert wurden, galten die Vereinigten Staaten aufgrund ihrer Politik gegenüber Lateinamerika eindeutig als imperialistische Macht. Nach dieser Sichtweise handelte es sich um einen (Sozial-)Imperialismus, der sich aus wirtschaftlichen Motiven speiste und von den sich zuspitzenden sozialen Problemen im Innern der USA ablenken sollte. Die Interpretation speiste ihre Argumente nicht zuletzt auch aus der Kritik in Lateinamerika selbst, die sich im Zeichen des Anti-Imperialismus seit den 1920er-Jahren und der Dependenztheorie seit den 1960ern zu einer regelrechten Bewegung ausgewachsen hatte. Bis heute ist anti-imperialistische Kritik sowohl im Norden wie im Süden der Amerikas einflussreich. Durch die US-amerikanischen Reaktionen auf die Terroranschläge vom 11. September 2001, insbesondere die so genannte Bush-Doktrin, hat sie neue Nahrung bekommen, auch wenn Lateinamerika darin nur eine Nebenrolle zukommt.
In der Tat sind die Sonderrolle der Vereinigten Staaten im amerikanischen Doppelkontinent und ihre machtpolitische Dominanz seit dem 19. Jahrhundert nicht zu verleugnen. Die Hegemonie der USA lässt sich an der Vielzahl von Interventionen oder an der wirtschaftlichen Abhängigkeit ablesen, unter denen die lateinamerikanischen Staaten jahrzehntelang gelitten haben. Der Begriff Imperialismus, zumal in seiner informellen Variante, trifft daher für einzelne Phasen der Geschichte der US-amerikanischen Lateinamerikapolitik durchaus zu. Doch trotz der durchgängigen Machtasymmetrie unterlagen die interamerikanischen Beziehungen einem erheblichen historischen Wandel.
Außerdem hat die neueste von postkolonialen Theorien beeinflusste Geschichtsschreibung seit den 1990er-Jahren die kulturelle Dimension des Beziehungsgeflechts in den Amerikas betont. Vor dem Hintergrund zunehmender Globalisierungsprozesse hat man sich innovativen Fragestellungen geöffnet und den Blick für transnationale Interaktionen und Verflechtungen in Bereichen wie Wirtschaft, Kultur oder Telekommunikation geschärft. Dabei geht es um die Dynamik von Identitäten vor dem Hintergrund eines Begriffes von Kultur, der diese als Geflecht von Symbolen und als ständig sich wandelnden Prozess versteht. Bilder und Repräsentationen vom Anderen und vom Selbst spielen dabei eine zentrale Rolle. So wie sich der Westen nach Edward Said, dem Theoretiker des Orientalismus, sein orientalisches Anderes schuf, so schufen sich die Vereinigten Staaten mit Lateinamerika ihr Anderes. Angesichts der durch diese Erkenntnis ausgelösten Debatten spricht man in den US-amerikanischen Kulturwissenschaften jüngst gar von einem „Hemispheric Turn“.
Allerdings – und das blieb bislang in der Regel unbeachtet – gilt diese Aussage auch umgekehrt. Die Beziehungen zwischen den Amerikas kann man nicht als Einbahnstraße verstehen. Die einfachen Dichotomien von wohlwollenden Modernisierern und traditionalen Empfängern oder von imperialistischen Eroberern und bedauernswerten Opfern greifen für die Charakterisierung des Verhältnisses von den USA und Lateinamerika zu kurz. Vielmehr haben Lateinamerikaner die Konflikte und Begegnungen mit den großen Nachbarn auf ihre eigene Art erlebt, gedeutet und beeinflusst. Die Auseinandersetzung mit dem anderen Amerikaner spielte sich auf unterschiedlichen Ebenen ab. Dabei änderte sich das Raumverständnis beständig. In der Unabhängigkeitsepoche positionierte sich Amerika als eigene Sphäre im Weltkontext neu und löste sich von der kolonialen europäischen Vorstellung der „Neuen Welt“, in der alles möglich und erlaubt war. Doch auch innerhalb der Amerikas waren die Raumvorstellungen beständig im Fluss, etwa wenn die Staatsgrenzen zwischen Nord und Süd verschoben oder durch Migrationsprozesse monolithische Nationsvorstellungen unterwandert wurden. Durch diese permanenten Bewegungen ergaben sich vielfältige Kontaktzonen zwischen den vermeintlich fest gefügten Räumen von Anglo- und Lateinamerika, die sich vor dem Hintergrund der Einbindung in den globalen Kontext dynamisch veränderten. Diese Verflechtungsprozesse zwischen Räumen interessieren im Folgenden besonders, denn die Geschichte der interamerikanischen Beziehungen ist eine geteilte Geschichte, in der und durch die sich nicht nur Latinos , sondern auch Anglos verändert haben.
Читать дальше