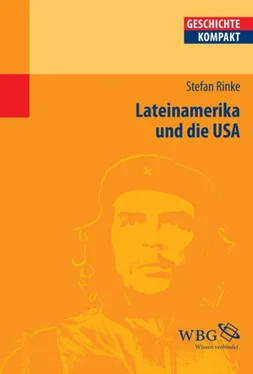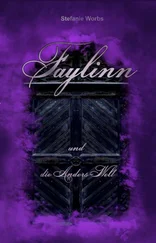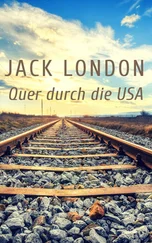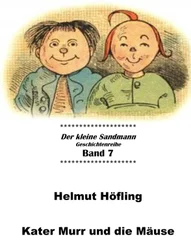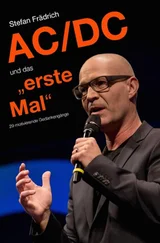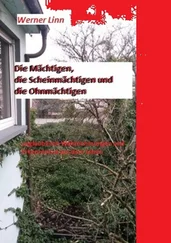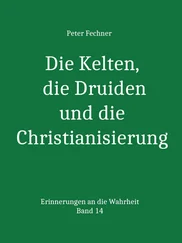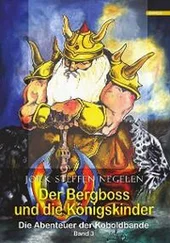In diesem Buch wird dem Wandel der Raumvorstellungen durch die Gliederung Rechnung getragen. Der Schwerpunkt der Darstellung liegt auf den Entwicklungen seit dem 19. Jahrhundert, wobei chronologische Einschnitte die Unterteilung in Hauptkapitel vorgeben. Die Kapitelstruktur berücksichtigt die Vielfalt der Ebenen und bezieht auch die kulturelle Dimension mit ein. Neben der Rolle von staatlichen wird auch die von nicht-staatlichen Akteuren in die Darstellung mit einfließen.
Wie die „Neue Welt“ als europäische Raumvorstellung die Kolonialzeit prägte, wie sich hier aber auch schon früh durch konfessionelle und machtpolitische Gegensätze Räume herausentwickelten, deren Interaktionen sich verdichteten, ist das Thema des ersten Kapitels. Kapitel II zeigt die Wege zur Unabhängigkeit, um danach die interamerikanischen Beziehungen und Wahrnehmungen im Schatten der Kriege darzustellen. In dieser Zeit wurde ein dezidierter Gegensatz zwischen Amerika und Europa konstruiert, der auch die folgende Phase bis Mitte des 19. Jahrhunderts noch prägen sollte. Dieser Antagonismus gipfelte in der Vorstellung von einer eigenen „westlichen Hemisphäre“, die die interamerikanischen Beziehungen im Kontext der europäischen Bedrohung beeinflusste. Die vorübergehende Abwehr dieser Bedrohung, so die These von Kapitel III, schuf die Voraussetzung für den räumlichen Expansionismus der Vereinigten Staaten, durch den sich die Beziehungen vor allem zu den Nachbarn in Mexiko und in der Karibik radikal wandeln sollten. Worauf das panamerikanische Raumkonstrukt gegen Ende des 19. Jahrhunderts basierte und inwiefern es integrative Wirkung entfalten konnte, fragt Kapitel IV. Nur scheinbar paradoxerweise, so argumentiert Kapitel V, liefen die panamerikanischen Bemühungen teils parallel zu den imperialistischen Bestrebungen der Vereinigten Staaten, die im Krieg gegen Spanien von 1898 / 99 und im Interventionismus im karibischen Raum gipfelten. Das informelle Imperium der USA blieb jedoch nicht unwidersprochen. Insbesondere durch die mexikanische Revolution ab 1910, die einen der Schwerpunkte von Kapitel VI bildet, kam es in die Kritik, wenngleich der Erste Weltkrieg die Stellung Washingtons im Süden dann wieder festigte. Allerdings ging auch der lateinamerikanische Nationalismus gestärkt aus diesem Weltkonflikt hervor, wie Kapitel VII verdeutlicht. In Kapitel VIII stehen erneut hemisphärische Solidaritätsbestrebungen im Mittelpunkt, die auf den zweiten großen Gewaltausbruch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zurückzuführen waren. Kapitel IX und X begeben sich in die Zeit des Kalten Kriegs, in der Lateinamerika in der US-amerikanischen Sicht kaum mehr als eine Peripherie im Kampf gegen den Kommunismus war, in der jedoch auch das Gegenkonzept eines unabhängigen Raums, einer Dritten Welt, im Süden entstand. Das Spannungsfeld zwischen den sich verdichtenden transamerikanischen Verflechtungen und den zeitgleichen Abschottungsbemühungen andererseits ist Thema des Schlusskapitels XI.
Mein Dank gilt der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die Förderung im Rahmen des Internationalen Graduiertenkollegs 1571 „Zwischen Räumen“ sowie des Sonderforschungsbereichs 700 „Governance in Räumen begrenzter Staatlichkeit“. Beide Forschungskontexte lieferten wichtige Anregungen zur Arbeit an diesem Buch. Den Kolleginnen und Kollegen dieser Projekte und insbesondere am Lateinamerika-Institut und im Netzwerk Area Histories sei für wichtige Kommentare, Diskussionen und Kritiken gedankt.
Meiner Frau Silke, die mich auf meinen Reisen zwischen Räumen in den Amerikas begleitet hat und hoffentlich bald wieder begleiten wird, widme ich dieses Buch.
Berlin, im Juni 2011
Stefan Rinke
I. Neue Welten: Die Kolonialzeit bis 1760
| 1492 |
Kolumbus landet auf Guanahani |
| 1493 |
Päpstliches Edikt Inter Caetera |
| 1494 |
Vertrag von Tordesillas |
| 1497 |
John Cabot an der Küste Nordamerikas |
| 1507 |
Erfindung des Namens Amerika |
| 1562 |
Erste Reise von John Hawkins |
| 1577 – 1580 |
Weltumsegelung von Francis Drake |
| 1607 |
Gründung von Jamestown, Virginia |
| 1620 |
„Pilgerväter“ landen in Plymouth |
| 1655 |
Englische Eroberung Jamaikas |
| 1701 – 1713 |
Spanischer Erbfolgekrieg |
| 1703 |
Englisch-Portugiesischer Handelsvertrag (Methuen-Vertrag) |
| 1739 – 1748 |
Krieg von Jenkins’ Ohr |
Die Geschichte der Beziehungen zwischen Nord und Süd in dem Erdteil, der seit rund 500 Jahren Amerika genannt wird, beginnt nicht erst mit der Ankunft der Europäer 1492. Der Doppelkontinent war vielmehr schon Jahrtausenden zuvor geprägt von Wanderungen. Es gilt mittlerweile als gesichert, dass die ersten Menschen in die für sie neue Welt einwanderten. Zumindest ein Teil dieser frühen Migranten kam über eine eiszeitliche Landbrücke in der Beringsee aus Sibirien über Alaska nach Nordamerika und breitete sich nach Süden aus. In der Folgezeit bildete sich eine außerordentliche Vielfalt an Kulturen, die transregionale Kontakte und Beziehungen aufbauten, was insbesondere auch für den mesoamerikanischen Raum und den daran angrenzenden Südwesten der heutigen USA galt. Angepasst an die verschiedenartigen Umweltbedingungen prägten Großreiche, Stammesgesellschaften und Jäger- und Sammlergruppen unterschiedliche Räume, die Seite an Seite existierten und teils eng miteinander verflochten waren.
Vielfalt der Räume
Mit der Ankunft der Europäer änderte sich die Grundkonstellation, denn die Eroberer verdrängten, töteten oder unterdrückten viele der höchst unterschiedlichen Ethnien, denen Kolumbus (ca. 1451 – 1506) die Kollektivbezeichnung indios gegeben hatte. Die Kolonialherrschaft, die in den folgenden Jahrhunderten entstand, war jedoch keineswegs einheitlich, denn die neu entdeckten Räume wiesen enorme Unterschiede auf. So gab es, wie die Europäer schnell feststellten, nicht die eine „Neue Welt“, sondern viele Räume, in denen unterschiedliche Völker lebten und die mit unterschiedlichen Methoden besiedelt und ausgebeutet werden mussten. Dabei sahen die Spanier sich bald mächtigen Konkurrenten gegenüber, die ihnen den Rang streitig machten. So überquerten mit den Eroberern und Siedlern auch europäische Rivalitäten und Konflikte den Atlantik, die man kennen muss, um die frühe Geschichte der Verflechtungen innerhalb der Amerikas zu verstehen.
Bereits bei Kolumbus waren die Entdeckungen der neuen Länder mit der formellen Inbesitznahme einhergegangen, die notariell verbrieft wurde. Die Spanier bemühten sich sogleich erfolgreich um eine diplomatische Absicherung ihres Entdeckungsmonopols im Westen. Papst Alexander VI. (1431 – 1503) bestätigte der spanischen Krone die neuen Besitzungen mit der Bulle Inter Cetera von 1493 und rechtfertigte dies mit dem Missionsauftrag. Anderen europäischen Mächten untersagte der Papst den Zutritt zu den neuen Gebieten ausdrücklich, ja er drohte ihnen bei Zuwiderhandeln sogar mit der Exkommunikation. Diese päpstliche Legitimierung war wichtig im Konkurrenzkampf mit Portugal. Sie war außerdem eine damals durchaus übliche, den Rechtsauffassungen im Umgang mit Heiden entsprechende Maßnahme. Das Land der Heiden war demnach Missionsgebiet und konnten einem christlichen Herrscher zur – auch gewaltsamen – Mission zugewiesen werden. Eroberung und Mission gingen von nun an Hand in Hand, und Geistliche sollten die spanischen Konquistadoren auf ihren Zügen begleiten.
Ebenso wichtig wie die religiöse war den Spaniern die machtpolitische Absicherung der Expansion. Daher kam es am 7. Juni 1494 zum Vertrag von Tordesillas, in dem sich die beiden iberischen Kronen auf den 46. Grad westlicher Länge als Trennungslinie der Expansionsgebiete einigten. Alle Gebiete westlich dieser Linie sollten Spanien gehören, die östlichen hingegen Portugal. Mit diesem Vertrag hatte man eine Raumordnung geschaffen und die neuen Länder im Westen in Interessensphären der Entdecker aufgeteilt, die exklusiv zum Herrschaftsgebiet der jeweiligen Krone als eigenständige Königreiche zählten. Ohne es zu wissen, bekam die portugiesische Krone damit Ansprüche auf Ostbrasilien zugesprochen. Die Spanier wussten zu diesem Zeitpunkt ebenso wenig, dass ihnen ein riesiger Kontinent zufiel, war man doch noch davon überzeugt, den westlichen Seeweg nach Indien entdeckt zu haben.
Читать дальше