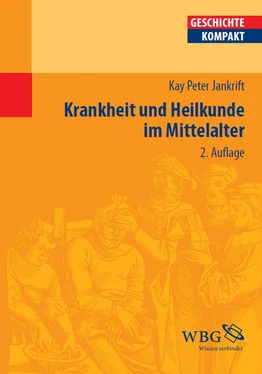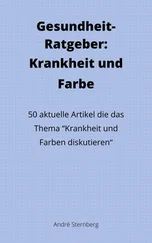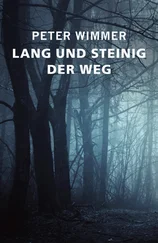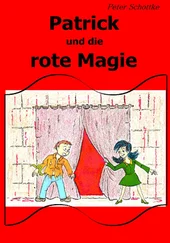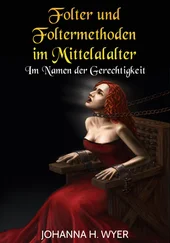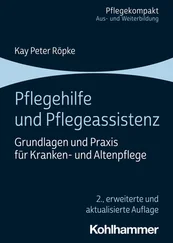Bildquellen
Neben solchen Realien geben auch zahlreiche Bildquellen einen Einblick in zeitgenössische Krankheitswahrnehmung. Die Darstellung von Heiligen bei der Krankenheilung zeigt auch die Patienten und deren Leid. Illustrationen der medizinischen Schriften stellten die Anwendung bestimmter Behandlungsmethoden visuell ebenso dar wie die Gestalt ärztlicher Instrumente. Der Bildbefund dient nicht zuletzt der Archäologie zur Identifizierung von Fundmaterial, das potenziell dem Besitz eines Heilkundigen zuzuordnen ist.
3. Wenn Knochen sprechen … Krankheit, Tod und archäologische Befunde
Archäologie
Im Rahmen archäologischer Grabungen geborgene Skelette bieten stets eine unentbehrliche Ergänzung für alle Untersuchungen zu Krankheits- und Todesursachen in der mittelalterlichen Gesellschaft. Besondere Bedeutung für medizinhistorische Studien im Allgemeinen und für seuchengeschichtliche im Besonderen kommt den so genannten osteoarchäologischen Befunden zu, die sich mit dem Knochenmaterial befassen. Die Knochen erzählen dabei eine Geschichte, wie sie in solcher Exaktheit im Spiegel der Schriftzeugnisse niemals zutage tritt. Dies liegt vor allem daran, dass in den zeittypischen Quellen fast nur die Mächtigen zu Wort kommen, der Großteil der mittelalterlichen Bevölkerung jedoch nie ein Sprachrohr findet. Die Skelette erlauben mithin eine bedeutende Vervollständigung des Gesamtbildes gesundheitlicher Verhältnisse einer vergangenen Zeit.
Paläopathologie
So liefert das Skelettmaterial neben allgemeinen Informationen zu Alter und Geschlecht vor allem reichhaltige Hinweise auf die individuellen Lebensumstände und gesundheitlichen Belastungen. Die Untersuchung von rund 160 Skeletten eines karolingischen Gräberfelds in Soest beispielsweise lassen ein gehäuftes Auftreten von Entzündungen des Zahnhalteapparates mit Verlusten von Zähnen schon zu Lebzeiten, so genannten Intravitalverlusten, erkennen. Verursacht wurden diese vor allem durch das recht grob gemahlene Getreide. Der schützende Zahnschmelz wurde dadurch schnell angegriffen. Die besonders stark beanspruchten Malzähne, die Molaren, weisen einen deutlich höheren Abrieb auf, als dies gemeinhin heute üblich ist. Schritt dieser zu weit voran, kam es zur schmerzhaften Entzündung der Zahnwurzel, die mit dem Verlust des Zahns endete. An den Zähnen der karolingischen Skelette lässt sich jedoch weit weniger Karies feststellen als an denen heutiger Zeitgenossen. Da man hierzulande noch keinen Rohrzucker kannte, griff man zum Süßen der Speisen auf Honig zurück. Dieser jedoch stand keinesfalls täglich und für jeden auf dem mittelalterlichen Speiseplan.
Zugleich lassen sich etwa an Skeletten von hochmittelalterlichen dänischen Klösterfriedhöfen deutlich Spuren von Wundbehandlungen erkennen. Gebrochene Extremitäten heilten durch die Behandlungen von Mönchsärzten aus und selbst schwer wiegende Schädelverletzungen konnten den paläopathologischen Befunden zufolge erfolgreich kuriert werden.
Grabungen auf den Friedhöfen von Leprosorien tragen dazu bei, nähere Erkenntnisse über die Insassenstruktur der Häuser, die pathologischen Zustände der Bestatteten sowie eventuell über besondere Formen der Sepulkralkultur und die Nutzung des Begräbnisplatzes zu gewinnen. Im Gegensatz zur Pest und zu anderen rasch tötenden Infektionskrankheiten, die sich am Skelett nicht nachweisen lassen, hinterlässt die Lepra in einem fortgeschritteneren Krankheitsstadium deutliche Spuren. Die Auswertung des osteoarchäologischen Materials liefert vielfältige Aussagen darüber, bei wie vielen Individuen sich charakteristische Veränderungen nachweisen lassen – so das nach seinem Entdecker benannte Møller-Christensen-Syndrom. Sie gewährt ferner unter einigen Vorbehalten – z. B. kann sich ein Mensch erst nach seinem Eintritt ins Leprosenhaus mit der Lepra infiziert haben – beschränkte Einblicke in die Zuverlässigkeit mittelalterlicher Diagnosen und zeitspezifischer Krankheitswahrnehmungen. Im Bereich der Bundesrepublik sind solche einschlägigen osteoarchäologischen Untersuchungen im Allgemeinen und von Leprosenfriedhöfen im Besonderen bislang eher selten. Systematisch ausgewertet wurden bisher beispielsweise die rund 450 Skelette, die auf dem Friedhof des Aachener Melatenhauses in mehreren Grabungskampagnen geborgen wurden.
II. Die Grundlagen der mittelalterlichen Medizin
ca. 460 – 360 v. Chr.
Hippokrates von Kos
23 / 24 n. Chr.–79. n. Chr.
Plinius der Ältere (Caius Plinius Secundus)
1. Jh. n. Chr.
Aulus Cornelius Celsus
1. Jh. n. Chr.
Dioskurides
129 – 199 / 200 / 216 n. Chr.
Galen
5. – 7. Jh.
Breite Rezeption griechischer Medizinaltraktate in Klöstern
um 490 – 583
Cassiodor
560 – 636
Isidor von Sevilla
um 795
Lorscher Arzneibuch
ca. 850 – 950
Isaak Judaeus
808 – 873
Ḥunain ibn Isḥāq
865 – 925
Rhazes. Abū Bakr Muḥammad ibn Zakarīyā, gen. ar-Rāzī
Mitte des 10. Jh.
Haly Abbās. ʿAlī ibn al-ʿAbbās al-Mağūsī
980 – 1037
Avicenna. Abū ʿAlī al-Ḥusain ibn ʿAbd Allāh ibn Sīnā al Qānūnī
† ca. 1010
Abulkasis. Abūʿl-Qāsim Halāf ibn al ʿAbbās az-Zaḥrāwī
11. Jh.
Beginn der Übersetzung griechisch-arabischen Medizinalschrifttums
um 1010–ca. 1087
Constantinus Africanus
ca. 1114 – 1187
Gerhard von Cremona
1126 – 10. 12. 1198
Averroes. Abūʿl Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rušd
1. Das „Haus der Heilkunde“
a) Corpus Hippocraticum und die Lehren Galens
Hippokrates
Die Lehren der griechisch-römischen Medizin bildeten die theoretische Grundlage der mittelalterlichen Heilkunde und Gesundheitspflege. Am Anfang dieser langen Tradition stand der sagenumwobene Hippokrates von Kos. Nur wenig ist über das Leben jenes Mannes bekannt, der zum Inbegriff des idealen Arztes wurde. Soranos von Ephesos, sein in der zweiten Hälfte des ersten nachchristlichen Jahrhunderts tätiger Biograf, bestimmte das Geburtsjahr des Hippokrates auf 460 / 459 vor Christus. Der weiteren Überlieferung zufolge soll er im 4. Jahrhundert vor Christus als hochgerühmter Heilkundiger gewirkt haben. In Ableitung naturphilosophischer Konzeptionen von den vier Elementen (Erde, Luft, Wasser, Feuer) schuf Hippokrates eine im Rahmen des zeitgenössischen Verständnisses rationale Theorie der Medizin. Ihren Kern bildete die bis über das Mittelalter hinaus akzeptierte so genannte Säftelehre. Gemäß dieser werden die Elemente zu den vier Körpersäften Blut, Schleim, gelbe Galle und schwarze Galle gekocht. Während die ersten drei unschwer zu identifizieren sind, ist heute unklar, was sich hinter Hippokrates’ Bezeichnung der „schwarzen“ Galle verbirgt. Sie lässt sich nach modernen medizinischen Definitionen mit keiner der im menschlichen Körper tatsächlich vorkommenden Substanzen in Verbindung bringen. Die vier Körpersäfte der hippokratischen Lehre sind zugleich mit den natürlichen Eigenschaften warm, kalt, trocken und feucht verbunden. Das Blut beispielsweise ist nach diesem Schema warm und feucht, die schwarze Galle kalt und trocken. Der Umfang von Hippokrates’ literarischem Werk lässt sich nicht genau bestimmen. Über 60 medizinische Schriften versammelt das so genannte hippokratische Corpus unter seinem Namen, doch ist nach wie vor ungeklärt, wie viele von diesen tatsächlich von dem viel gerühmten Arzt selbst verfasst wurden. Für keine einzige der Abhandlungen ließ sich bislang die Frage nach der Autorschaft des Hippokrates zweifelsfrei klären, doch wurde der griechische Arzt mit dieser Zuschreibung gewissermaßen zum Begründer der Medizin und ärztlichen Praxis.
Читать дальше