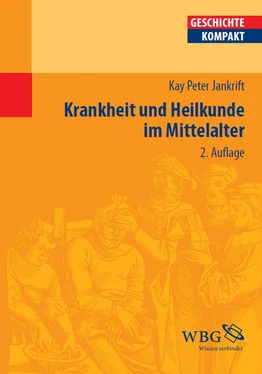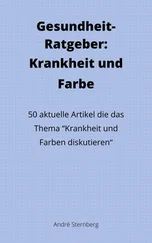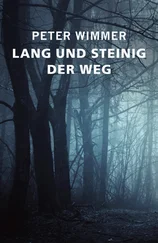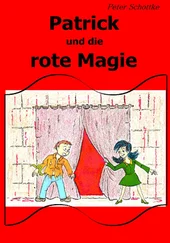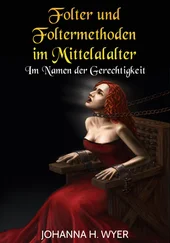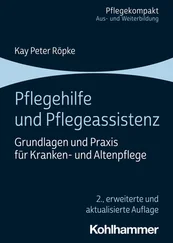b) Das Idealbild eines benediktinischen Klosters: Der Klosterplan von Sankt Gallen
Kloster nach normativen Vorgaben
Die praktische Umsetzung all dieser auf die Fürsorge bezogenen Vorschriften verlangte mehr als nur religiöse Überzeugung und guten Willen. Neben baulichen Voraussetzungen, die eine Aufnahme von Gästen unterschiedlicher Art und eine separate Betreuung erkrankter Mitbrüder ermöglichten, bedurfte es pflegerisch erfahrener und arzneimittelkundiger Mitglieder der Gemeinschaft. Wie diesen Forderungen in den ersten benediktinischen Klöstern im Alltag nachgekommen werden konnte, lässt sich in Ermangelung entsprechender Zeugnisse nicht beantworten. Erst im Zusammenhang mit der Unterstützung Karls des Großen für die Reformbestrebungen des Benedikt von Aniane (um 750 – 821), die eine weitere Verweltlichung des Benediktinerordens abzuwenden versuchten, wird sichtbar, wie sich die benediktinischen Klöster in ihrer baulichen Anlage nach den normativen Vorgaben ausrichteten. Den Idealplan eines benediktinischen Klosters zeigt der um das Jahr 820 im Kloster der Bodenseeinsel Reichenau entstandene so genannte Klosterplan von Sankt Gallen. Am augenfälligsten erscheint zunächst die große Klosterkirche, die im Westen von zwei runden Türmen flankiert wird. Im Westen befand sich der Vorratskeller, im Südwesten die Küche. Im direkten Anschluss an den Ort der Speisenzubereitung lag das so genannte Refektorium, der Speisesaal. Vor dem Betreten des Refektoriums reinigten die Brüder ihre Hände im nahen Brunnenhaus. Östlich des Kreuzgangs fand sich das Dormitorium, der Schlafsaal der Brüder. An dessen südöstlicher Ecke war ein gemeinschaftlicher Abort eingerichtet, der über eine natürliche Wasserspülung verfügte. Der Schlafsaal lag im Obergeschoss des Gebäudes. Durch diese Aufteilung sollte vermieden werden, dass sich in dem Raum zu viel Feuchtigkeit aus dem Boden verbreitete, die der Gesundheit abträglich war. Zugleich wurde die Möglichkeit der Luftzufuhr im Dormitorium verbessert. Im Untergeschoss des Schlafsaales befanden sich häufig eine Sakristei und ein so genannter Kapitel-Saal, in dem bei den Zusammenkünften der Gemeinschaft zu festgelegten Zeiten die Regel zur Einprägsamkeit wieder und wieder verlesen wurde. All diese Räumlichkeiten bildeten den Kern der Klosteranlage, die Klausur, deren Betreten den Mitgliedern der Mönchsgemeinschaft vorbehalten war.
Um diesen Kernbereich herum gruppierten sich eine Anzahl weiterer Gebäude. Neben den Wirtschaftshäusern waren dies vor allem Hospitalanlagen im Osten und Westen. Der Sankt Gallener Plan erlaubt dabei eine Unterscheidung dreier in ihrem Zuschnitt unterschiedlicher Einrichtungen. Im Südwesten befand sich das so genannte Hospitale Pauperum, in dem Arme, Pilger und sonstige Bedürftige versorgt wurden. Im Nordwesten lag das den wohlhabenderen Gästen vorbehaltene Hospitium. Hier bezogen die zu Pferde Angekommenen Quartier. Der Besitz eines Reittiers setzt diese Gruppe der Gäste deutlich von den Mittellosen ab. Schließlich findet sich das entsprechend des 36. Kapitels der Benediktsregel den kranken Mitbrüdern vorbehaltene so genannte Infirmarium im Osten des Klausurbereichs. An das Infirmarium angeschlossen waren häufig eine eigens für die Kranken bestimmte Küche mit einem Speisesaal, eine eigene Kapelle sowie Bade- und Aderlasseinrichtungen. Daneben fanden sich eine Unterkunft für den Arzt und eine Apotheke. Die Lagebezeichnungen änderten sich entsprechend in die entgegengesetzte Richtung, wenn der Kreuzgang anders als im Sankt Gallener Klosterplan im Norden der Kirche angelegt war. In diesem Fall läge das Hospitale Pauperum also im Nordwesten. Mehr als die Hälfte aller mittelalterlichen europäischen Klöster folgte diesem durch die Benediktsregel vorgegebenen Anlageschema. Als Idealplan eines Klosters geht die Sankt Gallener Grundrisszeichnung jedoch über die grobe Anlagedarstellung hinaus. Sie zeigt im Detail Zimmer für reisende Mönche am nördlichen Seitenschiff und Unterkünfte für kranke Novizen im östlich gelegenen Noviziat. Ferner existierten bisweilen Unterbringungsmöglichkeiten für Schwerkranke in der Nähe des klösterlichen Kräutergartens im Nordosten, die auf dem Plan nicht dargestellt werden. Mitunter gab es auch ein eigenes Haus zur Versorgung kranker Laienbrüder im Westen einer benediktinischen Klosteranlage. In einiger Entfernung von den gemeinschaftlichen Einrichtungen befand sich ein Gebäude zur Beherbergung Leprakranker.
c) Hospitäler in mittelalterlichen Klosteranlagen
Infirmarium von Cluny
Es existieren heutzutage keine Klosterhospitäler aus der Entstehungszeit des Sankt Gallener Klosterplans mehr, die eine Umsetzung des Projekts als bauliche Überreste belegen. Erst Klosteranlagen aus späterer Zeit zeigen, in welcher Weise sich mittelalterliche Mönchsgemeinschaften um eine Verwirklichung solcher Idealvorstellungen bemühten. So bestand bereits in der ersten Baustufe des Klosters Cluny in Burgund zwischen 910 und 927 ein Infirmarium , das sich jedoch auf der Basis des spärlichen archäologischen Befundes kaum in seiner Größe fassen lässt. Das um 1040 entstandene so genannte Alte Infirmarium verfügte über vier Zimmer, in denen bis zu acht Bettstätten untergebracht werden konnten. Unter dem Abbatiat Hugos I. von Semur (1049 – 1109), des Taufpaten Kaiser Heinrichs IV., erfolgte um 1082 eine Erweiterung um 24 Betten. Die Bettenzahl erscheint als eine symbolische Anspielung auf die Zwölfzahl der Jünger Jesu. Unter dem neunten Abt von Cluny, Petrus Venerabilis (1122 – 1156), erfuhr das Infirmarium einen Ausbau auf 80 Betten und erreichte damit eine Größenordnung, die es nach Einschätzung des Medizinhistorikers Dieter Jetter in dieser Zeit zu einem der größten Spitäler des Abendlandes machte. Die Zisterzienser folgten im 12. Jahrhundert dem benediktinischen Vorbild. Auch in ihren Klöstern befanden sich Infimarienkomplexe, die in den Überresten der einstigen Anlagen – so im nördlich von Paris gelegenen Ourscamp – noch heute sichtbar sind. Und auch die Bettelorden der Franziskaner und Dominikaner, die sich zu Beginn des 13. Jahrhunderts allmählich entfalteten, integrierten Infirmarien in ihre Klöster.
Hospitalische Fürsorge war nach mittelalterlichen Vorstellungen jedoch selbst im Kloster nicht zu allen Zeiten ein reiner Akt der Selbstlosigkeit. Erfolgte in den frühen Mönchsgemeinschaften eine Versorgung der Bedürftigen aus dem uneingeschränkten Motiv christlicher Nächstenliebe heraus, so begann sich dieses Bild im Laufe der Jahrhunderte in erheblichem Maß zu relativieren. Seit die Cluniazenser um die Jahrtausendwende der Auffassung eines zwischen Himmel und Hölle angesiedelten Fegefeuers Vorschub leisteten, aus dessen Hitze die Seelen durch Gebet und gottgefälliges Handeln errettbar wurden, wandelte sich die Selbstlosigkeit zusehends in eine mehr oder weniger kalkulierte Jenseitsvorsorge.
d) Krankenversorgung im Kloster
Vergünstigungen für Kranke
Zuständig für die Versorgung der Kranken war der so genannte Infirmarius. Ihm oblag die Aufsicht über das Infirmarium , in welchem er gemäß den Anforderungen der Regel gottesfürchtig und eifrig dem Wohle seiner Patienten dienen sollte. Unterstützt wurde der als Infirmarius tätige Mönch bei der Bewältigung seiner vielfältigen Aufgaben durch einen Laienbruder ( famulus ). Die heilkundliche Betreuung der Kranken erfolgte auf der Grundlage der Diätetik. Ein rechtes Maß an Licht und Luft, Essen und Trinken, Bewegung und Ruhe, Schlafen und Wachen, Stoffwechsel sowie Gemütsbewegung sollten demzufolge das Gleichgewicht der Körpersäfte und damit die Gesundheit wiederherstellen. In diesen Zusammenhang gehört etwa, dass die Betten der Kranken regelmäßig aufgeschüttelt werden sollten. Insbesondere aber war die Zuteilung einer ausgewogenen und reichhaltigen Kost vorgesehen. Kranken Mönchen war der ansonsten verbotene Genuss von Fleisch gestattet. Dieses kam nach der Säftelehre einer Vermehrung des als heiß und feucht geltenden Blutes zugute. Auch Wein stand auf dem Speiseplan der Kranken. Bäder durften sie sich richten lassen, soviel es ihnen gut tat – ganz im Gegensatz zu den übrigen Mönchen, die sich nach Auffassung des heiligen Benedikt beim Baden zurückhalten sollten.
Читать дальше