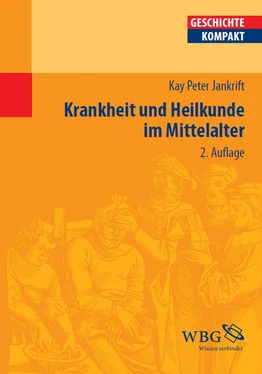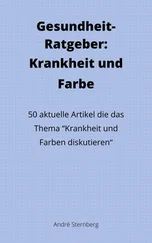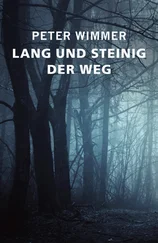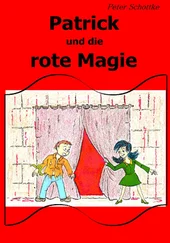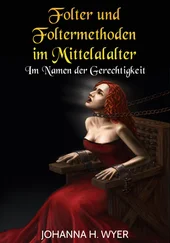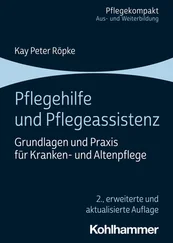Chirurgie
Bahnbrechend für die Entwicklung der abendländischen Chirurgie wirkte schließlich das Werk des um 1010 verstorbenen Abūʿl-Qāsim Halāf ibn al-ʿAbbās az-Zaḥrāwī (Abulkasis), der als Leibarzt zweier Kalifen im spanischen Cordoba gedient hatte. Von besonderem Interesse waren dabei neben den Anweisungen zur Durchführung der Eingriffe vor allem die detaillierten Beschreibungen und Darstellungen der chirurgischen Instrumente. In allen Teilgebieten der Medizin, so zeigen die ausgewählten herausragenden Beispiele deutlich, erfuhr die mittelalterliche Heilkunde im Abendland durch die Übersetzung der orientalischen Traktate die Vervollkommnung ihrer Grundlagen.
Die Schriften griechischer und römischer Autoren, insbesondere das hippokratische Corpus und die Lehren Galens, bilden die Grundlagen mittelalterlicher Gesundheitspflege und Heilkunde. Nach dem Zusammenbruch des Weströmischen Reiches gegen Ende des 5. Jahrhunderts als Kultur- und Bildungsträger werden die Kathedralschulen und Klöster zu Bewahrern wie Vermittlern des antiken Wissens. Neben der Klostermedizin existierte weiterhin eine empirisch motivierte Volksmedizin, zu deren festen Bestandteilen auch magische Praktiken zählten. Magische Einflüsse waren auch in Kreisen von Klerus und Herrschenden als Erklärungsmodell für Krankheit akzeptiert. Mit der Übernahme des griechisch-arabischsprachigen Medizinalschrifttums im 11. und 12. Jahrhundert fand das System der mittelalterlichen Heilkunde seinen theoretischen Abschluss.
III. Die Zeit der Klostermedizin
329 – 379
Basilios der Große
480 – 550
Benedikt von Nursia
um 820
Klosterplan von St. Gallen
Mitte 9. Jh.
Kräuterlehre des Abtes Walahfrid Strabo
1098 – 1179
Hildegard von Bingen
1130
Die Synode von Clermont untersagt Geistlichen das Studium der Medizin
um 1132
Errichtung des Großen Infirmariums in Cluny unter Abt Petrus Venerabilis
1150 – 1160
Entstehung der heil- und naturkundlichen Werke Physica und Causae et curae Hildegards von Bingen
1163
Das Konzil von Tours untersagt Klerikern erneut die Ausübung der Heilkunst
1215
Das Vierte Laterankonzil verbietet Klerikern endgültig die Ausübung der Chirurgie
1. Stätten von Heil und Heilung
a) Die Stellung der Kranken in den Ordensregeln
Heil von Seele und Körper
Die Klöster des frühen Mittelalters waren als Bewahrer des antiken Heilwissens nicht allein Zentren der Gelehrtenkultur. Sie waren zugleich Orte, an denen das Gebot gegenüber Kranken, Armen und Fremden christliche Nächstenliebe zu üben selbstverständlich zum Alltag gehörte. Die Klöster verstanden sich im Einklang mit der Regel des heiligen Benedikt zugleich als Stätten des Heils wie der Heilung. Sie sorgten sich um die Seele, die cura animae, ebenso wie um den Körper, die cura corporis. Leitend wirkten dabei die wegweisenden Worte im 25. Kapitel des Matthäus-Evangeliums: „Ich war nackt, und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr habt mich besucht. […] Ich war hungrig, und ihr habt mich gespeist.“
Augustinusregel
Schon Augustinus (354 – 430), der Bischof von Hippo, forderte in seiner späterhin ebenfalls weite Verbreitung erfahrenden und zugleich ersten Ordensregel des Abendlandes eine Versorgung Kranker wie Bedürftiger. In jeder Gemeinschaft, die den Weisungen des Augustinus folgte, sollte für das Wohlergehen der Kranken ein Mitbruder im Sinne der Caritas Sorge tragen. Viele der zahlreichen hospitalischen Bruderschaften, die noch im 12. Jahrhundert ohne feste Regel lebten und somit der kanonischen Aufsicht entzogen waren, nahmen in Ausführung entsprechender Konzilsbeschlüsse im 13. Jahrhundert die Augustinusregel als normative Grundlage ihrer Gemeinschaft an. Die Synoden von Paris im Jahre 1212 und von Rouen 1214 und schließlich auch das vierte Laterankonzil 1215 hatten mit Nachdruck viele dieser Gemeinschaften zur Annahme einer Regel verpflichtet. Die auf die Krankenpflege spezialisierten Bruderschaften entschieden sich vorwiegend zugunsten der Augustinusregel, wie schon der Chronist Jakob von Vitry betonte. Treffend charakterisierte der französische Historiker Michel Mollat diese Entwicklung in seinem grundlegenden, im Jahre 1978 erschienenen Werk zur Geschichte der Armut im Mittelalter als „ein deutliches Indiz nicht nur für den Aufschwung der Armenfürsorge insgesamt, sondern auch für den Geist, von dem die Organisationen getragen wurden.“
Q
Die kranken Brüder. Kapitel 36 der Benediktsregel
B. Frohn, Klostermedizin, S. 18f.
Die Sorge für die Kranken muss vor und über allem stehen: Man soll ihnen so dienen, als wären sie wirklich Christus; hat er doch gesagt: Ich war krank, und ihr habt mich besucht, und: Was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Aber auch die Kranken mögen bedenken, dass man ihnen dient, um Gott zu ehren; sie sollen ihre Brüder, die ihnen dienen, nicht durch übertriebene Ansprüche traurig machen. Doch auch solche Kranke müssen in Geduld ertragen werden; denn durch sie erlangt man größeren Lohn. Daher sei es eine Hauptsorge des Abtes, dass sie unter keiner Vernachlässigung zu leiden haben. Die kranken Brüder sollen einen eigenen Raum haben und einen eigenen Pfleger, der Gott fürchtet und ihnen sorgfältig und eifrig dient. Man biete den Kranken, sooft es ihnen gut tut, ein Bad an; den Gesunden jedoch und vor allem den Jüngeren erlaube man es nicht so schnell. Die ganz schwachen Kranken dürfen außerdem zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit Fleisch essen. Doch sobald es ihnen besser geht, sollen sie alle nach allgemeinem Brauch auf Fleisch verzichten. Der Abt sehe es als eine Hauptsorge an, dass die Kranken weder vom Cellerar noch von den Pflegern vernachlässigt werden. Auf ihn fällt zurück, was immer die Jünger verschulden.
Basiliosregel
Inspiriert vom Geist des Augustinus gründete der Kirchenvater Basilios der Große (330 – 379), der ebenfalls eine jahrhundertelang für die östlichen Kirchen grundlegende Regel schuf, nach der Rückkehr vom Nil in seine kleinasiatische Heimat eine Einsiedler-Gemeinschaft nach augustinischem Vorbild. In diesem Umfeld entstand offenbar schon bald eine von den späteren Geschichtsschreibern ins Mythische verklärte Einrichtung zur Kranken- und Armenfürsorge. Dieses so genannte Xenodochium, nach der ursprünglichen Wortbedeutung eine Fremdenherberge, vor den Toren des kleinasiatische Caesarea (heute Kayseri in Ost-Anatolien) bot angeblich als ein von der Außenwelt abgeschlossenes Großhospital unterschiedliche Versorgungshäuser für Kranke, Pilger und sonstige Bedürftige. Zudem verfügte es über eine separate Unterbringungsmöglichkeit für Leprakranke sowie über eigene Unterkünfte für die Ärzte und das Dienstpersonal. Wieweit dieses in späteren Zeiten verklärte Idealbild eines Hospitals den tatsächlichen Gegebenheiten in Caesarea entsprach, ist eher fraglich. Unbestreitbar bleibt, dass sich die Einsiedler-Gemeinschaft in herausragendem Maß um die Fürsorge bemüht hatte.
Ihren Durchbruch im frühmittelalterlichen Abendland erreichte die Vorstellung von der Mönchs- als einer Pflegegemeinschaft für Seele und Leib mit der Klostergründung des heiligen Benedikt von Nursia (480 – 547) auf dem Montecassino im Jahre 529. In seiner als Richtlinie für ein gemeinschaftliches Zusammenleben verfassten Benediktsregel nahm die Fürsorge für Kranke und Bedürftige einen besonderen Platz ein. In ihrem 36. Kapitel gibt der Ordensgründer umfangreiche Anweisungen für den Umgang mit den kranken Mitbrüdern (s. Quelle oben).
Benediktsregel
Neben der Pflege galten für die kränklichen und schwachen Brüder besondere Ausnahmen im klösterlichen Alltag. Mit der Arbeit, der jedes Gemeinschaftsmitglied getreu der von Benedikt in seiner Regel ausgegebenen Losung „bete und arbeite“ ( ora et labora) nachzugehen hatte, sollten sie nicht überfordert werden. Doch die Vorschriften der Regel widmen sich keineswegs nur der Fürsorge für die kranken Mitbrüder. Im 53. Kapitel der Regel, das sich auf die Aufnahme von Gästen bezieht, findet sich die Weisung zu besonderer Sorgfalt beim Empfang Armer und Fremder. In ihnen, so sagt es der Text, werde Christus selbst aufgenommen.
Читать дальше