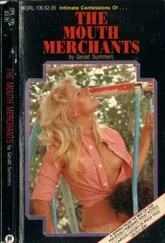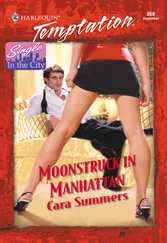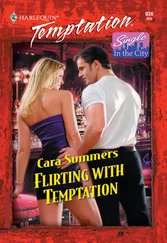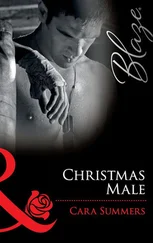»Bis später«, verabschiedete ich mich von dem schlaksig wirkenden Arzt. Seine winzige Nickelbrille saß gänzlich unpassend in dem großen, mondförmigen Gesicht. Dafür hatte er dieses einnehmende Lächeln, das einem versicherte, dass alles gut werden würde.
»Könntet ihr mir bei Gelegenheit vielleicht ein paar Klamotten von zu Hause mitbringen? Hab’ ich noch so etwas wie ein Handy oder ist das in den Flammen verbrannt?«
»Natürlich, wir holen dir, was immer du möchtest. Ein paar Dinge habe ich dir bereits zurechtgelegt. Soll ich dir noch etwas Bestimmtes einpacken? Dein Handy war nicht bei dir, als du hier eingeliefert wurdest. Vielleicht hast du es zu Hause vergessen? Wenn nicht, dann kaufen wir dir einfach ein neues. Das sollte wirklich unsere kleinste Sorge sein.«
Ja, Geld war noch nie ein Problem gewesen. Denn davon hatten meine Adoptiveltern im Überfluss. Seit ich mein Studium beendet hatte, versuchte ich auf eigenen Beinen zu stehen, auch finanziell.
Allerdings konnten es die beiden einfach nicht lassen, mir immer wieder etwas zu schenken oder Geld zuzustecken, das ich überhaupt nicht wollte. Manchmal kam es mir so vor, als würden sie sich meine Liebe erkaufen wollen. Dabei meinten sie es sicher immer nur gut.
Es brach mir das Herz, sie so zurückzuweisen, aber ich konnte einfach nicht aus meiner Haut. Tagein, tagaus hatte ich das Gefühl, nicht dazuzugehören, kein rechtmäßiges Familienmitglied zu sein. Ich wollte einfach meinen eigenen Platz in der Welt finden.
Dennoch musste ich Mom recht geben. Wenn ich es richtig verstand, dann war ich nur knapp mit dem Leben davongekommen. Und ich machte mir gerade allen Ernstes Gedanken über mein Smartphone! Wieso war mir das kleine Gerät bloß in den Sinn gekommen? Irgendetwas verband ich damit.
»Mom, wo ist Samuel?«
»Oje, ich wusste, dass du uns das fragen würdest. Liebes, ich habe keine Ahnung. Er hat sich nicht bei uns gemeldet und wir konnten ihn nicht kontaktieren, weil wir keine Nummer von ihm hatten. Es scheint ganz so, als hätte er gar nicht mitbekommen, was vorgefallen ist. Obwohl es wirklich in jeder Tageszeitung stand und sogar im Fernsehen davon berichtet wurde. So etwas passiert schließlich auch in Chicago nicht alle Tage.«
Merkwürdig. Wenn Samuel mich nicht erreicht hatte, dann hätte er doch sicher versucht, mich im Museum anzutreffen, oder er hätte meine Freundinnen oder meine Eltern nach mir gefragt. Wenn er gewollt hätte, dann hätte es zig Möglichkeiten gegeben, mich zu finden.
Schließlich wusste er ja auch, wo meine Eltern lebten. Nein, irgendetwas war vorgefallen. Ich zermarterte mir das Hirn, kam aber einfach zu keinem schlüssigen Ergebnis.
Komischerweise stellte sich bei mir urplötzlich das dringende Bedürfnis ein, den Lack eines Wagens mit einem Schraubenzieher zu bearbeiten. Wirklich merkwürdig. Ich neigte für gewöhnlich nicht dazu, Dinge mutwillig zu beschädigen.
Vielleicht sollte ich Dr. Hepburn bei Gelegenheit fragen, ob das Komplikationen im Zusammenhang mit meiner Behandlung sein konnten. Erklären konnte ich mir das Ganze beim besten Willen nicht.
»So, Liebes, wir werden jetzt gehen und dir noch etwas Ruhe gönnen. Deine Freundinnen kommen dich am späten Nachmittag besuchen. Sie sind so dankbar, dass du wieder bei uns bist, und können es kaum abwarten, dich zu sehen.« Mom küsste mich behutsam auf die Stirn, während sie ihre Hände ganz sanft auf meine Wangen legte. Sie hatte Tränen in den Augen und dieses dankbare Lächeln auf den Lippen. Dad tat es ihr gleich und beide verließen wenig später den Raum.
Dann war ich wieder allein. Nur das monotone Rattern der Geräte um mich herum war noch zu hören. Was sollte ich nun tun? Die Zeit mit Löcher-in-die-Luft-Starren totschlagen und hoffen, dass mich bald wieder jemand besuchen kam?
Ich schnappte mir die Fernbedienung, nachdem ich es mir nicht vorstellen konnte, noch einen Moment länger diese Stille zu ertragen, und zappte wahllos die Sender hoch und runter. Das meiste war belangloses Zeug. Das leichte Schwindelgefühl nahm ich billigend in Kauf, solange ich mich nur nicht länger so einsam fühlen musste.
Das Gefühl der Einsamkeit war, kurz nachdem ich meine Lider wieder aufgeschlagen hatte, so präsent wie eh und je. Egal, wie sehr sich meine Eltern auch bemühten, ich fühlte mich nach all den Jahren noch immer wie ein Störfaktor in dem fast perfekten Familienidyll.
Da die beiden keine eigenen Kinder bekommen konnten, entschieden sie sich dazu, einem Waisenkind die Chance auf ein besseres Leben zu geben. Ich hatte alles, was man mit Geld kaufen konnte, musste nie darum betteln, wenn es neue Spielsachen gab. Nein, ich bekam die Dinge meist, noch ehe ich selbst etwas davon gehört hatte.
Tonnen an Kunststoff, später dann an lackiertem Blech, vermochten aber nie diese Leere tief in mir zu füllen. Die Einsamkeit, die sich in mir breitmachte, sobald ich meine Augen schloss, war uferlos.
Ich schüttelte leicht mit dem Kopf. Wie undankbar ich doch war. Meine Eltern taten alles für mich. Und ich? Was tat ich? Ich saß hier wie ein Häufchen Elend und bemitleidete mich selbst um das Leben, das so viele liebend gerne an meiner Stelle gelebt hätten.
Auf einem der Channel blieb ich schließlich hängen, als ich Bilder von dem Museum erkannte. Offensichtlich wurde hier von dem Brand berichtet.
Beim Anblick überkam mich eine Gänsehaut. Allein der Gedanke, dass ich unter diesen Trümmern im Bürotrakt begraben sein könnte, jagte mir abertausende Schauer über den Rücken. Ich zog die Bettdecke noch etwas höher und blickte aus schreckgeweiteten Augen auf den Fernseher an der Wand.
Die Frage, die seit dem Ausbruch des Feuers im Museum im Raum stand, war geklärt: Es handelte sich ohne Zweifel um Brandstiftung. Nur das beherzte Eingreifen der Chicagoer Feuerwehr hat Schlimmeres verhindern können, sodass das Feuer nicht auf die angrenzenden Stockwerke übergesprungen war und die Exponate und das Archiv verschont blieben. Dann war von mir die Rede.
Meine Kollegen waren mit einem blauen Auge davongekommen, während ich mit einer schweren Rauchvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Ein Feuerwehrmann in voller Montur wurde daraufhin gezeigt, der mich in allerletzter Sekunde aus den Flammen gerettet haben soll.
Es war so merkwürdig, zu sehen, wie die Menschen über einen sprachen. Worte wie das Opfer oder die Verletzte fielen und ich tat mir sehr schwer dabei, das Gesagte mit mir in Verbindung zu bringen.
In meinem Kopf begann es zu rauschen. Für einen Moment war ich nicht mehr in der Lage, mich auf den Bericht zu konzentrieren. Wenn ich mich auch bisher gut im Griff gehabt hatte, wurde mir das Ausmaß des Unfalls gerade mehr als deutlich vor Augen geführt.
Ich hätte sterben können, sterben müssen, wenn nicht dieser eine Mann todesmutig zurück in das brennende Gebäude gegangen wäre. Wenn man den Worten des Reporters Glauben schenken konnte, dann hatten ihm seine Kollegen dringend davon abgeraten. Es war einfach zu gefährlich und dennoch hatte er sich ihnen widersetzt und hatte mich gerettet. Er hatte sein Leben riskiert, um mich zu retten. Mich!
Sobald ich aus dem Krankenhaus entlassen würde, musste ich ihn ausfindig machen und mich bei ihm bedanken. Dieser Mann kannte mich nicht mal und hatte sich allen Zweifeln zum Trotz unter Lebensgefahr zurück in das brennende Gebäude begeben.
Warum hatte er das getan? Warum hatte er unter Einsatz seines Lebens einer völlig Fremden geholfen? Warum hatte er mir geholfen?
Ich wischte die Gedanken beiseite. Mein Kopf dröhnte zu sehr, als dass ich mich weiter mit diesen Fragen kasteien wollte. Wer weiß, vielleicht war es ja so etwas wie Schicksal. Schließlich hatte er mich aus meinem Turm – okay, vielmehr aus dem fünften Stockwerk des Museums – befreit. Wenn das nicht romantisch war, dann wusste ich auch nicht.
Читать дальше