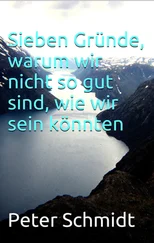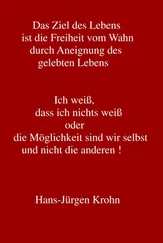„Was soll das jetzt, Mutti? Willst du mir ein schlechtes Gewissen machen?“
Mein Tonfall erschien mir selbst unangemessen aggressiv. Ihr Weinen klang erschütternd. Ich war verzweifelt. Sollte ich sie tröstend in den Arm nehmen? Wie oft hatte ich in meinem Leben darauf vergeblich gewartet, dass meine Mutter einmal Zärtlichkeit zeigte, uns Kinder spontan umarmte? Nein, so lautete mein Entschluss, ich würde hart bleiben. Auch einen liebevollen Händedruck von mir ließ ich nicht zu.
„Um fünf Uhr fahren wir“, gab ich bekannt, „egal, ob Hille noch da ist oder nicht.“
Zur angekündigten Uhrzeit bat ich Hille um Verständnis. Sie half mir noch, Mutter ins Auto zu setzen und wir fuhren los. Es dauerte dann in der Tat, wie immer in den Notaufnahmen, Stunden, bis sie versorgt wurde. Wie immer ließ sie den Ärzten kaum eine Chance, Fragen zu stellen.
„Hören Sie mal eben zu!“, war ihr Standardsatz. Dann erzählte sie ihre Leidensgeschichte inklusive Anamnese. Nach geraumer Zeit sagte die Ärztin:
„Ich glaub', Sie brauchen mich nicht mehr. Sie wissen scheinbar selbst am besten, wie Ihnen zu helfen ist.“
„So?“ Meine Mutter verstummte. Ich schwieg.
Am nächsten Tag lag sie in einem Patientenzimmer der Notaufnahme. Ein junger Arzt kam. Ich saß am Fußende des Bettes. Wieder erhob meine Mutter den rechten Zeigefinger. Dieser Arzt war geduldiger. Zum ersten Mal fiel mir auf, dass meine Mutter die Augen weit geöffnet hatte und ihr Blick ziellos durch den Raum schweifte. Ihre Worte waren undeutlich. Sie wiederholte sich. Morphium. Ich begleitete sie noch auf ein Stationszimmer, ordnete ihre Wäsche in den Schrank, schaute sie ernst an und verabschiedete mich. Drei Stunden später war ich wieder in Köln.
Köln, 6. Juni 2008
Liebe Mutti,
(…) Ich versuche seit Wochen Dich von der Notwendigkeit zu überzeugen, dass Du Dir Betreuung ins Haus holst. (…) Es kann doch nicht angehen, dass Du mich aus Köln holen musst, um Ansprache und Gesellschaft zu haben? Mein Kommen war schließlich nichts anderes als die Inanspruchnahme alltäglicher Pflege, Hilfs- und Fahrdienste, die eine Dame, und bezahlt noch dazu, hätte leisten können. (…)
Ich komme Dich gerne besuchen. Aber es muss eine Lage bei Dir im Haus vorhanden sein, die es ermöglicht, dass wir zwei unkomplizierte Gespräche haben und noch einige gute, schöne Dinge tun können. (…) Ich wiederhole mein Angebot, dass ich Dir bei der Suche nach Unterstützung helfen kann.
Allein – solltest Du das leider immer noch nicht einsehen, dass das der beste Weg für Dich für ein weiteres erfreulicheres Leben ist, und dass Du damit Heiner und mir eine große Last nimmst, werde ich mich nicht imstande sehen, nach OL zu kommen, (…). Deine Mutter konnte sich das vielleicht mit Euch Schwestern erlauben – bei mir geht das nicht, auf Abruf parat zu stehen, für Dinge, die ich gar nicht machen müsste und auch nicht will.
(…) Gib mir bitte irgendwann Zeichen, wie Du Dich entscheidest, Deinen Alltag zu gestalten.
Ich wünsche Dir, dass es weiterhin voran geht mit Deiner Mobilität und die Schmerzen im Erträglichen bleiben. Liebe Grüße! Deine Tini
Am 30. Juni 2008 rief mich meine Mutter von zu Hause wieder an, in Tränen aufgelöst, sie wolle nach Bayreuth, weil mein Bruder dort bei einem Kollegen im Krankenhaus eine weitere OP organisiert habe.
Ich möge sie doch bitte in Oldenburg abholen und dann nach Bayreuth fahren.
Ich erinnerte sie an meinen letzten Besuch und an meinen Brief.
Ich verweigerte meine Dienste.
Ein Bekannter fuhr sie schließlich hin.
Vier Tage später verstarb meine Mutter (in Bayreuth). Ich habe nicht mehr mit ihr reden können.
Dies war der „Gipfel“ unserer Mutter-Tochter-Beziehung.
„An deiner Stelle würde ich es nicht tun“, warnte mich mein Bruder schon kurz nach dem Tod unserer Mutter, als ich ihm erzählt hatte, dass es einen Ordner gäbe, in dem sie die Korrespondenz zwischen ihr, meinem Vater und mir während meiner Pubertät aufbewahrt hatte. Heiner wollte sicherlich verhindern, dass ich beim Lesen Geister weckte, die mich piesacken könnten.
Erst drei Jahre später schlug ich den roten Ordner auf, in der Hoffnung, endlich Klarheit zu erhalten und Gründe zu finden, warum Mutter und ich, zum Teil auch mein Vater und ich, so gravierend aneinander vorbei gefühlt und gelebt hatten.
Ich saß an meinem Arbeitsplatz zu Hause und schaute in einen stürmischen und verregneten Nachmittag hinaus. Auf meinem Schreibtisch lagen verteilt einige handgeschriebene Briefe, die meisten von meiner Mutter mit blauem Kugelschreiber, manchmal mit Bleistift auf gewöhnlichem, karierten oder linierten Papier geschrieben. Ihre weiche Handschrift stand für mich schon immer im Widerspruch zu ihrem pragmatischen Verhalten.
„Das gibt es nicht!“, entfuhr es mir laut. Ich starrte auf einen Fetzen Papier. Der mit Bleistift geschriebene Inhalt verriet mir, dass ich damals siebzehn gewesen war:
„Tini, bevor Du Dich mit Th. wieder triffst, überlege Dir gut, was zu tun ist. Den Schutz, den Du gestern offensichtlich genommen hast (Reste in der Hose), reicht todsicher nicht aus, um das Schlimmste zu verhüten. Entweder Du widerstehst ihm in einer Form, die risikolos bleibt oder Dein Weg ist wie bei allen anderen Mädchen zum Frauenarzt. – Wähle gut, Du weißt, was ich damit meine. Mutti
P.S: Ich meine es in jeder Form gut. Mache was aus Deiner Jugend. Bleibe das Mädchen, was Du eigentlich im Grunde immer geblieben bist. Werde kein Dutzendmensch!
Ich hatte verdrängt, wie kontrolliert ich zu Hause lebte. Und mit jedem Brief, jeder Zeile, jedem Wort, pirschte sich die Erinnerung heran, sie bedrohte mich, machte mich schwindelig, würgte mich. Gleichwohl musste ich als über Fünfzigjährige oft lachen über so manche Ausrede, die mir als Teenager eingefallen war.
Wie jedes Kind konnte auch ich meine Eltern nur als Eltern erleben, nicht als Menschen, die ein Leben vor ihren Kindern hatten. Die wenigen Anekdoten, die sie erzählten, ergaben kein vollständiges Bild. Mit dem Nachlass an Ordnern und Kartons hatte ich die Gelegenheit erhalten, Briefe zu lesen, als sie junge Menschen gewesen waren. Ich wagte das Abenteuer, was mir zu Anfang gar nicht so bewusst war, in die Vergangenheit meiner Eltern und ihrer Eltern hinab zu tauchen. Mit jedem Dokument, das sie mir hinterlassen hatten, lüftete sich Stück für Stück ein Schleier der Unkenntnis. Und was ich heraufholte, ließ mir so manches Mal den Mund offen stehen. Ich trat in einen inneren Dialog mit ihnen. Endlich fand ich Erklärungen.
Köln, 20. April 2012 :Ich liege auf dem Rücken, die Daunendecke bis zum Kinn hochgezogen, meine Füße schauen unten hervor. Soeben hatte ich im Traum eine Auseinandersetzung mit meinem Vater.
Ich sitze in Oldenburg, Heynesweg, am Esszimmertisch. Es ist grell um mich herum.
„Wie lange musst du noch schreiben, Tini?“, fragt er mich.
„Keine Ahnung, es gibt so viel zu erzählen.“
„Aber du musst jetzt fertig werden.“
Vati sitzt mir gegenüber. Er ist noch nicht so alt, wie zu dem Zeitpunkt, als er starb, vierundachtzigjährig. Er hat noch Geheimratsecken, und einen klaren Blick. Am Ende seines Lebens war dieser wässrig verschwommen, suchend. Meistens schlief er. Die Haare waren gänzlich verschwunden und rosablasse Kopfhaut schimmerte im Licht der Nachttischlampe.
Im Traum weise ich mit dem Zeigefinger auf mein Archiv im Arbeitszimmer in Köln, sitze dabei aber in Oldenburg.
„Weißt du, wie viele Briefe darin liegen?“, frage ich ihn mit erregter Stimme. „Ihr habt sie mir alle hinterlassen! Doch sicherlich mit Absicht? Ich muss doch alles erzählen, dies ist meine Aufgabe, die ihr mir hinterlassen habt.“
Читать дальше