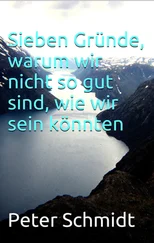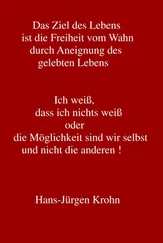Vor meinem inneren Auge erschien mir mein Zimmerchen mit den Dachschrägen. In den 70er Jahren bot eine knallgelbe, blumig gemusterte Tapete den Hintergrund für Pferdeposter und David Cassidy.
Von meinem Fenster aus konnte ich in den schmalen, langen Garten, über eine Teppichstange hinweg, auf den dahinter liegenden kleinen Bungalow schauen. Dort lebte Klaus. Ich lieferte ihm quasi seine Beine, denn er hatte Muskelschwund, hatte nie Laufen können. So raste ich mit ihm im Rollstuhl durch die Straßen meiner Stadt, immer einen Schabernack mit den staunenden Passanten treibend. Im Slalom umfuhren wir sie, oder wir taten so, als ob wir uns fürchterlich stritten, was für Kopfschütteln sorgte.
Von der Katze, die Johannisbeeren klaute, erzählte das Haus Nummer 9. Die aus meinem damaligen Blickwinkel uralte Nachbarin behauptete, dass unsere Pussy Geschmack an diesen Früchten gefunden hätte. Sie wollte wahrhaftig gesehen haben, wie auf jedem Eckzahn eine Johannesbeere steckte. Manchmal fielen Schüsse, jemand versuchte mit seinem Luftgewehr die Beeren klauende Katze zu verscheuchen.
Einige Jahre später ermutigten wir unsere Dackeldame Buffy, die Maulwurfshaufen in unserem Rasen aufzubuddeln, um die unterirdischen Bewohner zum Umzug zu bewegen. Das gelang dem Hund prächtig. Schon bald wölbten sich graue Erdhaufen auf dem Grundstück des Hauses Nr. 9.
Nach einer gefühlten Ewigkeit, doch es waren wohl nur zwei Minuten gewesen, erreichten mein Mann und ich den Anfang meiner Straße, die Hausnummer 1.
Der Anblick des Seniorenheims holte mich abrupt aus meiner Versunkenheit heraus. Hier stand nämlich früher Detlefs Zuhause. Er war mein kleiner Freund für die ruhigen Spiele. Seine Heimat ist vor vielen Jahren abgerissen worden.
In unserem Auto transportierten wir einen schriftlichen Nachlass, an dessen Entdeckung ich mich erst drei Jahre später herantraute. Langsam begann ich zu erahnen, welche Werte er barg. Keine materiellen Werte, sondern emotionale.
Die Dokumente und Zeitzeugnisse, einige über hundert Jahre alt, bestehen aus gesammelten Zeitungsausschnitten, Fotos, gelblich oder schwarz-weiß, manche winzig klein, nicht größer als zwei mal zwei Zentimeter; Briefe an Angehörige und Freunde, an Behörden, von Behörden, Notizen, Schulhefte. Der vergilbte Papierwust erzählt von Liebe, Kummer, Freude, Hass, Geburten, Tod, Armut, Nazis, Krieg, Hunger, Reichtum, Stolz und Demut, Depression und Hoffnung.
Weiße Wolken zogen in hoher Geschwindigkeit über mich hinweg. Seit Tagen hatte es im Westen Nordrhein-Westfalens heftige Unwetter gegeben. Diese himmlischen Kapriolen ähnelten meinem Gemütszustand. Es war früher Nachmittag an diesem 02. Juni 2008. Ich raste von Köln nach Oldenburg, nahm die A3, A2 und dann die A 31, und schließlich bei Leer, Ostfriesland, wo meine Schwiegereltern begraben lagen, die A 29.
Was würde mich da wieder erwarten, zu Hause, im Heynesweg, fragte ich mich. Meine Mutter hatte am Vormittag einen Notruf abgesetzt.
„Tini, bitte komm‘ und hilf mir. Ich habe so schlimme Schmerzen. Heiner hat schon im Krankenhaus Westerstede angerufen. Die wissen Bescheid. Ich soll mich in der Notaufnahme melden.“ Sie schluchzte, ihre Stimme war brüchig.
„Ja, natürlich. Ich muss hier nur noch einiges organisieren.“ „Einiges“, das waren meine fünfzehnjährige Tochter Cora, Claus, mein Mann, und Welpe Sandy.
Nun fuhr ich in meine Heimat, an grasendem Buntvieh vorbei, das schwarz-weiß war. Oldenburger Pferde schritten über Koppeln. Gedrungene Bauernhäuser aus rotem Ziegelstein lagen verstreut über dem saftigen Land. Baumschulen am Autobahnrand präsentierten ihre Kunstobjekte: rasierte, gestutzte Nadelgehölze, kugelförmige Buchsbäume. Meterhohe, in praller Blüte stehende Rhododendren säumten die Grundstücksgrenzen.
Während ich die Ausfahrt Wechloy nahm, versuchte ich mir einen Plan zurechtzulegen, wie ich meine 83-jährige Mutter, die sich kaum bewegen konnte, ins Auto bekomme und bequem lagern kann.
Die Osteoporose hatte die Wirbelsäule peu à peu zerbröselt. Wirbel sackten zusammen, quetschten Bandscheiben ein oder brachen. Knochenzement, Titanstifte, alles erdenklich Mögliche hatte meine Mutter schon erhalten. Jedes Mal war eine OP ein Risiko, weil sie Marcumar nahm, das sie absetzen musste, nur Heparin durfte noch gespritzt werden. Die höllischen Schmerzen rührten vermutlich daher, dass bei einer OP ein Nerv mit Knochenzement einbetoniert worden war. Selbst Morphium brachte kaum Linderung.
Kurz bevor ich die Einfahrt zum Haus erreichte, das in zweiter Reihe zur Straße lag, schwirrten Gedanken, die eher Vorwürfe waren, durch meinen Kopf.
„Nur weil Mutti keinen Kontakt mehr nach draußen pflegt, muss ich aus Köln extra hierher fahren.“
Seit Vaters Tod zwei Jahre zuvor hatte sie alle Freundschaften vernachlässigt. Mein Vater, gezeichnet durch multiple zerebrale Infarkte und gegen Lebensende bettlägerig, hatte das große Glück, in seiner Elly eine aufopfernde Pflegerin zu haben – aber sie ließ auch keinen anderen ran, weil es ihr niemand recht machen konnte. Selbst in ihrer damaligen eigenen misslichen Situation kam für sie ein Pflegedienst, geschweige denn privat angeheuerte Frauen, die im Haus hätten leben können, nicht in Frage.
Ziemlich geladen stieg ich aus meinem Auto und knallte die Tür zu. Den Hausschlüssel brauchte ich nicht. Meine Mutter ließ die Eingangstür Tag und Nacht angelehnt, damit nicht nur ihre Haushaltshilfe, sondern jeder, der etwas bringen oder abholen wollte, problemlos hinein konnte. Aufstehen konnte sie nicht mehr, um die Tür zu öffnen. Allein der Gedanke, dass wildfremde und vielleicht unehrliche Zeitgenossen jederzeit ins Haus gekonnt hätten, ließ meinen Magen verkrampfen.
Ich eilte die Treppe hoch, an der noch zu Lebzeiten meines Vaters ein Treppenlift angebracht worden war. Das Haus war 1979 großzügig gebaut worden, Eingangsdiele unten und der Flurbereich oben waren überdimensional geräumig. Meine Eltern hatten sich einen Traum mit diesem Haus erfüllt. Endlich Platz!
Die Schlafzimmertür stand offen. Meine Mutter lag im Pflegebett, dessen Rückenteil hoch gestellt war.
„Da bist du ja. Wie war die Fahrt?“
„Danke. Gut.“
Sie wollte sich etwas hoch drücken und schrie vor Schmerz auf.
„Wie bekomme ich dich jetzt aus dem Bett?“
Ich ging näher zu ihr hin und schaute in ein graues, eingefallenes Gesicht. Die Nase wirkte viel zu groß. Die Augen lagen tief in ihren Höhlen. Ihr weißes Haar war stumpf geworden.
„Da brauchst du dir jetzt keine Gedanken zu machen. Wir bekommen gleich Besuch, von Hille aus Bremen. Ich hab’ sie eingeladen. Du kannst schon mal Tee aufsetzen und schauen, ob wir noch Kekse haben.“
Ich schnappte nach Luft. Ich runzelte die Stirn, spürte meine Zornesfalte.
„Aber du musst doch ins Krankenhaus! Die warten doch.“
Wie so oft schon in meinem Leben, wenn Mutti und ich nicht einer Meinung waren, floss mir ein heißes Kribbeln durch Haut und Adern. Heiner hatte es trotz seines anstrengenden Alltags als Radiologe in Bayreuth geschafft, in Westerstede bei Oldenburg die Ärzte zu mobilisieren, dass sie unsere Mutter an diesem Tag noch aufnehmen und intensiv betreuen wollten.
Sie fügte noch hinzu: „Ich habe jetzt Appetit auf Obstsuppe, hol‘ mir bitte welche.“
Ich verstand sie nicht. Tränen der Wut füllten meine Augen. Meine Stimme wurde zittrig, als ich sagte: „Das glaube ich jetzt nicht. Ich rase hierher, um dir zu helfen, finde hier einen Haufen Elend vor – und du kommandierst mich erst mal rum?“
Wieder gellte ihr Schmerzensschrei durch das Haus. Sie fing an zu weinen. Oh, mein Gott, sie tat mir so leid!
„Ich will nicht mehr. Warum lasst ihr mich nicht einfach sterben?“
Читать дальше