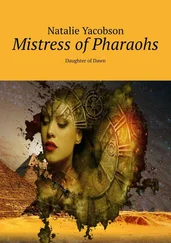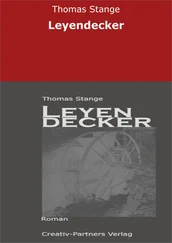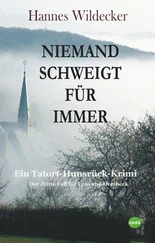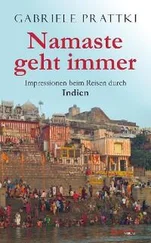Natalie Leyendecker
Schlimmer geht immer
Aufgeben ist keine Option
Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis
Titel Natalie Leyendecker Schlimmer geht immer Aufgeben ist keine Option Dieses ebook wurde erstellt bei
Schlimmer geht immer - Aufgeben ist keine Option
Kapitel 2: Hurra es brennt
Kapitel 3: Spurensuche
Kapitel 4: Mama hat frei
Kapitel 5: Reisevorbereitungen
Kapitel 6: Det kunne ikke være værre
Kapitel 7: Kind gestohlen
Kapitel 8. Was machst du, wenn du nicht mehr kannst?
Kapitel 9: Der Papa wirds schon richten
Kapitel 10: Für jede Lösung ein Problem
Kapitel 11: Unverhofft kommt manchmal auch
Kapitel 12: Weihnachtszeit
Kapitel 13: Hahnenkampf
Kapitel 14: Zwischen Arbeit und Familie
Kapitel 15: Leben im Lockdown
Kapitel 16: Schlimmer geht immer
Kapitel 17: Neustart
Mein Traum
Impressum neobooks
Schlimmer geht immer - Aufgeben ist keine Option
Schlimmer geht immer
Aufgeben ist keine Option
Noch eine halbe Stunde, und hier im Haus herrschte immer noch Chaos. Wie oft hatte ich heute schon das Wohnzimmer gefegt, die Kissen aufgeschlagen? Aber erneut war das Sofa Gegenstand einer Kissenschlacht geworden. Die Kuscheldecke lag achtlos auf dem Couchtisch, die Kissen bunt im Raum verteilt, und auf dem Sofa fand ich die Fernbedienung, den Controller der Playstation und zahlreiche Batterien. Offensichtlich hatte die jemand ausgetauscht und die alten an Ort und Stelle entsorgt. Und der- oder diejenige hatte auch mindestens ein Paket Chips gegessen bzw. verteilt. Jedenfalls lagen zwischen Couchtisch und Sofa unzählige Krümel und im Zeitungskorb eine leere Chipstüte.
Also schnappte ich mir schnell Handbesen und Kehrblech, entsorgte die Chips, warf die leeren Batterien in unsere Recyclinghoftüte, faltete die Decke und platzierte die Kissen wieder mittig auf dem Sofa. Dann folgte der Check im Badezimmer. Nein! Kann hier jemand die Toilette abspülen und vielleicht sogar die Klobürste benutzen? Der Seifenspender leer, das Händehandtuch weg.
Ich war genervt und stand unter Zeitdruck. Noch 20 Minuten. »Kinder, kommt Ihr in zehn Minuten bitte mit zum Bahnhof, die Großeltern abholen?« Keine Antwort. »Kinder!«, ich rief lauter, aber sie hatten sich verkrochen. Sie hatten mir ja auch ungefähr 100 Mal in den letzten Tagen mitgeteilt, dass sie keine Lust hatten auf Besuch, auf Verwandtschaft, auf Großeltern, auf Ausflüge. Aber selbst wenn sie alles doof fanden, konnten sie nicht wenigstens an diesem Tag, dem Ankunftstag ihrer Großeltern, die uns zweimal jährlich besuchten, nicht überall ihr Chaos verteilen?
»Jakob!« Genervt stürmte ich ins Zimmer meines vierzehnjährigen Sohnes. Meines »Problemkindes« wie meine Freunde sagten. Problemkind? Nein, einfach nicht stromlinienförmig, außergewöhnlich – vor allem leider außergewöhnlich anstrengend, so meine Meinung, jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt. Das Zimmer leer, er war wohl mal wieder mit »Kollegen« (so sagt der Schweizer zu Schulfreunden) unterwegs.
Der Anblick, der sich mir in seinem Zimmer bot, war ein Albtraum. Der Schreibtisch verwüstet, auf dem Bett jede Menge Klamotten, Jeans, Shirts, alles Mögliche. Ich öffnete den Kleiderschrank, und ein Geruch von modriger, schmutziger Wäsche gemischt mit Tabak strömte mir entgegen. Ich warf blitzschnell alles, was ich fand, in den Kleiderschrank. Dann versuchte ich irgendwie die Tür zu schließen. Schwierig war es bei dem bunten Durcheinander von Kisten, Schulbüchern, Zigaretten, Feuerzeugen und Kleidungsstücken – sauber wie schmutzig. Hier passte nichts mehr rein, außer vielleicht eine Ratte. Aber den Schrank würden sie hoffentlich nicht öffnen, meine Eltern. Ich schmiss mich gegen die Tür. Gott sei Dank, sie ging zu.
Okay, Zimmer fertig! Fertig? Nein, der Sofakasten stand noch zehn Zentimeter auf, die Sitzfläche quer im Raum. Noch zwölf Minuten bis zur Ankunft meiner Eltern. Meine Hände waren schweißnass, und ich spürte, dass ich wieder diesen getriebenen Blick in den Augen hatte, den ich selbst so an mir hasste.
Egal, was ich tat, ich könnte es meinen Eltern nicht recht machen, nicht ich mit meinem Chaoshaushalt, ich, bei der die Theken nie glänzten, die Mülleimer immer schmutzig waren, die Kleidung meist fleckig und die Kinder … ja, die Kinder auch nicht so geraten wie die Enkelkinder ihrer Freunde.
Die Sofakiste war immer noch offen. Ich versuchte die Sitzfläche anzuheben und fand jede Menge Bettwäsche. Gehetzt riss ich sie aus dem schmalen Kasten und dann – dann sah ich es:
Eine Tüte, transparent und in der Größe von ungefähr drei Flugzeugflüssigkeitstüten, die mit dem Zip, in der man am Flughafen vor dem Check-in seine Flüssigkeitsbehälter, Kosmetika und sonstiges bis 200 Milliliter verpacken sollte. Aber das, was ich hier vor mir hatte, war kein Beutel fürs Handgepäck, auch nicht für den Koffer, den man aufgibt.
Ich starrte die Tüte an, nahm sie an mich und verschloss die Zimmertür von innen. Meine Hände zitterten, meine Knie waren weich. Ich hatte das hier noch nie in Realität gesehen, ich, Josefine Kardishi - das naive Blondchen, die anständige Juristin, die niemals auch nur an einer Zigarette gezogen hatte. Ich kannte es nur aus Filmen. Aber es bestand kein Zweifel. Der süßliche Geruch, den ich schon so oft in Jakobs Zimmer beim stundenlangen Wecken am Morgen gerochen hatte, an seinen Jogginghosen in der Waschküche und in seiner Bettwäsche. Es waren Mengen, Mengen an grünen Kugeln – Kugeln aus Cannabis. 100 Gramm? Mehr. 200 Gramm? Mehr.
Der Albtraum begann.
Kapitel 2: Hurra es brennt
16:38 Uhr, in dieser Minute kamen meine Eltern am kleinen Bahnhof unseres 5000-Einwohner Örtchens an. Und ich? Ich saß immer noch auf dem Bett meines Teenies mit einem riesigen Drogenfund in der Hand und weinte bitterlich. Meine Beine gehorchten mir nicht, als ich aufstehen wollte. Ich zitterte am ganzen Körper – und das bei 32 Grad Außentemperatur. Wir hatten den 5. Juli 2019, ein Datum, das ich nie vergessen werde.
Irgendwann, Minuten später, nahm ich wie traumatisiert den Beutel, ging die Treppe hoch zu meinem Schlafzimmer und schob ihn unter mein Bett. Ich musste jetzt funktionieren, meine Eltern waren am Bahnhof und ich noch nicht mal auf dem Weg. Eigentlich musste ich immer funktionieren, jeden Tag. Ich, die Mutter von drei Kindern, alleinerziehend, zwei Jobs (Juristin einer Werbefirma für Kinos in der Schweiz und Anwältin für Medienrecht in Deutschland). Immer hatte ich Stress, immer Schulden, und trotzdem war ein grundoptimistischer Mensch. Jedenfalls bis zu diesem Tag.
Wie in Trance nahm ich meinen Autoschlüssel, ging in unserem Haus am Berg drei Stockwerke tiefer zum Ausgang, verschloss die Haustür und setze mich in den Wagen, der in der Auffahrt stand. Immer noch liefen mir die Tränen unaufhörlich die Wange runter, ich spürte das Salz auf meiner Zunge, es schmeckte nach Verzweiflung. Ich war verzweifelt, und es war erst das zweite Mal in meinem Leben. Das erste Mal war ziemlich genau vor acht Monaten gewesen. Und ich erinnerte ich mich in diesem Moment an den vergangenen Oktober, als mein Kampf als Löwenmutter begonnen hatte …
Oktober 2018 – Rückblick
»Mein Sohn lügt nicht! Mein Sohn verkauft keine Drogen, weder am Bahnhof und schon gar nicht an der Schule!«
Immer wieder wiederholte ich die Worte in dem kleinen engen Raum des Sitzungszimmers des Direktors von Jakobs Schule. Erst gestern hatte mich die Sekretärin angerufen, um ein dringendes Gespräch gebeten. Ich saß da gerade im Auto, unterwegs in Österreich zu einem meiner Kunden. Den Anlass hatten sie mir nicht genannt. Aber dann am Abend mein Sohn. »Die behaupten, ich hätte Drogen gekauft. Mama, ich! Stell dir das mal vor! Da sind so zwei Streberinnen, die sind total ausgeschlossen und wollen mich einfach fertigmachen, weil ich neu in der Klasse bin und schon viel mehr Freunde habe als die.« Ich war geschockt, was gab es bloß für Kinder? Mein armer Junge, jetzt hatte er endlich eine Schule gefunden, zu der er regelmäßig ging, nun das.
Читать дальше