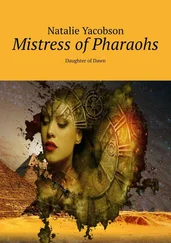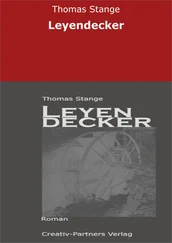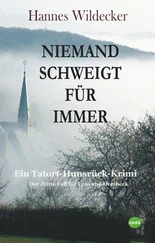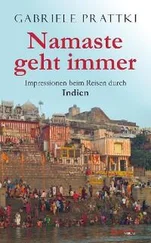»Da haben Sie recht«, unterbrach Frau Wunschenstein an dieser Stelle meinen Redeschwall. »Eine Trennung kann nicht für alles verantwortlich gemacht werden. Wann sind Sie denn hierher in die Schweiz gezogen, und wie war das für Ihren Sohn?«
»Ja das war 2017, vor zwei Jahren«, sagte ich und fuhr fort: »Es war ein Umzug, den ich mit den drei Kindern wagte, weil ich Abstand brauchte. Abstand vom Vater der Kinder, der keine Vereinbarungen, keine Grenzen einhielt – nie. Der sie mal abholte, mal nicht, mal nur einige, und immer nur dann und für so lange, wie es ihm passte, der ins Haus marschierte durch offene Terrassentüren und unser Leben kommentierte und kontrollierte. Er hatte sich ein neues Leben aufgebaut mit seiner Freundin, eine neue Wohnung bezogen und lebte sein neues Glück aus. Ich war nicht neidisch, ich hatte die Kinder, das war viel mehr wert. Aber ich hatte keine Chance, mir auch nur ein kleines Stück neues Leben aufzubauen. Durch seine Unzuverlässigkeit wurde auch ich unzuverlässig. Meine Dates platzen regelmäßig, allein in Urlaub zu fahren scheiterte daran, dass man nie wusste, ob und wann er die Kinder nahm. Ich konnte nicht mehr und musste weg – weit weg. Mein Plan wäre Australien gewesen, dort habe ich Familie, das ist das Land meiner Träume – so wie für den kleinen Tiger und den Kleinen Bären. Oder Panama – da werden Wünsche wahr. Das bei Jugendämtern, Familiengerichten und dem Vater durchzusetzen war ausweglos, aber die Schweiz, 500 Kilometer entfernt, funktionierte. Die Kinder waren damals zwölf, zehn und sieben Jahre alt, und ich ging mit ihnen weg, weit weg. Ich ließ das gemeinsam gebaute Haus zurück, Familie und Freunde. Ich brauchte einen Ort für uns vier – ohne Störfaktoren. Jakob hat sich erst gesträubt. Auch seine Lehrer verurteilten mich für diesen Schritt, aber ich war mir sicher, ein Neuanfang wäre das Beste, was ihm passieren könnte. So kam er mit, seine Freunde aus Düsseldorf besuchten uns anfangs häufig. Aber irgendwann wurde es weniger, und nach kurzer Zeit hatte er schon wieder Dutzende neue Freunde. Bei Geburtstagen bekam er in den letzten zwei Jahren rund 400 Glückwunsche – tatsächlich rund die Hälfte davon »echte Bekannte« und keine Twitter- oder Instagramm-Freunde.«
Damit endete mein Monolog, und Frau Wunschenstein sah mich an.
»Wir werden es wohl nie herausfinden, warum sich die Dinge genauso entwickelt haben, es gibt immer mehrere Ursachen, und egal, was passiert ist und was noch passiert, machen Sie sich klar, es gibt keinen Schuldigen! Niemals!«, sagte sie eindringlich zu mir.
Recht hatte sie, wir mussten nach vorne blicken, das war immer meine Devise, egal, wie schwer die Zeiten auch waren. Und als ich dort in der Praxis bei Frau Wunschenstein saß und raus auf den See blickte, dachte ich: Wir haben wirklich viel erlebt, Jakob und ich, und auch Bella und Sido. Wir haben immer das Beste draus gemacht. Der Umzug in die Schweiz war zwar eine Flucht, für mich aber in ein Paradies. Die Berge, die Seen, die ausgeglichen Menschen, das auf Praxis und Natur ausgerichtete Schulsystem, die Sauberkeit der Städte, der Service … Das Leben war viel friedlicher als in Deutschland, die Menschen gingen bewusster miteinander um. Ich liebte mein Leben hier, es war nur gerade etwas anstrengend, wie ich gerne gegenüber meinen Freundinnen in Deutschland sagte. Mir fehlte eine Perspektive für Jakob und manchmal einfach auch jemand zum Ausheulen für mich. Ich musste mir wieder mal eingestehen, dass ich mich manchmal einfach nur ausruhen wollte und mittlerweile wirklich gerne jemanden gehabt hätte, an den ich mich anlehnen könnte.
Der richtige Mann. Ich hatte nie die Hoffnung aufgegeben, dass es den einen gibt, den Deckel zum Topf – den Topf zum Deckel. Wo er war, war mir gleich, Entfernung schockte mich nicht. Meinetwegen konnte er in Timbuktu leben, Hauptsache Seelenpartner. Patchwork hingegen war nicht mein Ding. Ich fand es anstrengend und nicht fair den Kindern gegenüber. Ich wollte keinen, der bei mir auf dem Sofa saß und kluge Tipps in Sachen Kindererziehung gab. Ich wollte den aktiven Weltenbummler, der mich spontan einlud zu einem Barcelona- oder Paris-Trip, den mal man in dieser und mal in jener Stadt traf, aber ganz sicher nicht permanent in Wohlen, meiner Kleinstadt in der Schweiz.
Nur wo war dieser Mann? Seit Jahren suchte ich bei Elite, E-Darling, Parship und Tinder. Ich ging zu wenig aus, um ihn bei Partys oder Clubs zu treffen. Es gab solche Typen, aber die waren schnell wieder weg, wenn sie merkten, dass ich wegen der Kinder und vor allem wegen des Ex-Mannes, der sie nie nahm, vollkommen unflexibel war. Und es gab jede Menge anderer Männer vom Typ Couch-Potato, die mich nach drei Monaten fragten, ob sie nicht bei mir einziehen könnten, ob man nicht gemeinsam mit allen Kindern was unternehmen wolle … Das war gar nicht mein Ding. Also wurde mein wichtiges Kriterium für einen Partner: Kinder ja, aber bitte nur erwachsene …
Im Sommer 2019 war ich mir sicher, ich hätte ihn gefunden. Nicht bei Tinder, Parship oder Elite, nicht über Speed-Dating oder eine der sonstigen Singlebörsen, sondern im Zug, im Zug von Dortmund nach Bremen. Dortmund ist meine zweite Heimat – oder meine erste. Dortmund, das ist mein BVB. Ich bin Fußball-besessen, brauche unseren Tempel – unser Stadium. Nicht sehr weiblich? Macht nichts, nur hier spüre ich alle Facetten von Emotionen: Leidenschaft, Trauer, Wut, bodenlose Freude. Hier unter Gleichgesinnten fühlte ich mich einfach pudelwohl.
Also war ich Anfang August 2019 unterwegs vom Supercup – gewonnen gegen die Bayern – nach Hamburg zu einem Geschäftstermin, mit dem Zug und allein, zwei Kids beim Vater, eins in der Schweiz. Euphorisch ohne Stimme (die war im Stadion geblieben) fuhr ich mit dem ICE Richtung Hamburg und freute mich auf mein traumhaftes Hotel an der Elbe. Ich hatte nach langer Zeit mal wieder frei, nicht frei von meinem Job als Juristin, frei als Mama, und ich hatte mir fest vorgenommen, die zwei Tage in Hamburg so richtig zu genießen. Die Zugfahrt war wie immer. Klimaanlage ausgefallen, fehlende Waggons, keine Platzreservierung mehr, alles überfüllt. Ich ging in den Speisewagen, um dort eine Cola zu trinken. Glück gehabt, noch ein freier Platz. Am Tisch nur ein schmächtiger Norddeutscher, der dort sein Bier trank. Jedenfalls dachte ich, dass er norddeutsch war – irgendwie sah er so aus. In keinem Fall Borusse und wahrscheinlich auch kein Fußballfan, zu intellektuell, aber attraktiv. Ich musterte ihn einmal kurz und vertiefte mich dann in die Nachberichterstattung zum Supercup auf meinem Handy, bis er mich ansprach: »Ich glaube, Sie brauchen eine Brille.«
»Da haben Sie recht«, erwiderte ich auf das aufmerksame Statement meines Gegenübers. Interessanter Typ , dachte ich dabei. Er trug selbst eine echt schöne Brille. Bei mir war das Problem, dass mein Kopf seit meiner Geburt wohl nicht mehr gewachsen war, jedenfalls passte mir kein Brillengestell, der Augenabstand war zu eng, das Gesicht zu schmal. Meine Besuche beim Optiker endeten immer mit rosa Vorschulkinderbrillen. Ein Albtraum! Irgendwann hatte ich also das Thema Lesebrille aufgegeben, so mit vierzig, als es eigentlich dringend notwendig wurde. Ich sah scheußlich aus mit Brille, fühlte mich unwohl. Aber dieser Mann hatte eine kleine, schmale Lesebrille.
»Wollen Sie meine mal probieren?«, holte er mich aus meinen Gedanken.
»Super gerne, vielen Dank«, stammelte ich und wurde rot. Erst da fiel mir auf, wie wenig attraktiv ich aussehen musste. Bunte Schlabberhose, weiße zerknautschte Bluse und um den Hals noch ein dünner, zerknautschter BVB-Tuchschal. Nur zwei bis drei Stunden Schlaf und wenig Make-up – insgesamt also ein gruseliges Auftreten. Während ich so darüber nachdachte, dass ich gerade heute deutlich mehr Wert auf mein Aussehen hätte legen sollen, hielt er mir schon die Brille hin.
Читать дальше